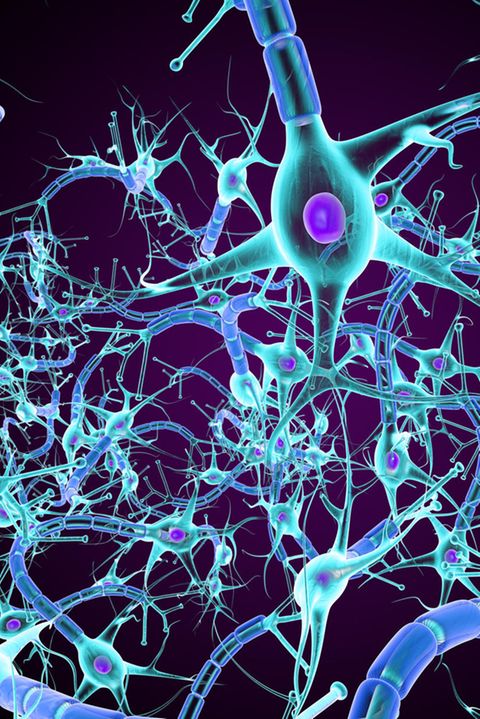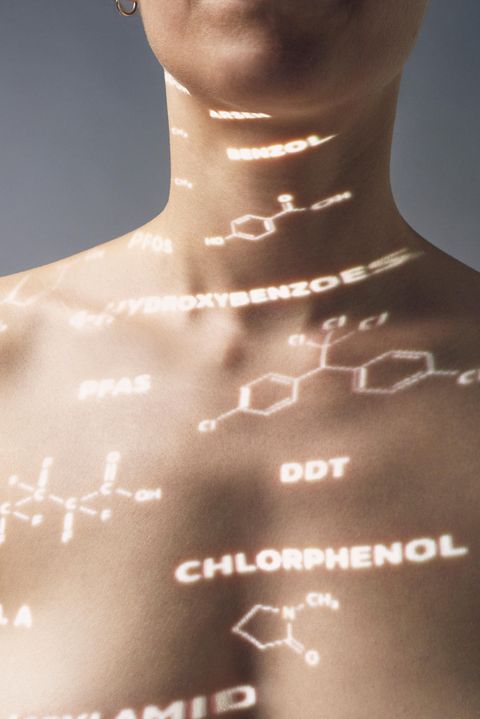Inhaltsverzeichnis
Was ist Atommüll?
Am 26. Juni 1954 speiste 110 Kilometer vor Moskau das erste zivile Atomkraftwerk der Welt Strom ins Netz: Der Reaktor bei Obninsk leistete fünf Megawatt, so viel wie heute eine einzige Windkraftanlage. Und er lieferte die ersten Chargen für eine der größten Herausforderungen der Menschheit. In den 31 Ländern, in denen zurzeit Atomstrom produziert wird, stehen Ende 2011 435 Meiler unter Last, 104 davon in den USA. Sie decken 15 Prozent des globalen Strombedarfs - allerdings in unterschiedlicher Verteilung.
Während Frankreich knapp drei Viertel seiner Elektrizität nuklear erzeugt und noch Überschüsse exportiert, liegt der Anteil in Indien bei drei, selbst in den USA nur bei 20 Prozent. Doch so gering der Gesamtbeitrag der Atomenergie auch sein mag, so kolossal sind die Folgen.
Ein Problem, drei Kategorien
Für den Abfall gibt es drei grobe Kategorien. Schwach und mittelstark strahlt er in den beiden ersten, auf Stufe III dann: intensiv strahlender Müll. Der entsteht, wenn die Brennstäbe im Meiler "abbrennen" - wenn sich also die Uran-Atomkerne in den Stäben spalten und Neutronen freisetzen, die wiederum die Spaltung anderer Uran-Kerne anregen. Aus dieser Kettenreaktion gehen zahlreiche neue Stoffe hervor, die ihrerseits radioaktiv sind: die zerfallen und Strahlung abgeben, etwa Cäsium, Jod und Strontium. Und treffen Neutronen statt auf das spaltbare Uran-235 auf das ebenfalls vorhandene Uran-238 (es hat drei zusätzliche Neutronen im Kern), entstehen weitere radioaktive Elemente.
Etwa Schwermetalle wie Neptunium oder Americium. In den abgebrannten Stäben steckt auch Plutonium- 239. Seine Strahlung dringt in Luft nur wenige Zentimeter weit, schon ein Stück Stoff schirmt sie ab; doch gelangen nur Millionstel Gramm davon in den Körper, lagert es sich in Lunge, Leber und Skelett ab und löst mit hoher Wahrscheinlichkeit Krebs aus. Nach 24 110 Jahren ist von diesem radioaktiven Metall erst die Hälfte zerfallen.
Jod-129, auch im Atommüll enthalten, hat eine Halbwertszeit von 16 Millionen Jahren. Bei der Uranspaltung und dem Zerfall von Spaltprodukten und radioaktiven Schwermetallen entsteht nicht nur Strahlung, sondern auch Wärme - und nur diese wird im Kraftwerk zur Stromerzeugung genutzt. Bis auf etwa 1200 Grad Celsius erhitzt sich das Innerste der Brennstäbe im Reaktorbetrieb. Wenn sie ausgedient haben, hievt sie ein ferngesteuerter Kran in ein Abklingbecken. Dort lagern sie im Wasser - für viele Jahre. Fällt diese Kühlung aus, können sie sich auf über 2500 Grad Celsius erhitzen, es droht eine Kernschmelze. Wie jüngst in Fukushima. Und wie dort liegen in zahlreichen Ländern, auch in Deutschland, die Wasserbecken bei manchen Reaktoren außerhalb der hermetisch abgedichteten Schutzhülle. Werden die Außenmauern zerstört und schlägt der Pool leck, schützt keine Barriere mehr die Umwelt.
Was passiert mit dem Müll?
Viele Atomkraft-Staaten verschicken ausgediente Brennstäbe nach Frankreich oder Großbritannien zur Wiederaufarbeitung: Bis zu zehn Prozent des Materials, etwa das im Reaktor erbrütete Plutonium, lassen sich erneut zu Brennstoff verarbeiten. Die nicht mehr brauchbaren hochradioaktiven Stoffe hingegen werden mit Glas verschmolzen, in Edelstahlzylinder gegossen und gelten offiziell als Müll.
Die gläsernen, bis zu 400 Grad Celsius heißen Kokillen in den Stahlbehältern müssen weitere Jahrzehnte erkalten, bevor sie deponiert werden können. Bis dahin lagern sie oberirdisch, im besten Fall in sogenannten Castoren in gut durchlüfteten Hallen. In Deutschland ist es seit 2005 verboten, Brennstäbe zur Wiederaufarbeitung zu schicken. Stattdessen verpacken die Kraftwerksbetreiber alte Brennstäbe nach fünf Jahren Abklingzeit direkt in Castorbehälter. Diese müssen dann mehrere Jahrzehnte oberirdisch abkühlen. So sind in Deutschland zwölf Zwischenlager in der Nähe der Meiler in Betrieb sowie drei weitere fernab der Kraftwerke, darunter das in Gorleben.
Im schlechteren Fall, in Russland etwa, ruht ein Teil des Mülls in Fässern unter freiem Himmel. Wie etwa eine unbekannte Menge weniger stark strahlenden Abfalls in der kerntechnischen Anlage Majak, wo sich 1957 einer der schlimmsten Atomunfälle der Geschichte ereignete: Nach Ausfall des Kühlsystems war ein Tank explodiert. Womöglich Tausende starben an den Folgen der verheimlichten Katastrophe. In Majak lagern heute radioaktive Abfälle, die zweieinhalbmal so viel Strahlung erzeugen wie das Material, das 1986 in Tschernobyl in die Atmosphäre geschleudert wurde.
Niemand weiß, wie viel Atommüll es gibt
Überraschenderweise aber kennt niemand auf der Welt die Gesamtmenge des Mülls. Selbst die Internationale Atomenergie- Organisation (IAEO) in Wien ist bei dieser Frage ratlos. Eine Datenbank über die Anzahl der weltweit gelagerten Brennstäbe etwa wäre sicher eine gute Idee, findet IAEO-Sprecher Giovanni Verlini: "Soweit ich weiß, denken unsere Experten darüber nach." Doch bis dahin ist selbst die IAEO auf Schätzungen angewiesen.
Vor sechs Jahren gab es danach weltweit etwa 250 000 Tonnen hochradioaktiven Mülls. Für Ende 2010 nannte die IAEO 345 000 Tonnen. Und 2022, wenn in Deutschland die letzten Meiler vom Netz gehen, dürften es 450 000 Tonnen sein - eine Menge, die den Berliner Hauptbahnhof bis unters Dach ausfüllen könnte. Der deutsche Anteil daran wird knapp 18 000 Tonnen betragen. Nur, wohin mit dem Zeug?
Kriterien für die Deponierung
Die Kriterien für die Deponierung von Atommüll haben die IAEO-Mitglieder 1997 festgelegt: Sie solle "nach Möglichkeit" in jenen Ländern erfolgen, die den Müll produziert haben. Ferner sollen "künftigen Generationen keine unangemessenen Belastungen aufgebürdet werden". Bisher aber haben sich nur drei Staaten für einen Endlager-Standort entschieden: Finnland, Schweden, Frankreich. Allen anderen fehlt jeder Plan, wo sie mit den Resten ihrer nuklearen Epoche bleiben sollen.
Dass der Atommüll zum Problem werden könnte, dämmerte den Verantwortlichen dabei schon früh. Auch in Deutschland. Im Wirtschaftsministerium empfahl 1955 ein hoher Beamter: "Die unschädliche Abführung radioaktiver Abfallstoffe ist eine Aufgabe, die gelöst werden muss, bevor der Bau eines Reaktors in der dicht besiedelten Bundesrepublik vertreten werden kann." Die Warnung wurde ignoriert. Im Eis versenken? In die Sonne schießen?
Aberwitzige Entsorgungs-Ideen
Immer neue, teilweise skurrile Endlager-Ideen tauchten stattdessen bis in die 1990er Jahre auf. Wie jene, die sich ein Münchner Physiker 1956 patentieren ließ: Über dem Eis der Antarktis sollten Müllbehälter aus Flugzeugen abgeworfen werden und sich von selber in die Tiefe schmelzen. Der Vorschlag wurde über Jahre auf Fachkonferenzen diskutiert. Wissenschaftler in den USA erwogen gar, den Abfall in die Sonne zu schießen. Der Vorschlag wurde verworfen - zu unsicher. Und zu teuer: 10 000 Dollar kostet es, ein halbes Kilo Nutzlast nur in den Erdorbit zu wuchten. Und in den USA lagern schon jetzt mehr als 70 000 Tonnen hochradioaktiven Materials.
In den 1980er Jahren debattierten Experten über eine Endlagerung in markanten, hochgesicherten Gebäuden. Kritiker wie der Schweizer Geologe Marcos Buser halten das für "unhaltbar". Wasser und Wind nagten an einem Bauwerk auf der Oberfläche viel stärker als an jeder Mine in der Tiefe. Zudem würden damit "Vorstellungen von Sicherheit aufgebaut, die nicht im Mindesten eingelöst werden". Schließlich sei ja nicht nur die Gesellschaft vor dem Endlager zu schützen, sondern auch "das Endlager vor der Gesellschaft". Es sollte verbarrikadiert sein gegen künftige Begehrlichkeiten nach dem gefährlichen Interieur.
Wo ist Atommüll wirklich sicher?
Unwahrscheinlich, solche Begehrlichkeit? Wer hätte "um 1900 die Konflikte vorhergesagt, die bald darauf unsere Zivilisation erschütterten?", fragt Horst Geckeis, Chemiker am Institut für Nukleare Entsorgung in Karlsruhe. "Der Mensch ist leider unkalkulierbar." Wohl auch deshalb gilt die finale Versenkung in der Erde inzwischen als sicherste Variante. Natürliche und technische Barrieren sollen gewährleisten, dass keine Strahlung nach außen gelangt: Der Müll könnte in Behältern aus Stahl stecken, eingebettet in Sarkophage aus Beton, die wiederum umgeben von wärmeresistentem Gestein, darüber Hunderte Meter Fels.
In Deutschland haben Experten bereits 2002 die Anforderungen formuliert, die an eine solche Gruft zu stellen sind: Sie muss 300 Meter unter der Oberfläche liegen. Aber nicht tiefer als anderthalb Kilometer - sonst würden die Temperaturen zu hoch, wäre der Aufwand für den Bergwerksbetrieb zu groß.
Die Gesteinsschicht, in der die Müllkapseln lagern, soll mindestens 100 Meter mächtig sein. Grundwasser darf sich darin nur mit weniger als zehn Milliardstel Meter pro Sekunde bewegen können; ein Wassermolekül müsste also mindestens 317 Jahre brauchen, um einen Meter voranzukommen. Schließlich "dürfen keine Erkenntnisse vorliegen, welche die Einhaltung der Mindestanforderungen über eine Million Jahre zweifelhaft erscheinen lassen." Also Hinweise auf Vulkanismus. Oder auf Gase, die zur Oberfläche drängen.
Welches Gestein ist geeignet?
Die Forscher haben für den Endlagerbau vier Gesteinsarten in die engere Wahl gezogen, aber, sagt Marcos Buser, Mitglied der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit, "ein ideales Gestein kennen wir nicht". Und er zählt auf:
Endlager sind nicht in Sicht
Trotz der Sondierungen: Derzeit habe noch "kein Land eine geologische Deponie für die Zwischen- oder Endlagerung von abgebrannten Brennstäben", klagen Gutachter der IAEO. Offenbar folgt die Dramaturgie der Suche überall auf der Welt gleichen Gesetzen. Die Planung ruft immer Widerstand hervor: Kein Bürgermeister, kein Regionalparlament will eigenes Terrain als Nuklear- Müllkippe zur Verfügung stellen - es sei denn für Gegenleistungen. Für Privilegien. Für Geld.
Eine der wichtigsten Herausforderungen der Zivilisation - beamerieinflusst also von menschlicher Schwäche, von der Gier nach Cash? In Finnland und Schweden lieferten sich Kommunen sogar Wettkämpfe um den Zuschlag für eine Deponie - und um die damit verbundenen Einnahmen.
Im atomkraftfreundlichen Japan dagegen half selbst die Bürgerbeteiligung nichts: Keine einzige Kommune erklärte sich bereit, auch nur Bodenuntersuchungen auf ihrem Terrain zuzulassen. Sogar Länder, in denen sich Atommüll- Verwalter dem Ziel schon nahe glaubten, müssen nach Jahrzehnten der Forschung wieder zurück auf Start. Die USA etwa, deren Standorterkundung bis zum Antritt der Obama-Regierung mehr von politischer Sturheit denn von wissenschaftlicher Akkuratesse getrieben worden war. 1987 rief der US-Kongress den Bergzug Yucca Mountain in Nevada als möglichen Lagerplatz aus. Ein simpler Coup: Das Gelände gehört der Regierung und ist Teil eines früheren Atomtestgebietes. Bis 2009, als Barack Obama die Arbeiten beenden ließ, waren 15 Milliarden Dollar im Tuff versunken.
Riskante Gesteinsschichten
"Yucca Mountain ist eine Katastrophe", sagt Gerhard Jentzsch, Experte für die Standortsicherheit von Nuklearanlagen. Das Tuffgestein dort, sagt der Geophysiker, liege "direkt neben jungen Vulkanen. Außerdem wurden Störungen festgestellt, die auf größere Erdbeben zurückgehen". Zudem registrierten Geologen bei Yucca Mountain innerhalb von 20 Jahren mehr als 600 kleinere Erschütterungen. 2007 entdeckte man eine gefährdete Zone direkt unter einem Areal, auf dem ein Auskühllager für Nuklearbrennstoff entstehen sollte.
Aus den Tuff-Tunneln nahm Jentzsch ein Andenken mit: "Ein Stück Kalkkristall, der sich nur bildet, wenn Wasser fließt. In Yucca Moutain läuft das Wasser aus der Wand." Jetzt beginnt im Land der 100 Meiler die Suche wieder von vorn. In Deutschland steht eine ähnliche Entwicklung an. Einem Endlager im Salzstock von Gorleben geben viele Experten keine Zukunft: Die seit Ende 2010 geltenden neuen Sicherheitsregeln für Atommüll- Grüfte sehen vor, dass hochradioaktive Abfälle, selbst wenn das Lager voll und verschlossen ist, noch mindestens 500 Jahre lang im Fall sich einstellender Probleme wieder geborgen werden könnten.
"Damit scheidet Salz aus", sagt Gerhard Jentzsch. "Mit dem Salz driften irgendwann auch die Behälter. Nach 500 Jahren dürften die kaum noch zu orten sein." Zugleich aber gibt er zu bedenken, "dass die Forderung nach Rückholung der Forderung nach sicherem Einschluss widerspricht." Der Geophysiker ist vorsichtig bei der Wahl der Alternative: "Im Augenblick bin ich für Tongestein. Natürlich fließt es auch. Aber viel langsamer."
"Endlager frühestens ab 2035"
Für Deutschland bedeutet dies, dass eigentlich eilig Scouts ausschwärmen müssten. "Realistischerweise", verlautet aus dem Bundesamt für Strahlenschutz, "kann ein Endlager frühestens ab 2035 in Betrieb gehen." Auch darum weht über dem Erkundungsbau in Lothringen eine schwarz-rot-goldene Fahne: Seit Jahren explorieren dort, unbeachtet von der deutschen Öffentlichkeit, auch Forscher der Bundesanstalt für Geowissenschaften den Ton unter Tage zusammen mit den Franzosen. Und der Granit, auf den die Finnen setzen? "Man hat noch keine Technik, keine Geräte für einen schonenden Ausbruch des Granits entwickelt", kritisiert der Schweizer Geologe Marcos Buser. "Da wird immer noch gebohrt und gesprengt. Und wo gesprengt wird, gibt es Schäden." Schon deshalb, weil dadurch ein Netz feiner Risse entsteht.
"Wir kennen das aus dem Tunnelbau", sagt Buser. "Durch diese Risse kann Wasser fließen." Die angenommene Langzeitsicherheit der skandinavischen Projekte, ergänzt Gerhard Jentzsch, beruhe "nicht auf der Geologie, sondern auf den dort geplanten Kupferkanistern. Wenn die unter Einfluss von Feuchtigkeit schneller korrodieren als berechnet, hat man ein Problem."
Symbole für die Ewigkeit
Die verbreitete Hilflosigkeit der Experten offenbart sich auch in einer anderen Frage: Sollte man die strahlenden Lager lieber unkenntlich versiegeln, damit dort nicht in ein paar Tausend Jahren jemand zu graben beginnt, aus Neugier oder aus archäologischem Interesse an der Welt des 21. Jahrhunderts?
Oder sollte man die Menschen von morgen mit Hinweisen vor der gefährlichen Deponie warnen? Und wie sollte das Wissen um das Gift überliefert werden in eine Zukunft, in der Naturgewalten oder gesellschaftliche Entwicklung die menschliche Zivilisation von Grund auf verändert haben dürften? Zwei Pariser Wissenschaftler hatten dazu allen Ernstes die Idee, am Ort eines Endlagers genetisch veränderte Katzen zu züchten, deren Nachkommen auf ewig Gefahr signalisieren würden: Unter dem Einfluss von Strahlung sollte sich ihre Haut verfärben.
Gestrüpp aus monumentalen Granitstacheln
Andere tüftelten an Symbolen, deren Sinn auch in 10.000 Jahren noch verstanden werden könnte. Eine Kommission im Auftrag des US-Energieministeriums veröffentlichte 1991 eine Studie dazu. Die Forscher empfahlen, ein Gestrüpp aus monumentalen Granitstacheln über Atommüll-Lagern zu errichten. Und Warntafeln in sieben Sprachen - so sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich die Mahnung noch entziffern lassen würde, wenn die Sprachen selbst verschwunden seien. So hatten Ägyptologen ja auch die pharaonischen Hieroglyphen erst anhand des dreisprachigen "Rosetta-Steins" entschlüsseln können.
Der skurrilste Vorschlag stammt aus den 1980er Jahren, zu Papier gebracht unter anderem vom amerikanischen Zeichenkundler und Linguisten Thomas Sebeok. Man könne doch um das nukleare Erbe einen Kult spinnen, behütet von einer Art Priesterschaft mit wissenschaftlicher Ausbildung. Dahinter stand der Gedanke, dass sich religiöse Vorstellungen in der Menschheitsgeschichte als besonders zählebig erwiesen haben. Im Gegensatz zu Technikwissen: Schon heute wisse doch niemand mehr, wie die Erbauer von Stonehenge ihre Steine aufgetürmt haben, schreibt der Philosoph Robert Spaemann. "Man konnte dieses Wissen nicht über so lange Zeiträume weitergeben."
Wenn aber die Gelehrten schon bei der Beschilderung zu keinem Ergebnis kommen - ist dann der Endlagerbau im Untergrund nicht vielleicht grundsätzlich ein Projekt jenseits der derzeitigen Fähigkeiten unserer Zivilisation?
Der niederländische Weg
Das Industriegebiet Vlissingen-Oost an der Mündung der Westerschelde liegt gleich hinterm Deich. Am Himmel kreist ein Bussard, ein Fasan kreuzt die Ringstraße, Windräder summen in der Nordseebrise. Ein Idyll. Wären da nicht: ein Chemie-Unternehmen, eine Aluminiumhütte, ein Gas-, ein Kohle-, ein Atomkraftwerk. Und die COVRA. Im Auftrag der niederländischen Regierung verwahrt die Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval den Nuklearmüll des Landes. Für die Beschilderung wählte man eine einfache Lösung: leuchtende Farben.
Im Zentrum des Geländes strahlt wie ein fremdartiger Solitär ein großer, fensterloser Bunker in Hollands Nationalfarbe Orange. Darauf, in Schockgrün, sind in riesigen Lettern Formeln geschrieben. Einsteins E = mc2, nach der Energie (E) und Masse (m) eines Körpers nur die zwei Seiten einer Gleichung sind. Und Max Plancks Formel E = hν, die die Frequenz (ν) elektromagnetischer Strahlung mit der Energie (E) ihrer Photonen verknüpft, also zeigt, dass Strahlung sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften hat. Unser Langzeitzwischenlager fur mittel- und hochaktive Abfälle, sagt Ewoud Vincent Verhoef, ist das sicherste Gebäude des Landes.
Das Lager hält einem Kampfjet stand
Weit und breit kein Wachpersonal, Türen und Sicherheitsschleusen zu dem Haus in Orange und Grün öffnet Verhoef mit ID-Karte und Geheimzahl. "Wer sollte hier reinwollen? Wenn Greenpeace eine Aktion machen will, braucht es sich nur anzumelden. Und Terroristen kämen vielleicht bis zum Gebäude. Aber nicht weiter." Die Außenwände sind 1,7 Meter dick und so konstruiert, dass sie einem Erdbeben der Stärke 6,5 nicht nachgäben. Der Bau hielte auch, zumindest rechnerisch, dem Aufprall eines Kampfjets stand. Oder einer Explosion im benachbarten Gaskraftwerk. Selbst ein Wasserstand von zehn Metern über Normalnull, höher als in den düstersten Klimaprognosen, soll dem Gefahrgut nichts anhaben können. "Wir haben an alles gedacht", sagt Verhoef. Er öffnet die Tür Eine Halle in der ersten Etage, rot gestrichener Betonfußboden.
Darin eingelassen: 120 runde Deckel, mit starken Schrauben gesichert. Jeder Deckel verschließt eine meterhohe Betonröhre unter dem Hallenboden, und in den Röhren stecken die Fässer mit dem 200 Grad Celsius heißen Abfall. Ein Deckel ist offen, am Rand der Röhre kniet ein Techniker mit einem Messgerät. "Die Abfallbehälter füllen wir mit Helium", sagt Verhoef. "Und die Betonröhren mit dem Edelgas Argon." Helium ist leichter, Argon schwerer als Luft. "In regelmäßigen Abständen untersuchen wir das Argon auf Heliumspuren. So wissen wir, ob die Behälter dicht sind."
Alle 20 Jahre werden die Außenwände neu gestrichen, erzählt Verhoef, in immer blasserem Orange, "als Symbol für die abnehmende Wärme im Inneren. Nach 100 Jahren wird das Gebäude weiß sein." Nur die Formeln bleiben schockfarbengrün, denn radioaktiv strahlt das Lagergut dann natürlich immer noch. Teils noch für Zehntausende von Jahren - ein Problem von Bestand, vielleicht in Zukunft zu lösen. Vielleicht auch nie. Die Farbenlehre der COVRA wurde bereits mit einem Kommunikationspreis bedacht - gestiftet von der Nuklearindustrie.