5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5 <strong>Jahre</strong> <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>
1<br />
5 <strong>Jahre</strong> <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>
4 Vorwort | Oliver Wittke<br />
6 Gute Zeiten und schlechte Zeiten für Baukultur – Die <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> | Ulrich Hatzfeld<br />
Gestalt geben<br />
12 Zum Verhältnis von Baukultur und Gestaltqualität | Wilfried Wang<br />
16 Neue Bilderwelten und alte Mythen – Images in der Stadtproduktion | Frank Roost<br />
22 Gestalt geben | Frauke Burgdorff<br />
24 Deutschlandschaft – Epizentren der Peripherie | Francesca Ferguson<br />
26 1000 Baulücken in <strong>NRW</strong> | Hartmut Miksch<br />
28 Temporäre Architektur an besonderen Orten | Kunibert Wachten<br />
30 Der Traum vom Turm – Eine Ausstellung von besonderem Charakter | Peter Dübbert<br />
32 Innovationspreis Wohnungsbau des Landes Nordrhein-Westfalen | Hans-Dieter Krupinski<br />
34 Stadt und Handel – Initiativen für Baukultur | Wolfgang Christ<br />
36 Orte der Arbeit – Gestaltungsmöglichkeiten in Gewerbegebieten | J. Alexander Schmidt und Stefanie Bremer<br />
38 Hauptstadtplanungen –<br />
Werkstattgespräche zur Bewerbung des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas 2010 | Dirk Haas<br />
Räume öffnen<br />
42 Die Zukunft des öffentlichen Raumes – Traum oder Alptraum? | Udo Weilacher<br />
46 Von der Öffentlichkeit zu einem Universum von Teilöffentlichkeiten | Ernst Hubeli<br />
52 Räume öffnen | Frauke Burgdorff<br />
54 Orte der Urbanität – Der Landeswettbewerb Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze | Franz Pesch<br />
56 Kunst trifft Stadt | Petra Lindner<br />
58 Privatgrün 2004 | Jochen Heufelder<br />
60 Kunstlicht und Lichtkunst im Stadtraum | Christoph Brockhaus<br />
62 Herbstakademie Stadtraum B1 und Stadt der Geschwindigkeit | Martin zur Nedden<br />
2<br />
Inhalt
Kommunikation suchen<br />
66 Beredte Sprachlosigkeit? Die kommunikative Dimension der Baukultur | Klaus Selle<br />
72 Was Architektur zur Kultur beiträgt | Dietmar Steiner<br />
76 Die Bundesinitiative Architektur und Baukultur | Achim Großmann<br />
80 Kommunikation suchen | Frauke Burgdorff<br />
82 Architektur macht Schule! | Christof Rose<br />
84 Stadt(T)räume | Birgit Frey<br />
86 Türme für Pisa | Andrea Wilbertz<br />
88 Europäisches Haus der Stadtkultur und stadt.bau.raum | Michael von der Mühlen<br />
90 Baupolitische Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen | Martin Gerth<br />
92 Mögliche Orte – Bildwelten, Planerwelten?! | Karin Bandow und Volker Katthagen<br />
94 Tag der Architektur in <strong>NRW</strong> | Hans-Ulrich Ruf<br />
96 koelnarchitektur.de | Dörte Gatermann<br />
98 plan – Forum aktueller Architektur in Köln | Kay von Keitz und Sabine Voggenreiter<br />
100 Essen erlebt Architektur | Peter Brdenk<br />
102 RheinRuhrCity | Henrik Sander<br />
104 <strong>NRW</strong>urbanism – <strong>StadtBauKultur</strong>-Kongress 2004 | Thorsten Schauz, Yasemin Utku und Angela Uttke<br />
106 Realität [Bauen] – <strong>StadtBauKultur</strong>-Kongress 2005 | Frauke Burgdorff<br />
Traditionen (er)finden<br />
110 Tradition und Identität – Theoretische Reflexionen und das Europäische Beispiel | Jörn Rüsen<br />
114 Regionalismus – Zwischen Tradition und Erfindung | Friedrich Achleitner<br />
116 Von der Pubertät der Stadt jenseits der Moderne | Carl Fingerhuth<br />
120 Traditionen (er)finden | Frauke Burgdorff<br />
122 Denkmalkommission | Eberhard Grunsky<br />
124 DenkMalStadt! Ein europäischer Dialog über Denkmalpflege und Stadtentwicklung | Udo Mainzer<br />
126 Planungs- und Gestaltungsbeiräte in <strong>NRW</strong> | Michael Arns<br />
128 Die Kampagne „Liebe deine Stadt“ | Merlin Bauer<br />
130 Gartenkunst in <strong>NRW</strong> – Zur Kultur des gestalteten Freiraums | Hans-Dieter Collinet<br />
132 Zollverein – Symbol im Wandel und Erbe für die Zukunft | Roland Weiss<br />
Baukultur persönlich<br />
136 Garten der Erinnerungen, Duisburg | Söke Dinkla<br />
137 H20, Münster | Marc Günnewig, Fabian Holst und Jan Kampshoff<br />
138 Rheinufer, Düsseldorf | Henry Storch<br />
139 Technologiezentrum Umwelt TZU, Oberhausen | Burkhard Ulrich Drescher<br />
140 Campus Ernsting’s family, Coesfeld-Lette | Kurt Ernsting<br />
141 Insel Hombroich, Neuss | Christa Reicher<br />
142 PACT Zollverein, Essen | Oliver Scheytt<br />
143 THS-Hauptverwaltung auf Nordstern, Gelsenkirchen | Burghardt Schneider<br />
144 BauhausKarree, Duisburg | Karl-Heinz Cox<br />
145 Bundeskanzlerbungalow, Bonn | Johannes Busmann<br />
146 Konzerthaus Dortmund – Philharmonie für Westfalen, Dortmund | Monika Block<br />
147 Fortbildungsakademie Mont Cenis, Herne | Tillmann Neinhaus<br />
148 Schurenbachhalde, Essen | Henrietta Horn<br />
149 Jahrhunderthalle, Bochum | Karl-Heinz Petzinka<br />
150 Dom und Blick über Köln | Barbara Schock-Werner<br />
151 Drei Orte | Erika Spiegel<br />
Anhang<br />
154 Autorenverzeichnis<br />
156 Bildnachweis<br />
160 Impressum<br />
3
Oliver Wittke<br />
Minister für Bauen und Verkehr<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Der Dramatiker Ödön von Horváth hat einmal gesagt: „Eigentlich bin ich<br />
ganz anders, aber ich komme so selten dazu.“ Manchmal fällt mir diese<br />
Formulierung ein, wenn ich an den Zustand der Baukultur in Deutschland<br />
denke. Denn „eigentlich“ ist jeder für mehr Baukultur, für den Erhalt und<br />
die Pflege von Baudenkmalen, für einen qualitätvollen öffentlichen Raum<br />
und für möglichst gute Architektur. Natürlich ist niemand ausdrücklich<br />
gegen Baukultur. Aber spätestens dann, wenn es konkret wird, wenn<br />
schnell gebaut und geplant werden soll, wird sie gelegentlich unbequem.<br />
Dann kostet Baukultur möglicherweise Zeit und Geld. Und dann setzen<br />
schnell Überlegungen ein, ob es in diesem besonderen „Einzelfall“ nicht<br />
auch ohne besondere bauliche Qualitäten geht. Schlimmer noch: In der<br />
gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation werden solche Einzelfälle fast<br />
regelmäßig zum Normalfall.<br />
Wer also heute mehr Baukultur will, wird mit Widersprüchen umgehen<br />
müssen. Auf der einen Seite sind Architektur und Städtebau konstituierende<br />
Bestandteile unserer Kultur. Auf der anderen Seite bleibt die Senkung von<br />
Baukosten ein ökonomisches Gebot der Stunde. Einerseits sind Baudenkmale<br />
für die Profilierung von Standorten so wichtig wie nie zuvor; andererseits<br />
fällt es immer schwerer, die zum Erhalt dieser Denkmale erforderlichen<br />
Mittel aufzubringen. Während es in der Wirtschaft inzwischen heißt, dass<br />
die Schnellen die Langsamen fressen, brauchen baukulturelle Qualifizierungsprozesse<br />
vor allem Zeit.<br />
4<br />
Vorwort<br />
Nicht alle genannten Widersprüche sind wirkliche Widersprüche.<br />
„Gut bauen“ heißt keineswegs „teurer bauen“.<br />
Gute Architektur stützt die ökonomische Werthaltigkeit von<br />
Gebäuden. Letztendlich wird man in der Baukulturdiskussion<br />
nur dann vorankommen, wenn man den gesellschaftlichen –<br />
und auch den immateriellen – Wert von Architektur und<br />
Städtebau, von Ingenieurbauwesen und Landschaftsgestaltung<br />
anerkennt. Welche Gebäude, Plätze oder Parks werden<br />
wir der nachfolgenden Generation als potenzielle Denkmale<br />
hinterlassen? Wird irgendjemand einmal über die baukulturellen<br />
Fingerabdrücke unserer Zeit ins Schwärmen kommen?<br />
Die Folgen der baukulturellen Gedankenlosigkeit sind heute<br />
schon sichtbar. Die Stadtflucht und ihre enormen Kosten<br />
sind – zu Ende gedacht – auch ein Problem der Baukultur.<br />
Wenn wir über die Strukturkrise der Bauwirtschaft nachdenken<br />
und darüber, welche Perspektiven sie langfristig hat,<br />
so ist dies auch ein Problem der Baukultur.<br />
Wir machen einen großen Fehler, wenn wir Baukultur allein<br />
als die Kunst der ästhetischen Optimierung definieren.<br />
Sie ist eben keine ideologische Oberflächenformel oder nur<br />
Urbanitätsreklame. Baukultur ist vielmehr angewandte<br />
Strukturpolitik. In Zeiten der schrumpfenden Städte kann<br />
die Bauwirtschaft nicht mehr allein auf die Wachstumskarte<br />
setzen. Das System der möglichst hohen Bauleistung und<br />
des „noch mehr desselben“ funktioniert nicht mehr; wir<br />
brauchen mehr Qualität, intelligentere Bauweisen und vernetzte<br />
Formen des Planens: eben mehr Baukultur.<br />
Mit der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> hat das Land<br />
Nordrhein-Westfalen in den letzten fünf <strong>Jahre</strong>n den Versuch<br />
unternommen, baukulturell konkret zu werden. Die Basis<br />
dafür waren über siebzig Projekte aus dem gesamten<br />
Spektrum des Baugeschehens. Ziel war immer, eine Diskussion<br />
darüber zu beginnen, wie „gutes Bauen in <strong>NRW</strong>“ aussehen<br />
muss.
Die in dieser Veröffentlichung dokumentierten Projekte ordnen<br />
sich drei thematischen Säulen zu: Erstens geht es um<br />
die Bestimmung und moderne Neudefinition von architektonischer<br />
Gestaltqualität. Der zweite Schwerpunkt befasst sich<br />
mit dem Zustand und der Zukunft des öffentlichen Raumes.<br />
Der Umgang mit dem baukulturellen Erbe bildet die dritte<br />
Gruppe.<br />
Zentrale Handlungsansätze der Initiative waren – neben der<br />
Einflussnahme auf konkrete Bau- und Planungsprojekte –<br />
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Diskussionen<br />
nahezu im gesamten Landesgebiet (und zum Teil auch im<br />
europäischen Umfeld). Dabei ist es gelungen, nicht nur die<br />
Fachwelt zu bewegen, sondern auch eine breite öffentliche<br />
Diskussion „vor Ort“ anzuregen. Inzwischen sind in vielen<br />
Städten und Organisationen neue Gesprächskreise entstanden,<br />
die die Arbeit der Gestaltungsbeiräte ergänzen. Schulen<br />
und Hochschulen haben entsprechende Projekte entwickelt.<br />
Kunstvereine und auch die etablierte Kunstszene haben<br />
baukulturelle Fragestellungen aufgegriffen. Öffentliche Aufrufe<br />
wie beim Baulückenprojekt oder der „Straße der Gartenkunst<br />
<strong>NRW</strong>“ fanden eine erstaunliche Resonanz. In Zusammenhang<br />
mit dem „Plätze-Programm“ wurde ein bisher<br />
unbekanntes bürgerschaftliches Engagement erreicht.<br />
Die neue Landesregierung hat beschlossen, die <strong>Landesinitiative</strong> StadtBau-<br />
Kultur <strong>NRW</strong> fortzuführen. Besonders wichtig ist uns dabei die strukturpolitische<br />
Dimension. Nordrhein-Westfalen verfügt über ein immenses Bauvolumen<br />
und ist Sitz und Markt der größten Unternehmen der Bau- und<br />
Wohnungswirtschaft. Baukultur bedeutet auch, für diesen und in Kooperation<br />
mit diesem Wirtschaftssektor neue Produkte und Lösungen zu entwickeln.<br />
Vor allem dank der aktiven Mitarbeit eines breiten Spektrums von Unterstützern<br />
war die Initiative bisher so erfolgreich. Konkret zu nennen sind hier<br />
die Architektenkammer NW, die Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong>, die Arbeitsgemeinschaft<br />
der Kommunalen Spitzenverbände <strong>NRW</strong>, die Vereinigung der<br />
Industrie- und Handelskammern <strong>NRW</strong>, die Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft<br />
<strong>NRW</strong>, mehrere Künstlerverbände und viele Einzelpersönlichkeiten.<br />
Hinzu kommt die Mitarbeit der Städte und Gemeinden des Landes.<br />
Vergessen darf man auch nicht die Bürger, die sich in Vereinen, Schulen<br />
und Workshops für „Baukultur im Kleinen“ engagiert haben. Ohne die Hilfe<br />
dieser Gruppen und Menschen wäre die Initiative eine leere Ideenhülle<br />
geblieben. Alle haben dazu beigetragen, der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> ein Gesicht zu geben. Hierfür bedanke ich mich ganz herzlich.<br />
5
Ulrich Hatzfeld<br />
Mit Baukultur umzugehen heißt, Widersprüche produktiv zu machen<br />
Es gibt in der Tat nicht wenige, die Baukultur und Gestaltqualität mit Luxus<br />
und Schöngeisterei assoziieren: ein „Überbauthema“, das man in guten Zeiten<br />
im Feuilleton vertiefen könnte. Aber spätestens dann, wenn es konkret<br />
wird, wenn es um wirtschaftsnahe Planungsverfahren und zügiges Bauen<br />
geht, werde Baukultur zum Kostenfaktor und Investitionshemmnis. In der<br />
nun seit <strong>Jahre</strong>n anhaltenden Phase, in der die Bauwirtschaft von einer Krise<br />
in die nächste geworfen werde, komme im Zweifelsfall „erst das Bauen,<br />
dann die Kultur“. Allzu viel und allzu teure Baukultur passe nun einmal<br />
nicht in eine Zeit, in der primär Arbeitsplätze geschaffen, das Sozialsystem<br />
gesichert und das Gesundheitswesen neu geordnet werden müsse.<br />
Für andere hingegen ist Baukultur fast so etwas wie eine Überlebensstrategie,<br />
eine Insel der Hoffnung in einem Meer der Perspektivlosigkeit. Schon<br />
die Vergangenheit habe – so die Argumentation – gezeigt, dass die Logik<br />
von Rationalisierung und Massenproduktion allein nicht trage. Wenn die<br />
Nachfrage nach Massenware auch demographisch bedingt nachlasse,<br />
müsse man die Strategie des „immer mehr desselben“ und des „immer<br />
kostengünstiger“ modifizieren. Wie in der übrigen Wirtschaft liege auch die<br />
Zukunft des Bauens in Deutschland in einer „diversifizierten Qualitätsproduktion“;<br />
konkret meine dies neue Produkte, ingenieurwissenschaftliche<br />
Innovationen und vor allem neue architektonische Gestaltqualitäten.<br />
Nur „gutes Bauen“ schaffe sichere Arbeit, eröffne neue Märkte und bilde<br />
die Grundlage für den Export von Architektur- und Ingenieurleistungen.<br />
Eine dritte Gruppe betont den Charakter von Baukultur als künstlerischkulturelle<br />
Aufgabe. Die öffentliche Hand sei für die Erhaltung des Kulturgutes<br />
Stadt und dessen Weitergabe an die nachfolgenden Generationen<br />
verantwortlich. Die Erhaltung des kulturellen Erbes, also Denkmalschutz und<br />
-pflege, dürften sich nun einmal nicht der Logik einer immer kurzatmigeren<br />
Immobilienverwertung unterordnen. Ein Kulturstaat sei eben auch ein Baukulturstaat.<br />
Dasselbe gelte für die künstlerische Sicht auf die Stadt: Architektur<br />
als älteste und öffentlichste aller Künste könne nicht allein mit dem<br />
kalten Maßstab der Rentabilität gemessen werden.<br />
6<br />
Gute Zeiten und schlechte Zeiten<br />
für Baukultur<br />
Die <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Sichtweisen auf das<br />
Thema Baukultur sehr unterscheiden, spricht sich kaum<br />
jemand offen gegen baukulturelle Kriterien wie die Bewahrung<br />
des historischen Erbes, den Anspruch auf Schönheit<br />
oder die Forderung nach gestalterischer Qualität aus. Das<br />
gilt selbst für die Vertreter einer harten Investitionsstrategie,<br />
insbesondere dann, wenn Architektur und Gestaltung die<br />
Vermarktbarkeit von Investitionsobjekten verbessern. Diese<br />
generelle Zustimmung ist auf der anderen Seite vermutlich<br />
eines der größten Probleme für die Anhebung des baukulturellen<br />
Niveaus: Die Forderung nach mehr Baukultur hat –<br />
zumindest so lange, wie sie in dieser erhabenen Allgemeinheit<br />
bleibt – keine erkennbaren Feinde. Erst wenn Baukultur<br />
konkret wird, wenn sie sich gegen schnelles Bauen oder<br />
gegen allzu glatte Planungsverfahren wendet, kostet Baukultur<br />
Aufwand: Zeit, Mühe und Geld. Und nahezu regelmäßig<br />
werden dann Strategien zur Beschleunigung und zur<br />
Senkung von Kosten und Standards wirksam. Und leider<br />
muss man dann „in diesem Einzelfall“ und „mit Bedauern“<br />
auf baukulturell qualifizierende Verfahren verzichten.<br />
Zusätzlich wird das allzu leicht formulierte Bekenntnis zu<br />
Baukultur dadurch erleichtert, dass es keine allgemein anerkannte<br />
Abgrenzung und erst recht keine numerischen Kriterien<br />
für diesen Begriff gibt. Wenn man etwa feststellt, dass<br />
Baukultur in erster Linie aus Diskussionsbereitschaft und<br />
wachem Bewusstsein für die Umwelt besteht, ist das zwar<br />
richtig; aber in der sich anschließenden Diskussion verschwimmen<br />
dann nicht selten die Grenzen zwischen Baukultur<br />
und Baulyrik. Die Frage, was Baukultur ist und was<br />
nicht, ist eben nicht nur zeitabhängig, sondern auch regional<br />
und interkulturell sehr unterschiedlich zu beantworten.<br />
Letztendlich beschreibt Baukultur eine besondere Haltung<br />
gegenüber dem Planen und Bauen. Als solche – so formuliert<br />
es das Memorandum <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> – „entzieht<br />
sich Baukultur schlichter empirischer Messbarkeit oder Operationalität.<br />
Denn sie ist<br />
- weniger ein Produkt als ein Anspruch und<br />
- weniger ein Zustand als ein Prozess.
Baukultur spricht in erster Linie künstlerisch/ästhetische Kriterien<br />
an, die in dem Begriff der Gestaltqualität anklingen.<br />
Kriterien sind dann Authentizität, Innovation, Umgang mit<br />
Maßstäblichkeiten, Materialien und städtebauliche Integration.<br />
Baukultur – so könnte man zusammenfassen – ist ein<br />
Verfahren und ein Prozess mit dem Ziel, „besser zu bauen<br />
und zu planen“.<br />
So engagiert und facettenreich man über die theoretische<br />
Fundierung des Baukulturbegriffs reden kann, so konkret<br />
sind andererseits die aktuellen baupolitischen Probleme, zu<br />
deren Beseitigung die Baukultur eigentlich beitragen soll.<br />
Land auf und Land ab, an nahezu jeder Ausfallstraße, in<br />
jedem Gewerbegebiet und natürlich auch in jedem städtischen<br />
Zentrum drängen sich jene Investorenobjekte, deren<br />
Bezug zur jeweils nächstjährigen Unternehmensbilanz unmittelbar<br />
ablesbar ist. Kostenoptimierte Generalunternehmer<br />
und -übernehmer produzieren – anonym, schnell und<br />
effizient – Projekte, die vermutlich die Sanierungsfälle von<br />
übermorgen werden. Denkmalschutz und -pflege geraten<br />
unter Legitimationsdruck. Die Fachdiskussion bleibt eine<br />
Diskussion innerhalb des Fachs; die einschlägigen Fachzeitschriften<br />
konzentrieren sich auf ästhetisch und rhetorisch<br />
hoch stehende Debatten, die gerne um Architekturhighlights<br />
oder -klassiker kreisen. Zwischenzeitlich entwickelt<br />
sich die Realität der Pensionsfondsobjekte, der Einkaufszentren<br />
und suburbanisierten Welten weiter. Um den öffentlichen<br />
Raum ist es kaum besser bestellt; er gilt inzwischen als<br />
weitgehend vernachlässigt und gestalterisch beliebig. Hinzu<br />
tritt die fast vollständige Abwesenheit von Baukultur im<br />
Bereich der Infrastrukturbauwerke und -anlagen.<br />
Selbst wenn man – zu Recht – konzediert, dass eine solche<br />
Beschreibung der baukulturellen Situation in Deutschland<br />
grob und übertrieben ist, wird man dennoch feststellen<br />
müssen, dass das baukulturelle Niveau in den letzten Jahrzehnten<br />
wohl kaum angestiegen ist. Auf jeden Fall dürfte es<br />
nur eine begrenzte Anzahl von aktuellen Bauten, Ensembles<br />
oder Siedlungen geben, die sich kommenden Generationen<br />
als „Denkmale der Zukunft“ empfehlen.<br />
Sich immer wieder neu erfinden: die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> in <strong>NRW</strong><br />
Gleichwohl bleibt zu fragen, warum das Land Nordrhein-Westfalen im <strong>Jahre</strong><br />
2001 eine auf zehn <strong>Jahre</strong> angelegte <strong>Landesinitiative</strong> zur Baukultur (<strong>Landesinitiative</strong><br />
<strong>StadtBauKultur</strong>) auf den Weg gebracht hat. Denn zum einen dürften<br />
die geschilderten baukulturellen Defizite kaum größer sein als in anderen<br />
Bundesländern. Zum anderen sind auch in diesem Land die Haushalts- und<br />
Strukturprobleme zweifellos so groß, dass die Beschäftigung mit einem vermeintlichen<br />
„Überbauthema“ wie Baukultur einer besonderen Begründung<br />
bedarf.<br />
Bereits das erwähnte Memorandum, das als Grundlage und „Programm“<br />
der Initiative formuliert wurde, hebt deren strukturpolitischen Ansatz hervor.<br />
Baukultur ist demnach keine ideologische Oberflächenformel und versteht<br />
sich auch nicht als die Kunst des Schönmachens bzw. der ästhetischen<br />
Maximierung. Die Baukulturinitiative definiert sich ganz explizit als angewandte<br />
Strukturpolitik. Es geht um die Entdeckung neuer Investitionsfelder<br />
im städtebaulichen Bestand und Innovationen in der städtebaulichen Weiterentwicklung.<br />
Denn Nordrhein-Westfalen ist Standort und Absatzmarkt<br />
einer der größten Bauproduktionen in Europa. Hier finden sich die Firmensitze<br />
vieler großer Bauunternehmen, Baustoffproduzenten und -verarbeiter.<br />
Diese Bauwirtschaft befindet sich in einer Dauerkrise: Allein seit dem Jahr<br />
1995 hat sich die Zahl der Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe<br />
fast halbiert. In dieser Situation sind vor allem neue Perspektiven<br />
erforderlich, denn kaum etwas spricht für eine Umkehrung dieses seit<br />
<strong>Jahre</strong>n stabilen Abwärtstrends. Im Gegenteil: Die demographisch bedingte<br />
Schrumpfung der Märkte bzw. das Nachlassen der Nachfrage nach Stadt<br />
machen das Marktumfeld eher schwieriger. Die öffentliche Finanzsituation<br />
dürfte aller Voraussicht nach ebenfalls keine Wiederbelebung der Bauinvestitionen<br />
bewirken. Wer nach Perspektiven für die Bauwirtschaft sucht, wird<br />
deshalb wohl vor allem darüber nachdenken müssen, wie Innovationen im<br />
Bausektor ermöglicht, wie neue Qualitäten und Produkte entstehen und wie<br />
Prozesse der Planens und Bauens reorganisiert werden können. Nur eine<br />
in diesem Sinne innovationsorientierte Bauwirtschaft wird ihre Leistungen<br />
exportieren können.<br />
Weitere Handlungsoptionen für die Baukulturinitiative ergeben sich aus der<br />
breiten Ausdifferenzierung der fachspezifischen Bildungs- und Forschungslandschaft.<br />
Wie kein anderes Bundesland verfügt Nordrhein-Westfalen über<br />
große Ausbildungskapazitäten für Architekten und Stadtplaner. Aufgabe<br />
und Chance der Initiative ist es, den Transfer der fachbezogenen Bildung<br />
und Forschung in die Baupraxis zu unterstützen.<br />
7
Ein anderer Begründungszusammenhang ergibt sich aus der Symbolkraft<br />
und den Mobilisierungseffekten baukultureller Projekte. Hier kann die Initiative<br />
an den Erfahrungen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park<br />
anknüpfen und diese weiterentwickeln. In zunehmend standardisierten<br />
und anonymisierten Stadtbildern sind baukulturell profilierte Gebäude, aber<br />
auch baukünstlerische Interventionen und Interpretationen wichtige Angebote<br />
zum bürgerschaftlichen Engagement und zur individuellen Identifikation.<br />
Denn im Unterschied zu den Produkten der ökonomischen Globalisierung<br />
sind baukulturell profilierte Projekte immer nur an einem ganz bestimmten<br />
Ort bzw. in einer spezifischen Umgebung „sinnstiftend“; sie sind<br />
Anlass und unverwechselbare Bühne für spezifische Formen der sozialen,<br />
kulturellen und interethnischen Kommunikation. Gerade ein Land wie Nordrhein-Westfalen,<br />
dessen Ballungskern in der Phase der Industrialisierung<br />
ausgesprochen schnell gewachsen ist und dessen heutige Erscheinungsform<br />
recht weit von herkömmlich gewachsenen urbanen Strukturen entfernt ist,<br />
bedarf neuer baulicher Profilierungen und zuweilen auch einer neuen baukulturellen<br />
Symbolik. Nordrhein-Westfalen braucht – neben der inzwischen<br />
etablierten Industriekultur – neue „baukulturell geprägte Bilder“.<br />
<strong>Landesinitiative</strong> konkret<br />
In dem Prozess der inhaltlichen Schwerpunktbildung der <strong>Landesinitiative</strong><br />
haben sich drei Handlungsfelder ergeben, denen sich die bisherigen Projekte<br />
und Aktivitäten des Programms zuordnen.<br />
Im ersten Handlungsbereich geht es um architektonische, städtebauliche<br />
und landschaftsplanerische Gestaltqualitäten im herkömmlichen Sinn. Die<br />
Diskussionen bewegen sich dabei zwischen architektonischen Highlights<br />
und der Architektur des Alltags, zwischen Einfamilienhaus und technischen<br />
Bauwerken sowie zwischen öffentlichen Parks und privaten Grünflächen. Im<br />
Mittelpunkt steht dabei immer die Frage, welche Ausdrucksformen moderne<br />
Architektur und Landschaftsgestaltung am Anfang des 21. Jahrhunderts<br />
finden. Dabei spielen u.a. Themen wie temporäre Architektur, Architektur<br />
im Stadtrückbau, die Gestaltung von Gewerbeimmobilien oder landesweite<br />
Wettbewerbe eine Rolle.<br />
Die zweite Säule der Initiative befasst sich mit der Weiterentwicklung des<br />
öffentlichen Raums. So wird etwa mit einem Wettbewerb zur Gestaltung<br />
von Stadtplätzen nach aktuellen Strategien zur Inszenierung und Gestaltung<br />
von Plätzen gesucht. In mehreren Ausstellungen, Wettbewerben und Workshops<br />
wird das Thema „Lichtkunst – Stadtlicht“ aufgegriffen. In dieses<br />
Handlungsfeld gehört auch die Aktualisierung (und ggf. Qualifizierung) von<br />
Verfahren im Planen und Bauen. Welche Formen der Kommunikation mit<br />
Bürgern oder mit der Wirtschaft passen in die Zeit? Wie kann das Wettbewerbswesen<br />
weiterentwickelt werden?<br />
8<br />
Die dritte Säule des Programms thematisiert schließlich die<br />
zeitliche Dimension von Baukultur, also vor allem Denkmalschutz<br />
und -pflege. Hier wird die Diskussion um die Zukunft<br />
des Denkmalschutzes und einen möglichst intelligenten Umgang<br />
mit den baukulturellen Traditionen des Landes geführt.<br />
Ziel ist, in allen Handlungsbereichen möglichst direkt zu<br />
Umsetzungen und letztendlich zur Beeinflussung der Investitionspraxis<br />
zu kommen. Dabei ist es hilfreich, dass die Initiative<br />
auf zehn <strong>Jahre</strong> angelegt ist und sich nicht dem Vorwurf,<br />
ein Strohfeuer zu sein, aussetzen muss. In Nordrhein-Westfalen<br />
gibt es zudem vergleichsweise gute Rahmenbedingungen<br />
für eine neue Baukulturpraxis. Auf die Internationale<br />
Bauausstellung Emscher Park und die in ihrem Zusammenhang<br />
entstandenen Referenzprojekte wurde bereits hingewiesen.<br />
Darüber hinaus ergeben sich für die angestrebte<br />
Verklammerung von Kunst/Kultur auf der einen und Architektur/Stadtentwicklung/Landschaft<br />
auf der anderen Seite<br />
sehr positive Impulse durch die „Regionalen – Kultur- und<br />
Naturräume“, die RuhrTriennale und die Kulturhauptstadtbewerbung<br />
„Essen für das Ruhrgebiet 2010“.<br />
Ziel der Initiative ist es, eine öffentliche Diskussion über Stadt,<br />
über Architektur und Ingenieurbaukunst anzuregen. Baukultur<br />
ist daher auch eine originär kommunikative Aufgabe.<br />
Insofern war es für die Baukulturinitiative unerlässlich, eine<br />
breite Unterstützungsbasis aufzubauen. In den Gremien der<br />
Initiative sind – neben profilierten Einzelpersönlichkeiten –<br />
die Architektenkammer NW und die Ingenieurkammer-Bau<br />
<strong>NRW</strong>, die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände<br />
<strong>NRW</strong>, die Industrie- und Handelskammern <strong>NRW</strong>,<br />
zahlreiche Fachverbände und -organisationen, die Verbände<br />
der Bau- und Wohnungswirtschaft <strong>NRW</strong> und Künstlerverbände<br />
vertreten. Alle Institutionen haben in den letzten <strong>Jahre</strong>n<br />
ihre Ideen und Projekte in die Initiative eingebracht.<br />
Zusätzlich wurde in der Stadt Gelsenkirchen das Europäische<br />
Haus der Stadtkultur eingerichtet, das die Vielzahl der Projekte,<br />
Initiativen und Aktionen steuert und aufbereitet.
Was heißt nun konkret „Projekte“? Bis zum heutigen Zeitpunkt<br />
wurden etwa 70 Projekte umgesetzt; das Spektrum<br />
reicht dabei von Workshops, Veranstaltungen und Veröffentlichungen<br />
über Wettbewerbe und Ausstellungen bis hin<br />
zu investitionsorientierten Projekten. Im Mittelpunkt steht<br />
die Schaffung von urbanem Bewusstsein durch<br />
- Angebote zur Mitwirkung (z.B. durch die Projektreihen<br />
„1.000 Baulücken“ oder „Türme für Pisa“),<br />
- Inszenierungen (z.B. im Bereich der temporären Architektur),<br />
- öffentliche Kontroversen (z.B. durch Veranstaltungen zum<br />
New Urbanism oder zum Denkmalschutzgesetz <strong>NRW</strong>),<br />
- öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen<br />
(z.B. durch Ausstellungen wie „Der Traum vom Turm“,<br />
„Deutschlandschaft“ und „RheinRuhrCity“, Veranstaltungen<br />
wie „Realität Bauen“ oder öffentlichkeitsorientierte<br />
Kampagnen wie der „Tag der Architektur“),<br />
- die Einbeziehung neuer Partner (z.B. durch die Gemeinschaftsaktionen<br />
mit Kunstvereinen) und<br />
- konkrete öffentliche Investitionen (z.B. im Rahmen des<br />
Projektes „Stadt macht Platz, <strong>NRW</strong> macht Plätze“).<br />
Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg<br />
Was eine Initiative letztendlich zu einer Erfolgsinitiative<br />
macht, wird wohl immer Gegenstand von Spekulationen<br />
bleiben. Allerdings gibt es im Falle der <strong>Landesinitiative</strong><br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> einige Zusammenhänge, die sich als<br />
ausgesprochen hilfreich herausgestellt haben.<br />
Erstens und vor allem hat die Initiative von Menschen gelebt,<br />
von ihnen gelernt und letztendlich ihre Prägung<br />
bekommen. Das betrifft vor allem die beiden Städtebauminister<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Staatsminister<br />
a.D. Dr.Michael Vesper und Herrn Minister Oliver Wittke,<br />
die die Initiative nachhaltig unterstützt und die sich dem<br />
Risiko des Missglückens des Projektes gestellt haben. Ohne<br />
die andauernde und solidarische Mitarbeit der Architektenkammer<br />
Nordrhein-Westfalen und der Ingenieurkammer-<br />
Bau Nordrhein-Westfalen wäre die Initiative nicht zustande<br />
gekommen; das betrifft insbesondere den einzigartigen Einsatz<br />
der beiden Kammerpräsidenten, Herrn Hartmut Miksch<br />
und Herrn Peter Dübbert, die sich die Ziele und die Unterstützung<br />
der Projekte persönlich zu Eigen gemacht haben.<br />
Mehrere Hochschullehrerinnen und -lehrer haben die Gremien<br />
und die Projekte der Initiative aktiv unterstützt. Zusätzlich<br />
hat die Initiative kontinuierlich Hilfe aus der Wirtschaft<br />
erhalten – so etwa durch die Vereinigung der Industrie- und<br />
Handelskammern, den Verband der Wohnungswirtschaft<br />
und die Bauwirtschaft. Schließlich gab es einen breiten Kreis<br />
von Personen, Unternehmen und Institutionen, die eigenständig<br />
Projekte initiiert, begleitet und dokumentiert haben.<br />
Zweitens hat es sich als elementar herausgestellt, bei allen Projekten und<br />
Vorhaben der Initiative eine strikte Umsetzungsorientierung einzufordern.<br />
Mit jeder Projektrealisierung wächst das Vertrauen in die Initiative; das gilt<br />
im besonderen Maße für Projekte mit starker Strukturorientierung.<br />
Zu den Erfolgsfaktoren der Initiative gehört drittens sicher auch deren<br />
„Kampagnencharakter“. <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> hat einen Beginn im Jahr<br />
2001 und wird zehn <strong>Jahre</strong> später enden. Das ist ein ausreichender, aber<br />
auch notwendiger Zeitraum, um dem Thema in Nordrhein-Westfalen den<br />
notwendigen Impuls zu geben.<br />
Die als Trägerstruktur und Diskussionsplattform gebildeten Gremien der<br />
Initiative (Kuratorium und Lenkungsgruppe) haben der Initiative ein Profil<br />
gegeben. Das gilt im selben Maße für das Europäische Haus der Stadtkultur,<br />
das ausgesprochen erfolgreich als Motor, Mittler und Moderator des<br />
Gesamtprojektes fungiert hat.<br />
Allen, wirklich allen, die in den Gremien, in den Projekten, in den Städten<br />
und Gemeinden, in den Kammern und Verbänden sowie in den Vereinen<br />
und Stiftungen mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle von Herzen gedankt.<br />
Und nun?<br />
Ungeachtet der zuweilen bewunderten, manchmal aber auch kritisierten<br />
thematischen Breite und Vielzahl der <strong>StadtBauKultur</strong>-Projekte bleibt auch in<br />
den kommenden <strong>Jahre</strong>n vieles zu tun. Der zentrale Anspruch, Baukultur im<br />
Land Nordrhein-Westfalen zu einem öffentlichen Thema zu machen, ist erst<br />
ansatzweise umgesetzt. Welche Projekte muss die Initiative angehen, um<br />
noch mehr für das Thema zu mobilisieren? Wie können die wirtschaftlich<br />
interessierten Gruppen, also die Bauwirtschaft, die Wohnungsunternehmen,<br />
die Projektentwickler, die Bausparkassen und die kleinen und großen Bauherren,<br />
besser in die Initiative integriert werden? Muss man sich mehr um die<br />
Spitze oder die Breite der Architekturdebatte kümmern? Und schließlich:<br />
Auf welchem Wege erhält man Anschluss an die internationale Diskussion um<br />
Baukultur? Es fehlt also weder an Fragen noch an produktiver Ungewissheit.<br />
Die vorliegende Veröffentlichung stellt die bisherigen Ergebnisse der Initiative<br />
zur Diskussion – immer mit der Perspektive der Kritik und der Weiterentwicklung,<br />
zu der alle Leser herzlich eingeladen sind.<br />
9
Gestalt geben<br />
11
Wilfried Wang<br />
Von der Pflege zur Wertschätzung<br />
Alle nehmen wir die natürliche wie die gebaute Umwelt als Selbstverständlichkeit<br />
an. So selbstverständlich ist die Annahme dieser Gegebenheiten,<br />
dass es nur gelegentlich dazu kommt, dass der eine oder andere sich<br />
Gedanken darüber macht, wie etwas vor unserer Zeit entstand, was andere<br />
vor uns leisteten und welche Eigenschaften oder Qualitäten einer Sache<br />
innewohnen.<br />
Man gewöhnt sich an die Natur wie man sich an die Baukultur gewöhnt.<br />
Sie sind Rahmen, Fassungen, Gefäße für unsere Handlungen und für unsere<br />
Bedürfnisse. Für all jene, die sich im Alltag nicht mit dem Bauen und Entwerfen<br />
befassen, verschwinden Natur und Baukultur im Hintergrund unserer<br />
Wahrnehmung. Natur und gebaute Umwelt sind selbstverständlicher<br />
Bestandteil des alltäglichen Lebens.<br />
Erst durch Reibungen, Schäden oder Verluste wird dem Gewohnheitsmenschen<br />
bewußt, dass etwas da ist oder da war. Reibungen an der vorhandenen<br />
Umwelt, Schäden an der Natur oder an Bauwerken, die allmählich auftreten,<br />
Verluste von kleineren und größeren Bestandteilen einer Umwelt<br />
weisen erst auf die notwendige Zuwendung hin, die die natürliche wie die<br />
gebaute Umwelt benötigt, damit sie weiter besteht.<br />
Die natürliche wie die gebaute Umwelt bedürfen unserer Pflege, denn von<br />
allein widerstehen sie nicht der alltäglichen Nutzung. Beide werden nur durch<br />
sorgsame und verständnisvolle Pflege bewusst zu einer Kulturlandschaft.<br />
Erst durch Pflege erwerben wir einen Begriff und ein Verständnis dieser<br />
Kulturlandschaft.<br />
Die angemessene Pflege setzt voraus, dass wir uns Kenntnisse über die gepflegten<br />
Bestandteile der Kulturlandschaft aneignen. Betrachten wir nun<br />
durch die Notwendigkeit der Pflege jedes Teil und dann das Ganze, wird uns<br />
erst bewußt, in welchen zeitlichen und räumlichen Beziehungen die Teile<br />
zueinander stehen, welche inhaltlichen und organischen Abhängigkeiten<br />
existieren. Auf Grund dieser Beziehungen und Abhängigkeiten erkennen wir<br />
die Eigenschaften und Qualitäten eines jeden Bestandteils der Kulturlandschaft.<br />
Durch unsere Pflege entwickeln wir eine Wertschätzung für die Kulturlandschaft,<br />
für die Baukultur im Allgemeinen wie für die Gestaltqualität im<br />
Einzelnen.<br />
12<br />
Zum Verhältnis von Baukultur und<br />
Gestaltqualität<br />
Baukultur<br />
Die Grundzüge der Natur, in der die baulichen Eingriffe eingebettet<br />
waren, konnten bis zum Industriezeitalter noch<br />
überall gut herausgelesen werden. Manche Bauten wurden<br />
bewusst mit der umgebenden Natur verbunden, mal durch<br />
Gartenanlagen, mal durch einfache Umfriedungen. Es entstanden<br />
so gestaltete Übergänge zwischen menschlichem<br />
Kunstwerk und Natur.<br />
Mit der systematischen Ausbeutung von Grund und Boden<br />
kehrte sich diese Beziehung um. Bis Anfang des 21. Jahrhunderts<br />
entstand eine intensiv von Menschen genutzte<br />
Kulturlandschaft, die im flacheren Terrain nur noch gelegentlich<br />
landschaftliche Ursprünge offenbarte. Dort, wo die<br />
Topographie markanter ist, sind die Grundzüge der Natur<br />
nach wie vor erkennbar.<br />
Verschiedene Siedlungen, von Dörfern über Kleinstädte bis<br />
zu den neuen Industrieagglomerationen, überzogen einst<br />
ganze Landstriche, nebeneinander, meistens ohne langfristige<br />
oder großatmige Gestaltung. Jede Siedlungsstruktur dokumentierte<br />
für sich eine typische Entstehungsgeschichte:<br />
mal der Ursprung im Ackerbau, mal feudale oder kirchliche<br />
Verwaltungen, mal das logistisch-technische Primat nebst<br />
Unterbringung der Belegschaft im Massenwohnungsbau.<br />
Letzteres Phänomen war besonders intensiv im Ruhrgebiet<br />
zu sehen.<br />
Im gesamten Nordrhein-Westfalen haben nur wenige einfache<br />
Bauten, Wohnhäuser, Industrieanlagen, Gemeinschaftseinrichtungen,<br />
kaum geschlossene Stadtteile geschweige<br />
denn Siedlungen den Zweiten Weltkrieg unbeschadet<br />
überlebt. Manche Altstadtteile, selbst jene außerhalb<br />
des Ruhrgebiets, wurden nach der Logik des Krieges bis zu<br />
90 Prozent durch die Bombardierung der Alliierten zerstört.<br />
Das Spektrum der Nachkriegsplanung für die großflächigen<br />
Schäden umfasst die vereinfachte Rekonstruktion von verloren<br />
gegangener Bausubstanz sowie die Inanspruchnahme<br />
„frei“ gewordener Bereiche für die autogerechte Stadt.
Durch die einheitliche Verkehrsinfrastruktur und deren<br />
Gestaltung sind sich viele Orte in ganz Deutschland ähnlich<br />
geworden. Trotzdem ist es immer noch möglich, mit Hilfe<br />
einiger Grundkenntnisse und in moderner archäologischer<br />
Erkundungsweise auf den Ursprung einer Siedlung zu<br />
stoßen.<br />
Seit der Industrialisierung vor einem Jahrhundert, der Zerstörung<br />
durch den Zweiten Weltkrieg vor sechzig <strong>Jahre</strong>n<br />
und der Nachkriegsplanung vor vierzig <strong>Jahre</strong>n hat die Baukultur<br />
in Deutschland drei grundlegende Veränderungen<br />
erfahren. Erst allmählich haben sich die Bewohner an die<br />
konvulsiven Veränderungen gewöhnt. Dass Verlusten aus<br />
diesen Veränderungen, ob persönlich erfahren oder über<br />
Vergleiche wie „vorher-nachher” vermittelt, auch mit kollektiver<br />
Trauer begegnet wird, ist nicht nur seit der Klage<br />
gegen die Unwirtlichkeit der Städte bekannt, sondern findet<br />
insbesondere seit Anfang des neuen Jahrhunderts in den<br />
Rufen nach Rekonstruktion von diesem oder jenem Gebäude<br />
seinen baukulturellen Niederschlag.<br />
Mit ihrer geschichtsabweisenden Grundhaltung hat die<br />
klassische Moderne seit dem Wirtschaftswunder durch ihre<br />
objektbezogene Gestaltung für weitere Brüche, Diskontinuitäten<br />
in der Kulturlandschaft gesorgt. Die Stadtlandschaft<br />
der Solitäre, der freistehenden Bauten umgeben von Abstandsgrün,<br />
durchzogen von standardisierten Straßen,<br />
Schnellstraßen und Stadtautobahnen, bestimmt das Weichbild<br />
der deutschen, der nordrhein-westfälischen Siedlungen.<br />
Jede Siedlung für sich, auch in ihrer heutigen modernistischen<br />
Ab- und Umwandlung, ist Beleg einer Baukultur,<br />
wobei Kultur als das räumlich-zeitliche Phänomen einer<br />
Lebensweise breit aufgefasst wird. Baukultur ist die Summe<br />
aller bestehenden Teile, seien sie freistehende Einzelbauten<br />
oder ganze zusammenhängende Siedlungsstrukturen. Wie<br />
jeder Bestand bedürfen auch sie der Pflege, sie sind, ohne<br />
jegliche qualitative Bewertung ihrer einzelnen gestalterischen<br />
Erscheinung, die Grundlage der heutigen Kulturlandschaft.<br />
Gestaltqualität<br />
Verspüren wir in Bezug auf die einen oder anderen Teile der uns umgebenden<br />
Baukultur Unbehagen, so kann dieses Gefühl durch die mangelnde<br />
Integrität gewisser Bereiche der Baukultur wie auch einzelner Objekte<br />
gespeist sein. Mangelnde Integrität wird zum Beispiel im städtebaulichen<br />
Kontext durch die beziehungslose Anhäufung von Solitären sichtbar.<br />
Gestaltqualität zeichnet sich durch den Einklang zwischen bewusster Intention,<br />
die einer Gestaltung innewohnen soll, und ihrer materiell-physischen<br />
Verwirklichung aus. Jedem Bauwerk liegt eine Intention zu Grunde, es<br />
erfüllt eine Absicht, es regelt gesellschaftliche und kulturelle Beziehungen.<br />
Ein Bauwerk tut dies durch seine materiell-physische Anwesenheit.<br />
Mit unseren Bauwerken, eigentlich mit jedem Werk, errichten wir so einzelne<br />
Teile eines gesamten Kulturraumes. Oder, wie Martin Heidegger es<br />
zusammengefasst hat: „Werksein heißt: eine Welt aufstellen.”<br />
(Heidegger 1960).<br />
Wir projizieren selbst durch das kleinste Werk unsere individuellen Vorstellungen<br />
jener Welt, in der dieses Werk sich eingliedert. Dagobert Frey,<br />
der Wiener Kunsthistoriker, hat diese Projektion eines sich eingliedernden<br />
Werks als Ausdruck eines vom Werkschaffenden bestimmten Realitätscharakters<br />
bezeichnet (Frey 1946).<br />
Jedes Werk fügt sich demnach einerseits in einen Kontext ein, es hat aber<br />
ebenfalls die Kraft, diesen Kontext, wie umfangreich auch immer, sowohl in<br />
seiner physischen Anwesenheit als auch in seiner inhaltlichen, ideellen<br />
Absicht zu verändern.<br />
Jedes Werk, auch jedes Bauwerk, nimmt Stellung zu aktuellen Bedingungen<br />
und schafft gleichzeitig die materielle Grundlage für eine Veränderung, wie<br />
umfangreich oder gering diese auch nach dem tatsächlichen physikalischen<br />
Ausmaß des Bauwerks sein mag und wie kraftvoll es den Benutzer oder<br />
Betrachter auch in dessen kultureller, geistiger Vorstellungskraft beeinflussen<br />
mag.<br />
Mit dem Einfügen in ein bestehendes Umfeld handelt der Werkschaffende<br />
vordergründig verantwortungsvoll gegenüber den materiellen wie kulturellen<br />
Wertevorstellungen.<br />
Über die Bedienung des materiellen und kulturellen Vordergrunds hinaus,<br />
drückt ein Werk aber noch etwas aus. Es stellt sich in eine Reihe von ähnlichen<br />
Werken des gleichen Typs und bildet so ein Glied in einem Diskurs<br />
über diese Werke und, noch grundsätzlicher, über das gemeinsame Wesen<br />
13
dieser Werke. Vorausgesetzt der Betrachter verfolgt diesen Diskurs, lässt<br />
sich das Werk so von jedem Betrachter diskursiv „lesen” und vergleichen.<br />
Wir können also, jeder von uns, die großen und kleinen Diskurse im Bauwesen<br />
verfolgen: sei es der Wettkampf der gotischen Kathedralen um Höhe<br />
und Zierlichkeit ihrer Teile oder jener Wettkampf der Hochhäuser unserer Zeit;<br />
sei es die Suche nach geeigneten Brückenkonstruktionen; seien es die zahlreichen<br />
Beispiele des modernen Wohnens im freistehenden Einfamilienhaus.<br />
Jeder Beitrag zu dem einen oder anderen Diskurs lässt sich also von jedem<br />
interessierten Betrachter lesen, vergleichen und dadurch auch bewerten.<br />
Die Gestaltqualität eines jeden Werkes erschließt sich also durch das vergleichende<br />
Betrachten von seinen Intentionen bis hin zu seiner materiellphysischen<br />
Erscheinung.<br />
Jedes Werk besteht aus einem oder mehreren Stoffen; jedes Bauwerk besteht<br />
aus Baumaterialien. Sie werden zu einer Form gefügt. Das Fügen der<br />
stofflichen Teile zu einer Gesamtgestalt kann so erfolgen, dass jede Fuge<br />
zwischen den Teilen erkennbar ist. In der Fuge erkennt der Betrachter die<br />
Fertigkeit, ja die Kunstfertigkeit des Werks.<br />
Jede Fuge, die erkennbar ist, kann den eingesetzten Materialien entsprechen.<br />
Man spricht dann von der materialgerechten Fuge. Nehmen wir das<br />
Gesamtgefüge der einzelnen Teile, der Stoffe, der Baumaterialien, so können<br />
wir insgesamt von der Werkgerechtheit sprechen, also nicht nur der gerechten<br />
Anwendung der Materialien und der Technik, sondern gesamtheitlich<br />
betrachtet, gegenüber der Gesamterscheinung des Werks.<br />
Werkgerechtheit können wir auch mit dem Grad der Angemessenheit aller<br />
eingesetzten Mittel, der physischen als auch der geistigen Mittel, in Verbindung<br />
bringen. Wenn ein Werk sich einem Betrachter erschließt, wenn es<br />
in seinen Teilen wie in seinem Ganzen einer Werkgerechtheit entspricht,<br />
erkennt der Betrachter eine Übereinstimmung zwischen der Fügung der<br />
Teile und der Gesamtgestalt.<br />
In der materiellen Gestaltung, im Gefüge der Teile, lässt sich also die innere<br />
Schlüssigkeit erkennen, wir können hier von der Logik der Formgestaltung<br />
sprechen, also von der dem Werk eigene Morphologie. Über diese innere<br />
Logik der Formgestaltung hinaus, die sich durchaus auch von Laien „lesen”<br />
lässt, besteht eine äußere Logik zum Sinn und Zweck des Werks.<br />
14<br />
Denn jedes Werk entsteht aus einem Grund. Es fügt sich in<br />
ein bestehendes Umfeld ein und stellt eine Antwort auf die<br />
materiellen wie kulturellen Wertevorstellungen dar. Jedes<br />
Werk dient einem Zweck. Dem einzelnen Bauwerk kann<br />
meistens dieser Zweck abgelesen werden. Wir verstehen<br />
den Grund seines Daseins.<br />
Zwischen dem Grund des Daseins eines Werks und seiner<br />
Absicht eine Welt aufzustellen, einen Realitätscharakter auszudrücken,<br />
kann ein Spannungsverhältnis bestehen wie<br />
beim Verhältnis zwischen dem Müssen und Wollen jeder<br />
menschlichen Tat. Alois Riegl sprach bekanntlich in diesem<br />
Bezug vom „Kunstwollen” (Riegl 1893/1985).<br />
In der Weise, in der dieses Spannungsverhältnis einer Werkgestaltung<br />
nun gelöst wird, dass weder das Müssen noch<br />
das Wollen ungleichgewichtig zum Vorschein treten, sondern<br />
in der diese Spannung in einen dritten Zustand zusammen<br />
geführt wird, der auch Unerwartetes beinhalten kann,<br />
wird eine eigenständige Synthese erlangt: Das ist die ablesbare,<br />
erkennbare, verständliche Qualität einer gebauten<br />
Synthese, nach der die Werkschaffenden streben.<br />
Sprechen wir einerseits von der Werkgerechtheit im morphologischen<br />
Sinn, so können wir andererseits von der<br />
Übereinstimmung, der Integrität zwischen dem Werk und<br />
dem Daseinsgrund sprechen. In dieser Übereinstimmung<br />
ruht was Heidegger als „Wahrheit” definiert hat: „Wahrheit<br />
bedeutet heute und seit langem die Übereinstimmung der<br />
Erkenntnis mit der Sache.” (Heidegger 1960).<br />
Gestaltqualität im Bauwerk umfasst also zunächst die innere<br />
Logik der Formgestaltung, dessen Bezug zum Daseinsgrund,<br />
und darüber hinaus dessen Lösung des Spannungsverhältnisses<br />
zwischen Müssen und Wollen, zwischen Funktionalität<br />
und ideellem-kulturellem Anspruch, zwischen Erkenntnis<br />
und Sache.<br />
Die Qualität eines Bauwerks offenbart sich jedem Betrachter,<br />
so dieser sich mit dem entsprechenden Diskurs auseinandergesetzt<br />
hat. Jeder so geübte Betrachter ist im Stande,<br />
den Grad der Wahrheit eines Bauwerks abzulesen.
Gestaltqualität der Baukultur<br />
Jeder Baugrund ist einmalig, aber nicht jeder Grund zum<br />
Bauen ist es ebenfalls. Die Integrität zwischen Ort und Werk<br />
muss gestaltet werden, sie entsteht nicht von selbst. Zwischen<br />
der Einmaligkeit des Baugrunds und der möglichen<br />
Beliebigkeit des Grunds zum Bauen besteht ein Spannungsverhältnis<br />
eines Müssens und Wollens. Erst eine von vielen<br />
geteilte Haltung zu diesem Spannungsverhältnis stellt die<br />
Grundlage einer breiten Baukultur her.<br />
Mit gesteigertem Interesse an der gebauten Umwelt, mit<br />
zunehmender Wertschätzung einzelner Bauten durch Anteilnahme<br />
an deren Pflege kann die Erscheinungsvielfalt der<br />
Baukultur breit gefächert sein, ohne dass es zu einem mangelnden<br />
Verständnis für diese Vielfalt käme.<br />
So wie jeder Baugrund einmalig ist, so dauert jedes Bauwerk<br />
seine Zeit. Neben finanziellen und bauphysiologischen<br />
Aspekten bestimmen der Grad einer öffentlichen Anteilnahme<br />
an einem symbolträchtigen Bauwerk wie die immanente<br />
Qualität einer denkmalwürdigen Gestaltung die Dauer des<br />
Bestehens eines Bauwerks.<br />
Die gebaute Umwelt setzt sich aus vielen Teilen zusammen,<br />
wobei manches Teil eine hohe Gestaltqualität aufweist, aber<br />
nicht jedes einzelne Teil einmalig sein muss oder auch einen<br />
Anspruch auf dauerhaften Bestand erhebt. Die Baukultur<br />
einer Region ist somit vielfältig, was Qualität, Einzigartigkeit<br />
und Bestandsdauer angeht. Jede Region besteht aus einer<br />
derartigen Baukultur; die Einzigartigkeit der einen oder<br />
anderen regionalen Baukultur hängt aber nicht alleinig von<br />
den einzelnen Bauten hoher Gestaltqualität ab, sondern<br />
vom Grad der Integrität der Teile zueinander wie auch zum<br />
Ganzen. Eine prägnante regionale Baukultur entsteht durch<br />
die übergeordnete Identität mit einem Ort, als Ausdruck<br />
einer von vielen geteilten Haltung zum Spannungsverhältnis<br />
zwischen Ort und Werk.<br />
Somit kann die gebaute Umwelt die bestimmende Grundlage<br />
einer unverwechselbaren Kulturlandschaft sein; sie<br />
ist es, die zur Identität eines Orts, einer Landschaft, einer<br />
Region beitragen kann.<br />
Baukultur wird allen vererbt, anonym verschenkt. Neben der<br />
Natur ist die Baukultur in ihrer Ganzheit von unermesslichem<br />
Wert. Pflegen wir sie, nehmen wir Anteil, erwerben wir<br />
Kenntnisse, überwinden wir so langfristig die dreifachen<br />
Verluste der letzten Jahrhunderte durch Erhalt und Zeugung<br />
bedeutender Bauwerke jedes Mal, wenn sich erneut die<br />
Chance dazu ergibt.<br />
Literatur<br />
Heidegger, M.: Der Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart 1960, S. 44<br />
Frey, D.: Der Realitätscharakter des Kunstwerks.<br />
in Kunstwissenschaftliche Grundfragen: Prolegomena zu einer Kunstphilosophie.<br />
Wien 1946, S. 107 ff.<br />
Riegl, A.: Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik.<br />
(Nachdruck der Ausgabe Berlin 1893) München 1985<br />
15
Frank Roost<br />
Der Einfluss virtueller Bilderwelten auf das architektonische und planerische<br />
Schaffen schien lange Zeit nur die in sich geschlossenen Unterhaltungseinrichtungen<br />
amerikanischer Provenienz wie Themenparks oder Urban Entertainment<br />
Center zu betreffen. Die zunehmende Ausrichtung der Innenstädte<br />
auf die Konsum- und Freizeitbedürfnisse suburbaner wie internationaler<br />
Besucher und das verstärkte Interesse an städtischen Räumen mit traditionellen<br />
urbanen Qualitäten führen jedoch dazu, dass auch die Gestaltungsstrategien<br />
für die Stadtzentren immer häufiger von Inszenierungen geprägt<br />
sind, die sich die kommerziell erfolgreichen, aber baukulturell umstrittenen<br />
Erfahrungen der Vergnügungsindustrie zunutze machen.<br />
Um nachzuvollziehen, wie sich im Zeitalter der multimedialen Kommunikation<br />
die Grenzen zwischen Unterhaltung und Hochkultur im Bauwesen auflösen,<br />
sind die Rahmenbedingungen dieses Prozesses mit zu betrachten.<br />
Im Folgenden werden deshalb zunächst die Zielgruppen der postmodernen<br />
Stadtproduktion benannt und ihre vermeintlichen Bedürfnisse, die zu der<br />
verstärkten Orientierung am Bildhaften in der Planung führen, skizziert.<br />
Auf dieser Grundlage kann dann analysiert werden, warum die Entertainmentkonzerne<br />
in den USA bei dieser Restrukturierung der Städte ihre Erfahrungen<br />
aus dem Bau von Themenparks gewinnbringend einsetzen können<br />
und inwiefern auch einige der wichtigsten Großprojekte, die in den letzten<br />
<strong>Jahre</strong>n in der Bundesrepublik realisiert wurden, von solchen Prinzipien<br />
geprägt sind.<br />
16<br />
Neue Bilderwelten und alte Mythen<br />
Images in der Stadtproduktion<br />
Die wachsende Bedeutung von Images<br />
Im Zuge des Strukturwandels von der Industriegesellschaft<br />
zu einer nachmodernen Dienstleistungsgesellschaft hat die<br />
ökonomische und soziale Bedeutung von Freizeit- und Einkaufsaktivitäten<br />
zugenommen und zu einer verstärkten Ausrichtung<br />
der Stadtproduktion auf die Bedürfnisse von Touristen<br />
und Konsumenten geführt. Zielgruppe der neuen<br />
Unterhaltungs- und Shoppingangebote sind sowohl Stadtbewohner<br />
und Suburbaniten, die das Zentrum für Kurzbesuche<br />
nutzen, als auch Touristen, die zumeist aus dem Inland,<br />
in größeren oder reizvollen älteren Städten, aber auch aus<br />
dem Ausland kommen. Neben den traditionellen Gruppenreisenden<br />
und Touristenfamilien gewinnen dabei auch<br />
intensiv konsumierende Jugendliche, hochmobile Bildungsbürger<br />
und aktiv bleibende Senioren immer mehr an Bedeutung.<br />
Als Rahmen für ihre Freizeitaktivitäten bevorzugen die<br />
Besucher ein Ambiente mit historischen Motiven, da an<br />
diesen Orten einerseits ihr kultureller Anspruch nach besonderen<br />
baulichen Qualitäten erfüllt wird und andererseits<br />
erwartungsgemäß ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten<br />
und Gelegenheiten zu sozialen Kontakten zur Verfügung<br />
steht.<br />
Im Rahmen dieser Entwicklung steigt auch die Zahl shopping-<br />
und unterhaltungsorientierter innerstädtischer Großvorhaben,<br />
die auf die Bedürfnisse von Konsumenten und<br />
Touristen zugeschnitten sind. Unabhängig von den konjunkturellen<br />
Schwankungen der Nachfrage im Freizeitsektor,<br />
beispielsweise dadurch, dass einzelne Angebote wie Musicaltheater<br />
nach einiger Zeit ihren Neuheitscharakter verlieren<br />
und nicht mehr mit der gleichen Aufmerksamkeit rechnen<br />
können, sind in diesem Bereich immer wieder neue Impulse
zu verzeichnen. So etablieren sich derzeit neben den traditionell<br />
für die Innenstadtentwicklung wichtigen Einzelhandels-<br />
und Unterhaltungskonzernen auch die Konsumgüterhersteller<br />
wie Sony oder Volkswagen als Anbieter von<br />
urbanem Entertainment und nutzen die Städte als<br />
Bühne, um ihre Produkte werbewirksam zu präsentieren.<br />
Dabei beschränken sie sich längst nicht mehr auf temporäre<br />
Maßnahmen wie Plakate oder Events, sondern investieren<br />
zunehmend in permanente, „Brand Lands“ genannte Einrichtungen,<br />
die als Bauten das Stadtbild mitprägen.<br />
Von dieser dreidimensionalen Form der Markenwerbung<br />
erhoffen sich die Konzerne eine Kundenloyalität, die langfristig<br />
zu Profiten führt, denn die Besucher sollen das positive<br />
Image des trendsetzenden touristischen Standortes auf<br />
die beworbene Marke übertragen und dann bei späteren<br />
Kaufentscheidungen die entsprechenden Produkte bevorzugen.<br />
Diese Form der imageorientierten Wertschöpfung wird<br />
im Zuge der Globalisierung immer wichtiger, weil die konkurrierenden<br />
Konsumgüterhersteller ihre Produktion zu denselben<br />
Zulieferern in Niedriglohnländern auslagern, so dass<br />
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten<br />
häufig nur noch im Design, in der Werbekampagne und im<br />
Markenimage bestehen. Durch die zunehmende telekommunikative<br />
Vernetzung erhalten solche mit massivem multimedialen<br />
Werbeaufwand durchgeführten Strategien noch<br />
einen weiteren Bedeutungszuwachs. Als Bindeglied zwischen<br />
globalisiertem Produktionsprozess, konsumorientierter<br />
Freizeitgestaltung und medial vermittelter Lebensstilinszenierung<br />
kommt der Imagekreation deshalb eine zentrale<br />
Funktion in der postindustriellen Gesellschaft zu, die sich<br />
mit den Brand Lands auch einen baulich-räumlichen Ausdruck<br />
verschafft.<br />
Doch nicht nur das Handeln der Unternehmen, sondern auch das der politischen<br />
Akteure ist von einer wachsenden Imageorientierung geprägt. Angesichts<br />
immer stärker eingeschränkter fiskalischer Handlungsspielräume,<br />
zunehmend heterogener Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen<br />
und der steigenden Bedeutung der Fremdenverkehrs- und Freizeitwirtschaft<br />
erscheinen der Lokalpolitik Projekte, die ein leicht wiedererkennbares Image<br />
produzieren, als eine der vielversprechendsten Möglichkeiten, Mehrheiten<br />
zu binden, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und wachstumsorientiert<br />
zu planen. Hinzu kommt die im Zuge von Deregulierung und Globalisierung<br />
drastisch verschärfte Standortkonkurrenz auf regionaler, nationaler und<br />
internationaler Ebene. Das daraus resultierende Ziel der Lokalpolitik, die<br />
Stadt als geeigneten Unternehmensstandort zu positionieren, beeinflusst<br />
das planerische Handeln auf der lokalen Ebene und führt dazu, dass die<br />
städtebaulichen Nutzungskonzepte und die architektonische Gestaltung auf<br />
die vermeintlichen Bedürfnisse von Investoren und neuen Dienstleistungseliten<br />
ausgerichtet werden.<br />
Angesichts dieser veränderten Rahmenbedingungen ist die nachmoderne<br />
Stadtproduktion, wie Harald Bodenschatz festgestellt hat, durch eine<br />
„Inszenierung von Innovation und Tradition“ geprägt, mit der gleichzeitig<br />
wachstumsorientierte Handlungsfähigkeit demonstriert, architektonische<br />
Sensationseffekte hervorgerufen und touristisch wie kommerziell erfolgreiche<br />
urbane Räume produziert werden sollen (Bodenschatz 2005). Solche<br />
den Lebensstilen der Beschäftigten in modernen Dienstleistungsbranchen,<br />
den kulturhungrigen Touristen und den konsumorientierten Kurzbesucher<br />
gleichermaßen entgegenkommende Strategien sind vor allem dann erfolgreich,<br />
wenn sie bereits bestehende Images und Mythen aufgreifen und sie<br />
in einer leicht wiedererkennbaren und kommerziell verwertbaren Form weiterentwickeln.<br />
Eine der wichtigsten Formen der urbanen Inszenierung sind<br />
deshalb Projekte, bei denen ältere Gebäude rekonstruiert oder Anspielungen<br />
auf historische urbane Situationen verwendet werden und bei denen<br />
diese Eigenschaft dann mittels multimedialer Kampagnen einem touristischen<br />
Massenpublikum vermittelt wird.<br />
17
Mediale Aufbereitung urbaner Mythen<br />
Die Bedeutung historischer Anknüpfungspunkte lässt sich gut am Beispiel<br />
des größten privatwirtschaftlichen Projekts der letzten <strong>Jahre</strong> in Berlin, dem<br />
Potsdamer Platz, verdeutlichen. Um dem Bauvorhaben eine besondere Aura<br />
zu verleihen, wurde von den Investoren die Legende vom einst verkehrsreichsten<br />
Ort Europas reanimiert, der Potsdamer Platz zum angeblichen<br />
Herz der Stadt erklärt und das Projekt zum vermeintlichen Gewinner eines<br />
in Wirklichkeit gar nicht existierenden Wettbewerbs um den Status als größte<br />
Baustelle des Landes ausgerufen. Obwohl weder der Umstand, dass der<br />
Platz in den 1920er <strong>Jahre</strong>n verkehrstechnisch ungenügend ausgestattet<br />
war, noch seine einstige Lage in Mauernähe und erst recht nicht die schiere<br />
Dimension des Projekts die Qualität eines Bauvorhabens garantieren können,<br />
wurden diese Eigenschaften zu den Kernaussagen einer jahrelangen<br />
multimedialen Werbekampagne. Denn diese Mythen wurden schon in der<br />
Bauphase in der Infobox einem Massenpublikum vermittelt und dabei die<br />
immer gleichen Fotos des Platzes aus den 1920er <strong>Jahre</strong>n, der großen Baustelle<br />
mit den Kränen und der beteiligten internationalen Architekten solange<br />
präsentiert, dass sie heute zum Bildungskanon der meisten Berliner und<br />
Besucher gehören.<br />
Das tatsächlich realisierte Bauprogramm steht aber in krassem Gegensatz<br />
zur ursprünglichen Idee, am Potsdamer Platz ein Gebiet mit traditionellen<br />
urbanen Qualitäten zu schaffen. Denn obwohl, um vermeintliche Charakteristika<br />
der europäischen Stadt widerzuspiegeln, den Vorschlägen der Masterplaner<br />
Hillmer und Sattler entsprechend auf allzu hohe Türme verzichtet<br />
und stattdessen in blockartigen Strukturen gebaut werden sollte, gelang es<br />
nicht, ein vielfältiges Stadtquartier mit einer kleinteiligen Struktur zu schaffen.<br />
Stattdessen entstand mit dem Sony Center ein Brand Land japanischer<br />
Herkunft und mit dem Quartier DaimlerChrysler ein Entertainment-, Ein-<br />
18<br />
kaufs- und Bürokomplex amerikanischen Typs, der dann mit<br />
städtebaulichen Reminiszenzen an traditionelle europäische<br />
Städte umrahmt wurde. So fungiert die baumbestandene<br />
alte Potsdamer Straße als ein Pseudo-Boulevard, der nach<br />
wenigen hundert Metern endet. An seinem nördlichen Ende<br />
wird mit der Rekonstruktion einer historischen Verkehrsampel<br />
auf die 1920er <strong>Jahre</strong> Bezug genommen. Am Südende<br />
dagegen wurde – als Hommage an dieselbe Epoche – die<br />
Schlichtvariante eines Stadtplatzes nach Marlene Dietrich<br />
benannt. Dort sind auch zwischen den Bürobauten schmale<br />
Treppen angelegt worden. Zwar führen sie nur in Sackgassen,<br />
in denen sich die Müllcontainer befinden, beim touristischen<br />
Betrachter sollen sie aber diffuse Erinnerungen an die<br />
Gassen mediterraner Orte wecken.<br />
Mit dieser Collage von klassischen städtischen Motiven soll<br />
dem Potsdamer Platz ein einzigartiges Metropolen-Image<br />
gegeben werden, obwohl die vorhandenen Nutzungen wie<br />
McDonald’s oder Cinemaxx kaum als besondere Attraktion<br />
gelten können, die es nicht auch in den Städten gäbe, aus<br />
denen die Besucher kommen. Auch wenn die Gestaltung<br />
also keine wirkliche urbane Vielfalt generiert, trägt sie aber<br />
dazu bei, ein Image zu schaffen, mit dem der Ort als touristische<br />
Destination erfolgreich beworben werden kann. So<br />
wird das von den Nutzungen her durchschnittliche kommerzielle<br />
Viertel bei Touristen als angebliche Metropole und<br />
als Wiederauferstehung traditioneller urbaner Qualitäten<br />
vermarktet, ohne dass diese in DaimlerChryslers und Sonys<br />
Brand Lands wirklich zu finden sind.
Theming als Legitimationsstrategie<br />
Multimedial kommunizierte urbane Mythen und die Verwendung<br />
historisierender Zitate dienen aber nicht nur als<br />
Vermarktungsinstrument, sondern können, wie das Beispiel<br />
des Times Square zeigt, auch als Legitimationsstrategie für<br />
Stadterneuerungsprojekte eingesetzt werden. Federführend<br />
bei der Renaissance des einst als kriminell verschrienen<br />
New Yorker Vergnügungsviertels war die Walt Disney<br />
Company, und das familienfreundliche Image des Konzerns<br />
diente dabei als Leitstern und Schutzschild der Touristen<br />
und Vorortbewohner, die das Quartier vorher lange Zeit<br />
gemieden hatten. Angesichts öffentlicher Kritik an einer<br />
möglichen kulturellen Homogenisierung versuchte der<br />
Disney-Konzern seine Version des Times Square in der<br />
Öffentlichkeit als die bestmögliche Lösung zu präsentieren,<br />
und dabei spielte die Architektur eine herausragende Rolle.<br />
Denn die neuen Entertainmenteinrichtungen sind nach<br />
Gestaltungsprinzipien entworfen worden, die auf das Aussehen<br />
des Vergnügungsviertels in der ersten Hälfte des<br />
20. Jahrhunderts Bezug nehmen. Der beauftragte Robert<br />
A.M. Stern, Architekt und Mitglied des Disney-Aufsichtsrats,<br />
hatte bei seinen Umbauvorschlägen von Anfang an betont,<br />
dass die äußerlichen Merkmale, die den Times Square seit<br />
Beginn des Jahrhunderts auszeichneten, wie die Werbetafeln und das<br />
Nebeneinander hoher und niedriger Gebäude, durch das Projekt noch<br />
stärker als bisher zum Tragen kommen sollten. Mit diesem Konzept erreichte<br />
der Architekt, dass der heutige Times Square nach seiner Neubebauung<br />
zwar eine aus Disneyland bekannte Form von Entertainment und Sicherheit<br />
bietet, gleichzeitig aber durch die gestalterische Bezugnahme auf die Vergangenheit<br />
des Ortes dem Betrachter ein Gefühl von großstädtischer Vielfalt<br />
vermittelt.<br />
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Disney-Konzern eine solche Herangehensweise<br />
liefert, denn es ist eben diese Kombination aus Abwechslung<br />
und Wiedererkennbarkeit, die schon den Disney-Themenparks zugrunde<br />
liegt. Wie Sharon Zukin dargestellt hat, ist Disneyland vor allem eine dreidimensionale<br />
Collage von Motiven wie dem Wilden Westen, dem europäischen<br />
kulturellen Hintergrund oder der Kleinstadt der Ostküste, die für das<br />
kollektive Gedächtnis der weißen Mittelschicht konstituierend sind (Zukin<br />
1995). Die Fähigkeit, solche Elemente in eine leicht wiedererkennbare und<br />
konsumierbare Form zu bringen, war die Basis für Disneys Aufstieg zum<br />
Weltkonzern – und eben diese Gestaltungsmethode wird nun auch im<br />
Stadtplanungsbereich angewendet. Dabei wird die Geschichte eines Ortes<br />
auf einen Mythos reduziert und dann als Bild reproduziert, um ein neues<br />
Projekt zu legitimieren, das vor allem der touristischen Attraktivität und<br />
damit dem Unterhaltungskonzern selbst dient.<br />
19
20<br />
Multimediales Marketing<br />
Da die Walt Disney Company mittlerweile aber nicht nur der<br />
erfolgreichste Vergnügungsparkbetreiber, sondern auch<br />
der zweitgrößte Medienkonzern der Welt ist, zu dem auch<br />
zahlreiche Fernsehsender und Hollywood-Studios gehören,<br />
nutzt er seinen medialen Einfluss auch dafür, seinen Stadtplanungsprojekten<br />
von Anfang an größtmögliche Aufmerksamkeit<br />
zu sichern. So werden zahlreiche TV-Sendungen<br />
des zum Konzern gehörenden Fernsehkanals ABC in einem<br />
neuen gläsernen Studio am Broadway produziert, in dem<br />
der Times Square ständig als Hintergrund zu sehen ist.<br />
Auf diese Art und Weise kann der Ort in den Köpfen der<br />
Zuschauer wieder als potentielles Kurzurlaubsziel verankert<br />
werden. Außerdem brachte eine andere Disney-Tochterfirma<br />
zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Entertainmenteinrichtungen<br />
den Kinofilm „Jungle to Jungle“ heraus, der wie<br />
eine Werbung für einen Familienausflug nach New York<br />
wirkt und in den Szenen integriert wurden, mit denen ein<br />
Aufenthalt am Times Square nahe gelegt wurde. Darüber<br />
hinaus baute Disney sogar in dem zur selben Zeit auf den<br />
Markt gebrachten Zeichentrickfilm „Hercules“ einige Szenen<br />
ein, mit denen das Times-Square-Projekt beschrieben wurde<br />
(Roost 2005). Wenn diese in den Filmen versteckten Hinweise<br />
auch nur bei einem Bruchteil der Millionen von<br />
Zuschauern ihre Wirkung entfalten, wird es sich für den<br />
Konzern bereits günstig auf die Besucherzahlen seiner Entertainmentcenter<br />
am Times Square auswirken.<br />
Der von John Urry beschriebene, dem touristischen Blick<br />
zugrunde liegende hermeneutische Kreis, demzufolge ein<br />
Reisender zu Hause Bilder einer Sehenswürdigkeit wahrnimmt,<br />
sie sich merkt und dann dorthin reist, nur um von<br />
eben dieser Sehenswürdigkeit ein genau gleiches Foto zu<br />
machen und so seine Anwesenheit vor Ort zu dokumentieren<br />
(Urry 1990), wird damit am Times Square von Disney vollkommen<br />
beherrscht. Denn in diesem Falle werden die Vorstellungen<br />
darüber, wie die Stadt aussehen soll, von Disney<br />
beeinflusst und zu Wunschbildern verarbeitet, die dann in<br />
den Stadtplanungsprojekten des Konzerns ihre Erfüllung<br />
finden. Mit seiner Methode, die hauseigenen Medien zu<br />
nutzen, um Besucher an den Times Square zu locken, sind<br />
Disneys Projekte das wohl deutlichste Beispiel dafür, wie<br />
groß der Einfluss der virtuellen Bilderwelten auf den urbanen<br />
Tourismus und damit auch auf Architektur und Stadtplanung<br />
bereits ist.
Die Vielgestaltigkeit der thematisierten Stadt<br />
Der Einfluss der medialen Kommunikation bleibt aber nicht<br />
auf Projekte mit historisierender Architektur beschränkt.<br />
Da für viele Konzerne mittlerweile die Publikumswirksamkeit<br />
des Corporate Image das eigentlich gewinnbringende Produkt,<br />
die Hardware dagegen nur noch sekundär ist, drückt<br />
sich der aus der Mediatisierung der Gesellschaft resultierende<br />
Wandel der ökonomischen Wertschöpfung nicht nur im<br />
Scheinhaften der postmodernen Fassadenproduktion der<br />
Disney-Architektur von Michael Graves oder Robert A.M.<br />
Stern aus, sondern auch in anderen gestalterischen Versuchen,<br />
Aufmerksamkeit zu erhaschen. Wie Georg Franck<br />
argumentiert, lässt sich deshalb die Verschmelzung von<br />
ernsthaften und unterhaltenden Elementen in der Baukultur<br />
im Zeitalter der multimedialen Kommunikation in gewisser<br />
Weise auch bei den Meistern der Selbstdarstellung wie<br />
Daniel Libeskind oder Peter Eisenman erkennen, denn deren<br />
Dekonstruktivismus distanziert sich zwar vom Kitsch der<br />
Unterhaltungsindustrie, unterscheidet sich aber bezüglich<br />
des Grades der multimedialen Inszenierung kaum von diesem<br />
(Franck 2001).<br />
Literatur<br />
Bodenschatz, H.: Renaissance der Mitte.<br />
Zentrumsumbau in London und Berlin. Berlin 2005<br />
Franck, G.: „Medienästhetik und Unterhaltungsarchitektur“.<br />
in Bittner, R. (Hg.): Urbane Paradiese – zur Kulturgeschichte modernen<br />
Vergnügens. Frankfurt / New York 2001<br />
Roost, F.: „Synergy City – How Times Square and Celebration are<br />
Integrated into Disney’s Marketing Cycle”.<br />
in Budd, M. (Hg.): Rethinking Disney – Private Control and Public Dimensions.<br />
Middletown, CT 2005<br />
Urry, J.: The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies.<br />
London 1990<br />
Zukin, S.: Landscapes of Power: From Detroit to Disney World.<br />
Berkeley, CA 1991<br />
So betrachtet lassen sich die meisten der durch die Inszenierung von Tradition<br />
und Innovation charakterisierten Großprojekte von Berlin über Wolfsburg<br />
bis Bilbao als Produkte einer multimedial kommunizierten Vermarktungsstrategie<br />
begreifen, denn solche unter dem Begriff des „Flagship<br />
Planning“ diskutierten Bauvorhaben erfüllen vor allem den Zweck, Beachtung<br />
zu erzeugen und damit dem Projekt selbst ebenso wie der Stadt Aufmerksamkeit,<br />
ein positives Image und letztlich möglichst viele Besucher zu<br />
verschaffen. Insofern ist der Einfluss der medialen Kommunikation auf das<br />
architektonische und planerische Schaffen unabhängig von der Stilrichtung,<br />
er lässt sich bei den historisierenden Projekten nur besonders deutlich erkennen.<br />
Die weitere Diskussion über die Bedeutung der virtuellen Bilderwelten<br />
für die Baukultur sollte deshalb auch nicht bei Stilfragen verharren, sondern<br />
vor allem die Prozesse der Mythenbildung nachvollziehen und analysieren,<br />
inwiefern die Bildhaftigkeit mit dem Einfluss medialer Macht verbunden ist<br />
und für die Legitimation von umstrittenen stadtstrukturellen Maßnahmen<br />
eingesetzt werden kann.<br />
21
Frauke Burgdorff<br />
Es gibt keine eindeutigen Regeln, keinen handhabbaren Kriterienkatalog für<br />
gute Architektur. Vor allem der Stil von Gebäuden entwickelt sich – wie in<br />
den vorangegangenen Artikeln deutlich wurde – über die Generationen hinweg<br />
aus regionalen und internationalen Vorbildern, aus dem Anspruch, das<br />
Außergewöhnliche zu markieren und dem Alltäglichen etwas Besonderes zu<br />
geben.<br />
Und doch hat sich die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> der Verbesserung der<br />
Gestalt unserer gebauten Umwelt angenommen. Denn ihre Erscheinungsform<br />
trägt ganz wesentlich dazu bei, wie sich die Bewohner einer Stadt<br />
oder einer Region mit ihrem Ort identifizieren, wie intensiv ihre Beschäftigung<br />
mit ihrer Stadt und deren Veränderungen ist und wie verantwortungsvoll<br />
sie mit den Räumen, die sie alltäglich nutzen, umgehen.<br />
Dabei ging es vor allem darum, die so genannte „Gebrauchsarchitektur“<br />
ins Zentrum zu rücken und hier Vorbilder für hervorragende Umsetzungen<br />
zu sammeln und zu präsentieren. Denn der alltägliche Nutzen von guter<br />
Gestaltung wird dort offensichtlich, wo das Betreten von Gebäuden ganz<br />
selbstverständlich zu einem qualitätvollen Erlebnis wird, wo Gebäude und<br />
Orte nicht „verbraucht“ sondern „gebraucht“ werden und wo sie mit ihrer<br />
eigenen Erscheinungsform einen wichtigen Beitrag zur Ergänzung des<br />
Stadtbildes leisten.<br />
Da es nicht Aufgabe der Initiative ist, neue Gebäude zu errichten, sondern<br />
Kommunikation für eine Verbesserung der Baukultur in Nordrhein-Westfalen<br />
zu initiieren und zu unterstützen, hat sie die bereits gebauten Vorbilder<br />
für herausragendes Bauen thematisch und in einzelnen Projekten strukturiert<br />
präsentiert.<br />
22<br />
Gestalt geben<br />
Die Auseinandersetzung mit dem Aufgabenfeld der Handelsbauten<br />
wurde mit der Publikation „Shopping Center<br />
Stadt“ in der „Blauen Reihe <strong>StadtBauKultur</strong>“ gestartet. Ein<br />
wichtiges Ergebnis war, dass ökonomischer Nutzen und<br />
gestalterischer Anspruch im Kundengeschäft kein Widerspruch<br />
sein dürfen, damit der Handel ein lebendiger Bestandteil<br />
des städtischen Lebens bleibt. Auch die überraschend<br />
zahlreichen und qualitätvollen Einreichungen zum<br />
„Preis für vorbildliche Handelsarchitektur“ zeigten, dass<br />
dieses Feld in Zukunft mehr Aufmerksamkeit verdient, weil<br />
gerade die Bauten des Handels maßgeblich für innerstädtische<br />
architektonische Qualitäten verantwortlich sind.<br />
In ganz anderem Maße zentral für die Gestalt unserer Städte<br />
und die alltägliche Einbindung von qualitätsvoller Architektur<br />
ist der Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. Denn<br />
dort wo Peripherien zentrale Funktionen übernehmen und<br />
die Zentren drohen, in die Peripherie zu rücken, sind hochwertige<br />
Wohnungen und Wohnumfelder in allen Preissegmenten<br />
ganz entscheidende Erfolgsträger für die Standort-
estimmung einer Stadt in der internationalen Konkurrenz.<br />
Der „Innovationspreis Wohnungsbau“ hat ganz in diesem<br />
Sinne herausragende Entwürfe zukunftsfähiger und innenstadtnaher<br />
Wohnstandorte prämiert, die ein wichtiger Teil<br />
der ökonomischen Entwicklung des jeweiligen Gesamtstandortes<br />
sein werden.<br />
Neben Handel und Wohnen spielt das Gewerbe eine immer<br />
größere Rolle bei der Diskussion um die Gestaltung unserer<br />
Städte. Nicht selten klagen wir über die Gesichtslosigkeit<br />
der suburbanen Gebiete, die kaum Verbindungen zur Stadt<br />
ermöglichen und urbanes Leben zulassen. Mit dem Forschungsprojekt<br />
„Orte der Arbeit“ ist die Initiative StadtBau-<br />
Kultur <strong>NRW</strong> den zugrunde liegenden Mechanismen und den<br />
zukünftigen Spielräumen bei der Gestaltung von Gewerbegebieten<br />
näher gekommen. Eine wichtige Grundlage für die<br />
Verbesserung dieser baukulturell zumeist interessenlosen<br />
Nutzung ist geschaffen.<br />
Nur scheinbar im Widerspruch dazu steht die Präsentation<br />
der Ausstellung „DEUTSCHLANDSCHAFT“ in Nordrhein-<br />
Westfalen. Denn hier wurden nicht die umsatzträchtigen<br />
architektonischen Lösungen präsentiert, sondern die kleinen<br />
Eingriffe, die insbesondere in der Peripherie oder in den<br />
undefinierten Zwischenräumen unserer Städte für ein qualitätvolleres<br />
Bild sorgen können.<br />
Die „1.000 Baulücken <strong>NRW</strong>“ haben sich mit kleinen Eingriffen,<br />
dem inneren Umbau und der Pflege unserer Städte<br />
beschäftigt. Die in einem breit angelegten Bürgerwettbewerb<br />
zusammengetragenen Vorschläge für den Umgang<br />
mit den zahlreichen, kleinen und großen, nicht genutzten<br />
Zwischenräumen hat gezeigt, dass die Bewohner durchaus<br />
die baukulturellen Missstände vor Ort wahrnehmen und<br />
dass sie in der Lage sind, gleichermaßen qualitätvolle und<br />
humorvolle, dauerhafte und temporäre Lösungen für die<br />
innere urbane Weiterentwicklung vorzuschlagen.<br />
Bauen auf Zeit hat angesichts der großen gestalterischen Herausforderungen<br />
und angesichts der Schnelllebigkeit von Stilen und Formen einen besonderen<br />
Reiz. Es kann Lösungen vordenken, oder aber das Gewohnte durch<br />
neue Bilder bereichern. Dass nicht jede baukulturelle Lösung auf Dauer<br />
angelegt sein muss, wurde im Projekt „Temporäre Architektur an besonderen<br />
Orten“ erprobt. Die studentische Intervention auf dem Gustaf-Gründgens-Platz<br />
in Düsseldorf hat eindrucksvoll deutlich gemacht, wie Entwurfsqualität<br />
und partizipatorischer Anspruch auf kreative Weise miteinander<br />
verbunden werden können.<br />
Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> verbindet ihre Suche nach „Gestalt gebenden“<br />
Vorbildern natürlich auch mit dem Blick nach oben und in Richtung<br />
der großen Entwürfe, die die Trends der Zukunft formulieren. Dazu<br />
gehören insbesondere die immer wieder sehnsuchtsvoll betrachteten Hochhäuser.<br />
Der „Traum vom Turm“ hat aber neben der äußeren Erscheinung<br />
einen baukulturellen Kern, der von Ingenieuren geschaffen wird und häufig<br />
verborgen bleibt. Die Ausstellung widmete sich genau diesem Kern, den<br />
technischen Möglichkeiten und der aus Druck und Zug entstehenden Eleganz<br />
eines architektonischen Erscheinungsbildes.<br />
Und schließlich mischt sich die Initiative auch in aktuelle „Gestalt findende“<br />
Prozesse ein. Dies ist besonderes intensiv bei der Formulierung der baukulturellen<br />
Projekte im Rahmen der Bewerbung „Kulturhauptstadt 2010 –<br />
Essen für das Ruhrgebiet“ geschehen. Unterschiedlichste Projektbeteiligte,<br />
auch und vor allem solche, die scheinbar wenig an der Entwicklung von<br />
Baukultur teilhaben, haben in zwei Werkstätten grundlegende Standards<br />
und neue Ideen für die architektonische und planerische Umsetzung des<br />
Kulturhauptstadtgedankens im Ruhrgebiet erarbeitet.<br />
23
Francesca Ferguson<br />
24<br />
Deutschlandschaft<br />
Epizentren der Peripherie
Das Deutschlandschaftpanorama fand in gewisser Hinsicht<br />
bei seiner Heimkehr nach Deutschland in Nordrhein-Westfalen<br />
genau den richtigen Kontext. Als hybrider Rundblick<br />
auf eine sehr heterogene Auswahl architektonischer Projekte<br />
der letzten vier <strong>Jahre</strong> in Deutschland verschiebt diese<br />
Neuinterpretation des Panoramas bewusst den Brennpunkt<br />
auf Stadtrandlandschaften der Gegenwart: die konturlosen<br />
und ästhetisch ambivalenten Gegenden jenseits der Stadtgrenzen,<br />
die von Wohnsiedlungen durchzogenen Ballungsräume<br />
aus Lagerhallen, Einkaufszentren und Gewerbehöfen.<br />
Nach letzten Schätzungen befinden sich neben den zahlreichen<br />
ehemaligen Industrieflächen in Nordrhein-Westfalen<br />
60.000 Hektar Brachflächen, 10.000 Hektar Militärflächen<br />
und 900.000 m 2 in Shopping Malls. Ein passender Ort also<br />
für den peripheren Blick.<br />
Die anhaltende Ausuferung der Städte sowie deren zu oft<br />
unbeachteten inneren Peripherien manifestieren sich in der<br />
Ausstellung als zeitgenössischer Blick – eine Wiederkehr des<br />
dirty realism.<br />
Durch die Kombination aus diesem eher profanen Blick und<br />
der Verwendung eines klassischen, aus der Romantik gewohnten<br />
Mediums wurde ein Wechselspiel zwischen Realität<br />
und Fiktion, zwischen dem „Heimeligen” und dem Unheimlichen<br />
in der Deutschlandschaft möglich. Eine Anspielung<br />
auf das Gewohnte und Gewöhnliche und eine Zusammenführung<br />
transformativer Architekturprojekte erzeugten bei<br />
den Betrachtern des Panoramas genau die Ambivalenz und<br />
das Unbehagen, mit denen man die städtische Peripherie<br />
wahrnimmt. Mimo’s Dönerladen, Schrebergärten und sichtbar<br />
schlecht gebaute Eigenheime wurden teils mit einem<br />
Schmunzeln, teils als Irritation neben den neuen Architekturen<br />
mit entdeckt.<br />
Die zahlreichen Interviews mit den beteiligten Architekten<br />
ergaben für mich eine beeindruckende Haltung zu diesem<br />
wuchernden Terrain – nicht ohne eine gewisse Ironie hatte<br />
ich den Untertitel „Epizentren der Peripherie” verfasst, denn<br />
es ist einer Generation von Architekten und Planern in<br />
Deutschland sehr bewusst, dass man lediglich einen sehr<br />
begrenzten Einfluss auf diese Ballungsräume ausüben kann.<br />
Fertighaus-Produzenten, die Aldi/WalMart-Giganten der Konsumgesellschaft<br />
und Gewerbesteuern bestimmen viel eher<br />
die surrealen Nebeneinanderstellungen dieser Randgebiete.<br />
Um Transformationen im vor- und randstädtischen Umfeld vorzunehmen,<br />
muss man andere Sehgewohnheiten entwickeln. Julia Bolles Wilson brachte<br />
das Potenzial einer Wahrnehmungsverschiebung auf den Punkt: „Die Peripherie<br />
stellt ein zeitgenössisches Gefühl dar, in dem wir uns wohl fühlen;<br />
seine inhärenten Qualitäten bedeuten eine Art Freiheit. Es ist ein unhierarchisches<br />
Feld, in dem wir uns bewegen können, und bietet eine Anonymität,<br />
die Städte nicht mehr bieten können.”<br />
Eine Mischung aus Pragmatismus und Ironie, eine Bescheidenheit im Maßstab<br />
der in der Deutschlandschaft eingebetteten Projekte haben wir als<br />
„Architektur in homöopathischer Dosis” bezeichnet. Kulturelle Parameter<br />
und Bauvorschriften werden neu ausgelegt, Paradigmen verschoben.<br />
Architektur auf den zweiten Blick<br />
Als Fotocollage spielt das Panorama mit allen Möglichkeiten einer fotografischen<br />
Darstellung von gebauter Architektur. Wichtig war dennoch, die ausgewählten<br />
Projekte soweit wie möglich mit ihrer realen Umgebung in die<br />
Deutschlandschaft einzubetten, um die sehr präzisen Anspielungen auf den<br />
bestehenden Kontext und die gewohnten Bauformen deutlich zu machen.<br />
Statt die neuen Architekturansätze als ikonenhafte Solitäre auszustellen,<br />
wird für die Ausstellung die Fotografie als eine Art reality check und die<br />
Collage selbst als Aussage über das eher bezugslose Nebeneinander am<br />
Rande des Urbanen.<br />
Die teils subtilen, teils polemischen Umnutzungen und Umkehrungen gewohnter<br />
Baunormen und Materialien stechen aus dem Deutschlandschaftsbild<br />
hervor – verleugnen und verschönern jedoch nicht die Realitäten ihres<br />
Umfelds.<br />
Bei der Vielfalt der Themen und Ansätze, die in der Ausstellung unterzubringen<br />
waren, stellte sich in der Konzeptionsphase heraus, dass man mit einer<br />
scheinbar nahtlosen Fotocollage eine fast heile Welt präsentieren würde,<br />
eine täuschende Homogenität. Der Bruch in der Wahrnehmung – das<br />
eigentliche Ziel der Ausstellung – und das Fokussieren auf eine andere Art<br />
von Stadt erforderten einen Bruch im Panorama selbst. Somit bauten wir<br />
hinter dem Panorama eine zweite, disruptive Schicht, die als „Quellcode”<br />
in die Gestaltung eingreift: Auszüge aus dem Baugesetz sowie Hinweise<br />
auf die Pendlerpauschale und Eigenheimzulage weisen in beleuchteten Einblicken<br />
auf die oft restriktiven Bedingungen hin, mit denen jeder Architekt<br />
und Städteplaner in Deutschland konfrontiert wird.<br />
Letztendlich soll die Ausstellung zu weiteren Dialogen führen und die Wanderschaft<br />
entlang dieses etwas anderen Deutschlandbildes spielerisch-ambivalent<br />
bleiben. Die fragmentarischen Zitate aus Gesprächen und Interviews<br />
an der Sitzlandschaft deuten auf eine Auseinandersetzung mit der Peripherie,<br />
die noch lange nicht vollendet ist.<br />
25
Hartmut Miksch<br />
Sie sind allgegenwärtig und doch nimmt man sie kaum wahr: Baulücken<br />
gibt es in jeder Großstadt und in vielen kleineren Kommunen Nordrhein-<br />
Westfalens und doch führen sie ein Schattendasein. Überall in Nordrhein-<br />
Westfalen findet man Grundstücke in zentraler Lage, die – oft seit dem<br />
Zweiten Weltkrieg - ungenutzt brachliegen und nicht nur ein verschenktes<br />
Nutzungspotenzial darstellen, sondern auch die Attraktivität unserer Städte<br />
massiv beeinträchtigen. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hat<br />
deshalb im Rahmen der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> das Projekt<br />
„1000 Baulücken in <strong>NRW</strong>” gestartet.<br />
Erstes Ziel des Projektes ist es, die zahlreichen Lücken in unseren Städten<br />
in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dazu hat die Architektenkammer –<br />
unter aktiver Mithilfe interessierter Bürgerinnen und Bürger – zunächst<br />
in einer Internet-Bild-Datenbank weit über 1000 Baulücken in Nordrhein-<br />
Westfalen dokumentiert. Die Botschaft dieses Bilderreigens ist eindeutig:<br />
Baulücken sind Störungen im Stadtbild. Und: Jede Baulücke stellt ein städtebauliches<br />
Potenzial dar, das nicht oder nicht vollständig ausgeschöpft wird.<br />
Dabei erlebt das Leben in der Stadt gegenwärtig eine Renaissance: Nach<br />
<strong>Jahre</strong>n der immer größer werdenen Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort<br />
– jeder zweite Nordrhein-Westfale pendelt heute zwischen Wohnung<br />
und Arbeitsstätte über die Stadtgrenze hinaus – ist in den letzten <strong>Jahre</strong>n<br />
eine verstärkte Rück-Orientierung auf urbane Zentren und ihren räumlichen<br />
Mix aus Wohn- und Arbeitsquartieren festzustellen. Die Kommunen stehen<br />
also vor der Herausforderung, künftig mehr attraktiven und citynahen<br />
Wohnraum und neue, zentrale Orte für Arbeit und Handel bereitzustellen.<br />
Die Flächen dazu sind vorhanden: Zum einen sind es die großen Konversionsflächen<br />
der abgewanderten Industrie bzw. der Bahn und Post, die – oft<br />
in zentraler Lage – für neue Nutzungen erschlossen werden können. Aber<br />
gerade auch die zumeist kleineren Baulücken stellen ein Potenzial dar, das<br />
es zu nutzen gilt. Es handelt sich in der Regel um voll erschlossene Grundstücke<br />
in funktionsfähigen Stadtquartieren, auf denen zum Beispiel attraktive<br />
Wohnungen in bester Lage oder Gastronomie- oder Einzelhandelseinrichtungen<br />
geschaffen werden können.<br />
26<br />
1000 Baulücken in <strong>NRW</strong><br />
Um überzeugende Beispiele für die Nutzung von Baulücken<br />
vorstellen zu können, hat die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen<br />
im Jahr 2003 einen offenen Ideenwettbewerb<br />
zur künftigen Nutzung dieser Potenziale in fünf ausgewählten<br />
Großstädten des Landes ausgelobt. Zur Teilnahme<br />
aufgerufen waren alle Bürgerinnen und Bürger, Architekten<br />
und Planer, Schüler und Studenten, Investoren und Interessierte.<br />
Die Ergebnisse der Wettbewerbe in Aachen, Köln, Duisburg,<br />
Essen und Dortmund waren beeindruckend. Neben<br />
der baulichen Schließung von Lücken wurden zahlreiche<br />
temporäre Nutzungen vorgeschlagen, die von flexiblen Containerbebauungen<br />
über attraktive Parkanlagen bis hin zu<br />
Spielplätzen, temporären Kinderhorten und künstlerischen<br />
Nutzungen reichten. Der Ideenwettbewerb mit über 400<br />
Beiträgen machte deutlich, dass nicht nur die Schließung von<br />
Baulücken, sondern auch der kreative Umgang mit dem<br />
Thema „Lücke” ein Wiederentdecken und Aufblühen scheinbar<br />
vergessener oder übersehener Orte in bester Lage bewirken<br />
kann.<br />
Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist mit ihrem<br />
Baulücken-Projekt auf überraschend große und positive<br />
Resonanz gestoßen – sowohl auf der konkreten Projektebene<br />
vor Ort als auch in der Fachöffentlichkeit und im<br />
politischen Raum. In fünf dezentralen Diskussionsveranstaltungen<br />
in Aachen, Köln, Duisburg, Essen und Dortmund<br />
diskutierten im Sommer und Herbst 2004 mehrere hundert<br />
Architekten, Stadtplaner, Politiker, Mitarbeiter der örtlichen<br />
Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürger über die Chancen,<br />
die Baulücken für ihre Stadt bieten. In den Fachdebatten<br />
um den „Stadtumbau West” werden Konzepte zum<br />
Umgang mit Baulücken ebenfalls regelmäßig und intensiv<br />
thematisiert.<br />
Die Architektenkammer führt das Projekt weiter. Es zeichnet<br />
sich ab, dass als Folge der Initiative „1000 Baulücken in<br />
<strong>NRW</strong>” einzelne Lücken künftig beispielhaft einer Nutzung<br />
zugeführt werden können. Das ist ein schöner, konkreter<br />
Erfolg für ein Projekt, das zunächst lediglich auf eine breite<br />
öffentliche Diskussion abzielte. Die Kammer lobte im Jahr<br />
2005 einen neuen Wettbewerb aus, mit dem die „Vorbildliche<br />
Nutzung von Baulücken in <strong>NRW</strong>” ausgezeichnet werden<br />
soll. Damit wird das Baulücken-Projekt aus der Phase der<br />
Dokumentation und Diskussion heraustreten und erste Lösungen<br />
präsentieren: Aus dem Hässlichen wächst das Schöne!
Kunibert Wachten<br />
28<br />
Temporäre Architektur an besonderen Orten
Nicht selten zeigt heute der öffentliche Raum in vielen Städten<br />
ein trauriges Bild. Lediglich die zentralen, herausgeputzten<br />
Lagen, die für die Beurteilung der Leistungsstärke und<br />
Ausstrahlung der Städte in Konkurrenz untereinander Bedeutung<br />
haben, sind von diesem Eindruck ausgenommen.<br />
Selbst viele „besondere Orte“ fristen ein betrübliches Dasein.<br />
Es sind vor allem oftmals auch jene öffentlichen Räume, die<br />
in den 1960er und 1970er <strong>Jahre</strong>n mit großen Ambitionen<br />
neuer urbaner Qualitäten gestaltet wurden, die diesen<br />
Anspruch nie einlösen konnten und bis heute zu keinem<br />
lebendigen, beachteten und „geliebten“ Stadtraum geworden<br />
sind. Und nicht selten sind diese Räume mittlerweile<br />
aus dem Blick von Stadtbewohnern und kommunaler Politik<br />
geraten. Oder langjährige, unproduktive Kontroversen über<br />
den gestalterischen Umgang mit ihnen verewigen ihren<br />
jämmerlichen Zustand.<br />
Auf diese Orte aufmerksam zu machen und die Möglichkeiten<br />
ihrer Weiterentwicklung, ihrer gestalterischen Aufwertung,<br />
ihrer kulturellen Aufladung und ihrer sozialen Kräftigung<br />
aufzuzeigen, ist ein zentrales Anliegen der <strong>Landesinitiative</strong><br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>. Und was ist naheliegender, als diese<br />
„Werbung“ für die Potenziale vernachlässigter Stadträume<br />
durch temporäre Gestaltungen zu betreiben und damit einen<br />
Prozess erhöhter Aufmerksamkeit und größeren Engagements<br />
für diese Stadträume in Gang zu setzen. Denn„temporäre<br />
Architektur“ besitzt besondere strategische Eigenschaften.<br />
Sie kann – selbst als „anstößig“ konzipiert – ihre Realisierungschance<br />
und eventuell auch Akzeptanz aus ihrer zeitlichen<br />
Befristung beziehen. Und oftmals ist es gar so, dass<br />
das Temporäre – auch wenn es keine generelle Wertschätzung<br />
genießt, weil es immer auch mit dem Etikett des Minderwertigen<br />
behaftet ist – durch das Prinzip der „Limitierung“<br />
doch Aufmerksamkeit erfährt und sein Wert gesteigert wird.<br />
Vor allem liegt der Vorteil aber in der rückstandslosen Beseitigung<br />
und der Gewährleistung des alten Zustandes, der<br />
dem „Temporären“ eigen ist.<br />
Das Projekt „Temporäre Architektur an besonderen Orten“ zeigt an jeweils<br />
einem anderen besonderen oder auffälligen Ort in ausgewählten Städten<br />
Nordrhein-Westfalens Installationen temporärer Architektur, mit der der<br />
„Ort“ in seiner Geschichte und heutigen Rolle jeweils so thematisiert wird,<br />
dass man zumindest „auf Zeit“ und eventuell darüber hinaus auf ihn aufmerksam<br />
wird. Temporäre Architektur bietet überdies auch die Chance, sich<br />
der konzeptionellen Interpretation des „Ortes“ in experimentell-spielerischer<br />
Art und Weise zu nähern. Kühne Formgebungen, ungewöhnliche Materialverwendungen,<br />
waghalsige Konstruktionen, irritierende Benutzungsangebote,<br />
neue stadträumliche Verknüpfungen sind die Konzeptionsingredienzien,<br />
die sich das Temporäre im Gegensatz zum Dauerhaften leisten kann. So können<br />
Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar gemacht werden, die üblicherweise<br />
nicht an die Oberfläche gelangen. Diese Konzeptionen zu wagen, die<br />
keine Routinen kennen und keine Voreingenommenheiten zulassen, ist<br />
in diesem Projekt Aufgabe von Arbeiten aus der Feder von Studierenden.<br />
Erstmals haben im vergangenen Jahr im Wettbewerb untereinander Studierende<br />
der Architektur und Raumplanung der Universitäten in Aachen und<br />
Dortmund und der Hochschulen in Düsseldorf und Münster in Kooperation<br />
mit der Stadt Düsseldorf, dem Europäischen Haus für Stadtkultur e.V. in<br />
Gelsenkirchen und dem damaligen Ministerium für Städtebau und Wohnen,<br />
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen temporäre Installationen<br />
für den Gustav-Gründgens-Platz zwischen dem legendären „Dreischeibenhochhaus“<br />
und dem Schauspielhaus in Düsseldorf entwickelt. Eine besondere<br />
Auflage war dabei auch, den Siegerentwurf im Rahmen unverrückbarer<br />
Kostenvorgaben zu realisieren und der Öffentlichkeit 14 Tage lang zu präsentieren.<br />
Wettbewerb, Realisierungs- und Präsentationszwang machten<br />
für die Studierenden dieses Kooperationsprojekt besonders reizvoll, was<br />
vielleicht ihr außerordentliches Engagement erklärt und – sicherlich aus<br />
Sicht der Hochschulen – eine Fortsetzung nahe legt. Denn auch die Ausbildung<br />
an den Hochschulen ist von zu viel Routine geprägt und kann Impulse<br />
vertragen.<br />
29
Peter Dübbert<br />
30<br />
Der Traum vom Turm<br />
Eine Ausstellung von besonderem Charakter
Um Türme und Hochhäuser Wirklichkeit werden zu lassen,<br />
sind die Menschen schon immer an ihre physischen und<br />
technischen Grenzen gegangen. Beim Pyramidenbau waren<br />
diese Grenzerfahrungen für ganze Völker vor allem qualvoll.<br />
Auch der Stolz über die Errichtung der ersten modernen<br />
Hochhäuser in New York wird noch durch die hohe Zahl<br />
der Opfer unter den Bauarbeitern getrübt. Mit Beginn des<br />
20. Jahrhunderts wandelte sich der Bau von Türmen und<br />
Hochhäusern dann aber primär zu einer ingenieurtechnischen<br />
und statischen Herausforderung.<br />
Es waren und sind Erfindungen und Entwicklungen von<br />
Ingenieuren, die den Hochhausbau revolutionierten. Heute<br />
ist der Hochhausbau nicht nur sicher, sondern gelangt in<br />
Dimensionen, die den „Traum vom Turm” haben wahr werden<br />
lassen. Durch die Erfindung des Stahlskelettbaus und eine<br />
perfektionierte Baulogistik werden heute im Hochhausbau<br />
lange für unvorstellbar gehaltene Höhen erreicht. Fahrstühle,<br />
Klimatechnik und Erdbebensicherheit sorgen dafür, dass<br />
diese Hochhaustürme auch bewohnt, belebt werden können.<br />
Obwohl Nordrhein-Westfalen einer der größten Ballungsräume<br />
Europas ist, finden sich hier im internationalen Vergleich<br />
bislang eher moderate Formen des Hochhausbaus.<br />
Das macht Gebäude wie das Thyssen-Hochhaus in Düsseldorf,<br />
den RWE-Turm in Essen und den Post-Tower in Bonn –<br />
um nur einige Beispiele zu nennen – nicht weniger faszinierend.<br />
Sie prägen den individuellen Charakter ihrer Stadt,<br />
markieren besondere Orte und dienen als eindeutige städtebauliche<br />
Orientierungspunkte. Die Diskussion über Hochhäuser<br />
ist deshalb auch in Nordrhein-Westfalen sehr lebendig.<br />
Hohe Gebäude geben den Stadtorganismen derart starke<br />
Impulse, dass sie immer wieder von neuem das öffentliche Interesse wecken.<br />
So werden in fast allen größeren Städten des Landes „Hochhausdiskussionen”<br />
geführt.<br />
Vor diesem Hintergrund hat sich die Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong> gerne bereit<br />
erklärt, die Ausstellung „Der Traum vom Turm. Hochhäuser: Mythos – Ingenieurkunst<br />
– Baukultur” zu unterstützen und gemeinsam mit dem Ministerium<br />
für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes <strong>NRW</strong> und der<br />
Stadt Düsseldorf die Schirmherrschaft über die Ausstellung zu übernehmen.<br />
Die Ausstellung im Düsseldorfer <strong>NRW</strong>-Forum Kultur und Wirtschaft zeichnete<br />
in 60 Modellen – zum ersten Mal allesamt im gleichen Maßstab 1:200 – die<br />
Geschichte des Hochhauses von Babel bis Beijing nach, thematisierte die<br />
kulturellen Aspekte des „hohen” Bauens und zeigte vor allem die Ingenieurleistungen<br />
„hinter” den Bauten. Die großen Schritte in der Geschichte der<br />
Ingenieurkunst, die das immer höhere Bauen erst ermöglichen, wurden plastisch<br />
und nachvollziehbar vermittelt: vom Personenlift und dem vielfältigen<br />
Einsatz von Stahl bis zu visionären Windturbinen in der Spitze von Hochhäusern<br />
oder neuen Fassaden aus textilen Materialien. Manche der 60 Modelle<br />
überschritten kaum einen halben Meter Höhe, andere wie das Modell des<br />
Millenium Tower erreichten mit 4,20 Meter beinahe die Höhe der Ausstellungsräume<br />
– noch als Miniaturen stellen Hochhäuser und ihr Maßstab<br />
mitunter echte räumliche Herausforderungen dar.<br />
Vom 6. November 2004 bis zum 20. Februar 2005 haben rund<br />
35.000 Menschen die Ausstellung gesehen, viele von ihnen<br />
haben sich in Fachführungen, Vorträgen und Filmen informiert.<br />
Der begleitende Ausstellungskatalog war noch<br />
vor Ende der Austellung vergriffen; besser hätte die<br />
Erfolgsbilanz nicht ausfallen können. Die Initiatoren<br />
der „Traum vom Turm“-Ausstellung haben ihr<br />
gemeinsames Anliegen, am Beispiel des Hochhausbaus<br />
auf anschauliche Weise gebaute<br />
Kulturgeschichte und die Bedeutung der<br />
Ingenieurkunst zu vermitteln und zugleich<br />
einen Beitrag zu den aktuellen<br />
Diskussionen um Stadtbaukultur und<br />
Hochhausentwicklungen zu leisten,<br />
mehr als erreicht. Der Ingenieurkammer-Bau<br />
<strong>NRW</strong>, der berufsständischen<br />
Gemeinschaft von<br />
fast 10.000 Ingenieurinnen<br />
und Ingenieuren im Bauwesen<br />
in Nordrhein-Westfalen, ist<br />
es überdies gelungen, anlässlich<br />
ihres zehnjährigen<br />
Bestehens das Augenmerk<br />
der Öffentlichkeit in<br />
besonderem Maße auf<br />
die herausragenden<br />
ingenieurtechnischen<br />
Leistungen zu lenken,<br />
ohne die zum Beispiel<br />
der moderne „Traum<br />
vom Turm” gar nicht<br />
zu verwirklichen<br />
wäre.<br />
31
Hans-Dieter Krupinski<br />
Im dicht besiedelten und vom Strukturwandel besonders betroffenen Nordrhein-Westfalen<br />
haben Qualitätsverbesserungen im Wohnungsbau eine<br />
besonders hohe Bedeutung. Dies hängt wesentlich mit dem Erbe jenes Siedlungsbaus<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen, der unter dem Druck<br />
großer Wohnungsnot und hoher Zuwanderungsraten stattfand; vor allem<br />
der bis Anfang der 60er <strong>Jahre</strong> errichtete Wohnungsbestand mit seinen fast<br />
zwei Millionen Wohnungen und aus heutiger Sicht vielfach unzureichenden<br />
Standards stellt eine beträchtliche Hypothek in der Konkurrenz mit anderen<br />
Wachstums- und Entwicklungsregionen dar. Auch die Wohn- und Lebensbedingungen<br />
in vielen hochverdichteten Wohnsiedlungen der 60er und<br />
70er <strong>Jahre</strong> mit ihrer überzogenen städtebaulichen Dichte, häufig nicht akzeptierten<br />
Bauformen und einseitigen Miet- und Sozialstrukturen begründen<br />
die Notwendigkeit, die Qualität des Wohn- und Siedlungsbaus in Nordrhein-Westfalen<br />
nachhaltig zu verbessern.<br />
Ein wichtiger Baustein dieser Qualitätsoffensive ist der erstmals im Jahr<br />
2004 ausgeschriebene „Innovationspreis Wohnungsbau <strong>NRW</strong>“, mit dem herausragende<br />
und beispielgebende Projekte im zeitgenössischen Wohnungsbau<br />
ausgezeichnet und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Der<br />
Preis soll zugleich an wichtige baukulturelle Traditionen des Landes anknüpfen,<br />
wie sie in vielen historischen Stadtquartieren zum Ausdruck kommen.<br />
Dazu zählen vor allem die historischen Stadtkerne, die gründerzeitlichen<br />
Stadtquartiere, die Gartenstädte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie der<br />
Wohnsiedlungsbau aus den 20er und 30er <strong>Jahre</strong>n des letzten Jahrhunderts.<br />
Die Nutzungs- und Gestaltqualitäten, die diese Siedlungstypologien auszeichnen,<br />
sind in der Nachkriegszeit häufig vernachlässigt worden, weil die<br />
32<br />
Innovationspreis Wohnungsbau<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Schwerpunkte der Wohnungs- und Städtebaupolitik im Wiederaufbau<br />
einer kriegszerstörten Siedlungslandschaft und<br />
der Beseitigung der Wohnungsnot lagen.<br />
Erst Mitte der 70er <strong>Jahre</strong> kam es zeitgleich mit der Herausbildung<br />
einer behutsamen und kleinteiligen Stadterneuerungspolitik<br />
zu einer Umorientierung in der Wohnungs- und<br />
Städtebaupolitik, bei der die qualitativen Aspekte des Wohnungsbaus<br />
wieder stärker in den Mittelpunkt gestellt wurden.<br />
In dieser Zeit gewannen Erhaltung und Erneuerung von<br />
stadtbildprägenden und denkmalwerten Bausubstanzen im<br />
Wohnungsbau an Bedeutung, verbunden mit einer generellen<br />
Rückbesinnung auf den architektonischen, städtebaulichen<br />
und wohnungswirtschaftlichen Reichtum einiger<br />
historischer Bauepochen – zum Beispiel des Wohnungsbaus<br />
der 20er und 30er <strong>Jahre</strong> mit seiner traditionalistischen,<br />
expressionistischen oder auch funktionalistischen Architektur.<br />
Dieser notwendig gewordene Sinneswandel im Wohnungsbau<br />
hat dann auch zu veränderten Leitzielen in der<br />
Förderpolitik des Landes geführt. Dazu gehören moderate<br />
städtebauliche Dichten, standortangepaßte Siedlungstypologien<br />
und ein hochwertiges Wohnumfeld; dazu zählen aber<br />
auch hohe Nutzungs- und Gestaltqualitäten der Wohngebäude<br />
selbst, wie sie jetzt mehr und mehr auch über Wettbewerbs-<br />
und Gutachterverfahren und moderierte Beteiligungsprozesse<br />
sichergestellt werden sollen.
Mit dem neuen Innovationspreis Wohnungsbau <strong>NRW</strong> sollen<br />
in erster Linie Bauherren und Investoren angesprochen werden,<br />
die sich mit ihren Projekten um mehr Qualität im Wohnungsbau<br />
verdient machen und dabei innovative Wege gehen.<br />
Gegenwärtig stehen vor allem überzeugende Konzepte im<br />
innerstädtischen Wohnungsbau im Fokus des Interesses;<br />
deshalb sind 2005 solche Projekte ausgezeichnet worden,<br />
die beispielhafte Lösungen für innerstädtische Standorte<br />
aufzeigen.<br />
So hat zum Beispiel beim prämierten Projekt „Tremonia” auf<br />
einem ehemaligen Zechengelände in Dortmund eine Gruppe<br />
von Stadtbewohnern in Eigeninitiative ein Wettbewerbsverfahren<br />
für ihre Idee des gemeinschaftlichen Wohnens<br />
initiiert und ein gestalterisch, funktional und ökologisch sehr<br />
anspruchsvolles Wohnungsbauprojekt realisiert. Das Projekt<br />
hat nicht nur hinsichtlich der Wiedernutzung brachgefallenen Stadtraums<br />
Vorbildcharakter, sondern setzt mit seiner weitreichenden Selbstorganisation<br />
des Planungsprozesses auch Maßstäbe bei der Einbeziehung von Nutzern.<br />
Auf eine andere Art und Weise innovativ ist ein ebenfalls in 2005 prämiertes<br />
Projekt: Der Umbau eines Hochbunkers zu Wohnzwecken in Köln zeigt,<br />
dass es ganz neue Möglichkeiten eines bestandsorientierten Wohnungsbaus<br />
geben kann. In der kreativen Auseinandersetzung mit Gebäudetypologien,<br />
die für Wohnzwecke zunächst als unbrauchbar gelten, entstehen neue,<br />
ungewöhnliche Wohnungskonzepte, für die es ganz offensichtlich auch<br />
einen Markt gibt.<br />
Für derartige Innovationen des innerstädtischen Wohnens braucht es seitens<br />
der Bauherren und Investoren sehr viel Mut und ein gutes Gespür für<br />
sich verändernde Formen und Anforderungen des Wohnens – Eigenschaften,<br />
die das Land mit diesem, künftig alle fünf <strong>Jahre</strong> zu vergebenden Innovationspreis<br />
Wohnungsbau <strong>NRW</strong> gerne honoriert.<br />
33
Wolfgang Christ<br />
34<br />
Stadt und Handel<br />
Initiativen für Baukultur
Shopping Center und Stadt<br />
Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels hat Alarm<br />
geschlagen: In den vergangenen zehn <strong>Jahre</strong>n haben die<br />
Innenstädte jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro Umsatz verloren.<br />
Im gleichen Zeitraum fiel die Besucherfrequenz um 25 Prozent;<br />
zugleich erhöhte sich die gesamte Einzelhandelsfläche<br />
um 20 Prozent. In diesem Jahr kommen weitere eine Million<br />
Quadratmeter hinzu, insbesondere in den annähernd 60<br />
Shopping Centern, die derzeit geplant, genehmigt und/oder<br />
bereits im Bau sind. Die Konsumenten, also wir, haben das<br />
Shopping Center zum Erfolgsmodell gemacht. Shopping<br />
Center werden heute europaweit zunehmend dort gebaut,<br />
wo „Stadt” am wertvollsten ist: in ihrer Mitte. Die Herausforderung<br />
für die Stadtplanung lautet also nicht, ob<br />
„Center” und „Stadt” integriert werden sollen, sondern<br />
wo und wie dies zu beiderseitigem Nutzen bewerkstelligt<br />
werden kann.<br />
Angesichts dieser Herausforderung ist es verwunderlich,<br />
dass bislang an keiner deutschen Hochschule ein Lehrstuhl<br />
für Handelsarchitektur existiert. Dabei wäre „Handelsstädtebau”<br />
in vielen Fällen sogar der angemessenere Begriff:<br />
Projekte wie das Centr0 in Oberhausen oder Oracle im südwestlich<br />
von London gelegenen Reading suchen von vornherein,<br />
die neuen Zentren des Einzelhandels mit der City der<br />
jeweiligen Stadt zu verschmelzen. An den Architekturfakultäten<br />
ist dies noch nicht angekommen. Die Interdependenzen<br />
von Stadt und Handel werden eher von benachbarten<br />
akademischen Disziplinen begleitet, zum Beispiel von der<br />
Geographie oder der Immobilienökonomie. Und ganz im<br />
Gegensatz zur Abstinenz in unserer Disziplin haben sich in<br />
den vergangenen <strong>Jahre</strong>n weltweit marktorientierte Forschungsinstitute<br />
sehr intensiv der Zusammenhänge von<br />
Stadtentwicklung, Lebensstil, Architektur, Design, Ökologie,<br />
Einzelhandel, Freizeit und Ökonomie angenommen. Darüber<br />
hinaus gibt es die marktbeherrschenden Unternehmen der<br />
retail industry, die ihrerseits eigene Forschungskapazitäten<br />
aufgebaut haben. Die zunehmende Privatisierung des Wissens<br />
um „Stadt und Handel” ist also unübersehbar.<br />
Wettbewerbe mit nachhaltiger Wirkung<br />
Mögliche Wege aus diesem offensichtlichen Abseits der<br />
Architektur-Disziplin zu suchen – das war das Anliegen des<br />
studentischen Ideenwettbewerbs „Shopping-Center-Stadt.<br />
Urbane Strategien für eine nachhaltige Entwicklung” aus<br />
dem Jahr 2003, initiiert vom Verfasser und getragen von<br />
den Universitäten Weimar, Karlsruhe und Wuppertal. Die<br />
Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> hat das Projekt von Anfang<br />
an begleitet und abschließend publiziert.<br />
Studentische Wettbewerbe sind generell nichts Außergewöhnliches.<br />
Zu etwas Besonderem wurde der Entwurfswettbewerb<br />
zum leerstehenden RathausCenter in Bochum<br />
durch eine Reihe von Erfahrungen, die nicht zuletzt auch die Grundphilosophie<br />
der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> widerspiegeln.<br />
Die erste und entscheidende Erfahrung ist, dass Begriffe wie „Strukturwandel”<br />
oder „Paradigmenwechsel” inhaltsleer bleiben, solange die grundlegenden<br />
Entwicklungsprozesse nicht klar nachvollzogen, Akteurskonstellationen<br />
nicht offen gelegt und mögliche Zukunftsoptionen nicht anschaulich vermittelt<br />
werden. Hier leistet die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> sehr viel: Sie ermöglicht<br />
eine praktische und vor allem praxisnahe Reflexion solcher diffusen<br />
Begriffe und der Prozesse, die sie beschreiben sollen. Die Initiative ist sozusagen<br />
eine Agentur für den reflektierten Strukturwandel.<br />
Darüber hinaus ist sie für mich ein Garant für Qualität: Mit <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> als Partnerin wurde die Arbeit der Universitäten professionalisiert,<br />
gleichsam zitierfähig gemacht. Nur so war es möglich, die für Stadt und<br />
Handel verantwortlichen Akteure mit diesem studentischen Entwurfswettbewerb<br />
auch zu erreichen.<br />
Und die dritte Erfahrung ist: Der universitäre Städtebau braucht Partner, die<br />
wissen, wie Architekten und Planer denken, wie urbane Milieus, in denen<br />
sie tätig sind, funktionieren. Nur so lassen sich gemeinsam neue Trends in<br />
Baukultur und Urbanistik aufspüren und mit eigenen Impulsen so thematisieren,<br />
dass eine größere Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird – Impulse<br />
wie die „Vorbildliche Handelsarchitektur in <strong>NRW</strong>”.<br />
Mit dem im Jahr 2004 verliehenen Preis für „Vorbildliche Handelsarchitektur<br />
in <strong>NRW</strong>” sind wichtige Anstöße zu einer „Baukultur des Konsums” gegeben<br />
worden. Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> hat mit diesem Wettbewerb<br />
nicht nur eine laufende Debatte verstärkt bzw. erst initiiert, sondern auch<br />
die einander bislang eher misstrauisch begegnenden Parteien – Einzelhandel,<br />
Stadtverwaltung, Architektur, Immobilienwirtschaft, Universität – miteinander<br />
ins Gespräch gebracht. Ausstellungen, Publikationen, Tagungen<br />
oder eben auch Preisverleihungen sind notwendige vertrauensbildende<br />
Maßnahmen in einem Umfeld, in dem gegenseitiges Verständnis und Kooperation<br />
noch eingeübt werden müssen.<br />
Neue Allianzen für Veränderung<br />
Nordrhein-Westfalen ist seit dem 19. Jahrhundert eine Industrie-Stadt-Landschaft<br />
der permanenten upgrades; und jede neue Version braucht ihre Programmentwickler<br />
und -gestalter. Karl Ganser hat es in den neunziger <strong>Jahre</strong>n<br />
des letzten Jahrhunderts mit der IBA Emscher Park verstanden, aus der Aufgabe,<br />
über die nachindustrielle Gesellschaft noch nicht alles zu wissen, aber<br />
zugleich zukunftsweisend handeln zu müssen, ein noch lange vorbildliches<br />
Innovationsmodell geschaffen. Heute arbeitet die <strong>Landesinitiative</strong> StadtBau-<br />
Kultur <strong>NRW</strong> in den Räumen der ehemaligen IBA-Zentrale. Die Atmosphäre<br />
der Offenheit gegenüber dem Neuen, dem Fremden, dem Experimentellen<br />
ist geblieben. Ein solcher Geist zieht all jene an, die Allianzen für Veränderung<br />
schließen wollen – Allianzen, die die Wirkkräfte der Zeit erkennen und<br />
ihnen eine Richtung verleihen, die das Prädikat „Kultur” verdienen.<br />
35
J. Alexander Schmidt<br />
Stefanie Bremer<br />
Gestaltung geht nicht. Nicht in Gewerbegebieten.<br />
Das ist eine Meinung. Oder eben ein Vorurteil, das sich hält. Erstaunlicherweise<br />
weniger in den Köpfen der Gewerbetreibenden. Die sind oft weniger<br />
gestaltungsresistent als angenommen. Das Vorurteil hält sich mehr in den<br />
Köpfen der Politiker und der Planer selbst.<br />
In der schrumpfenden Stadt ist jede Angebotsplanung ein Wagnis. Eine<br />
Stadt kann es sich nicht leisten, dass Gebiete, die mit hohem Aufwand voll<br />
erschlossen und baurechtlich vorbereitet wurden, über <strong>Jahre</strong> nur spärlich<br />
oder nicht genutzt werden. Manchmal werden von den Kommunen Investoren<br />
und Bauherren für ihre Orte der Arbeit regelrecht gesucht – fast<br />
um jeden Preis. Dabei haben sie im Bewusstsein, dass es zu viele Angebote<br />
für die begehrten Unternehmen und zu wenige Schlüsselbetriebe gibt, die<br />
in der Lage sind, einem Gebiet ein prägnantes und zugkräftiges Nutzungsprofil<br />
zu geben, um damit weitere Ansiedlungen zu generieren. Unter diesen<br />
Rahmenbedingungen hat jede restriktive Gestaltungsplanung einen<br />
schweren Stand.<br />
Vor diesem Hintergrund ist ein zurückhaltender und vorsichtiger Umgang<br />
mit besonderen Planungsverfahren und qualitativen Gestaltungselementen<br />
erforderlich; und eine planerische Bedachtsamkeit, die viele entmutigt, diesen<br />
schwierigen Weg überhaupt zu gehen. Nicht zuletzt deshalb enden viele<br />
gute Ansätze auch eher in einem planerischen Laissez faire.<br />
Gewerbegebiete zwingen zu einer vorurteilsfreien Auseinandersetzung mit<br />
den komplexen Wirkungsmechanismen der Stadt im 21. Jahrhundert. Der<br />
Rahmen und der Spielraum für Gestaltung in Gewerbegebieten müssen dem<br />
ökonomischen und kulturellen Wandel entsprechend neu ergründet werden.<br />
Gewerbegebiete brauchen ein Gestaltungsvokabular, das städtebauliche<br />
Erfordernisse berücksichtigt und zugleich auf die Bedürfnisse von Betrieben<br />
36<br />
Orte der Arbeit<br />
Gestaltungsmöglichkeiten in Gewerbegebieten<br />
und Kommunen im Umgang mit den sich teilweise schnell<br />
wandelnden Betriebsstrukturen eingeht. Darüber hinaus<br />
müssen neue Strategien und Allianzen gefunden werden,<br />
die einen konstruktiven Umgang mit Unternehmen und<br />
ihrem Bedürfnis nach Werbung im Raum, mit eigenwilligen<br />
Investoren und Bauherren oder dem noch unbekannten<br />
späteren Nutzer in Gewerbegebieten bieten.<br />
„Orte der Arbeit” ist ein Forschungsprojekt des Instituts für<br />
Stadtplanung und Städtebau an der Universität Duisburg-<br />
Essen, das die Möglichkeiten und Grenzen stadträumlicher<br />
und landschaftsplanerischer Aufwertung von Gewerbegebieten<br />
evaluiert. Mit den Forschungsergebnissen sollen ein<br />
neues Bewusstsein für Formen gestalterischer Qualität in<br />
Gewerbegebieten geweckt sowie Orientierungshilfen und<br />
Lösungswege für Planungskonzepte diskutiert werden.<br />
Dafür wurden geplante und realisierte Gewerbegebiete<br />
bewertet und die Instrumente und Umsetzungsstrategien in<br />
Experteninterviews evaluiert. Das Forschungsprojekt ist<br />
noch nicht abgeschlossen, sodass zum jetzigen Zeitpunkt<br />
nur erste Einschätzungen wiedergegeben werden können:<br />
• Vielen guten Beispielen in der Gewerbegebietsplanung<br />
ist die Suche nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen<br />
Gestaltungsfreiheiten und Unbestimmtheiten auf der<br />
einen Seite sowie Vorgaben und Qualitätsgarantien auf der<br />
anderen Seite gemeinsam. In Rahmenplänen und teils auf-
wendigen Visualisierungen wird mit einer bestimmten stadträumlichen<br />
und landschaftlichen Qualität geworben: Arbeiten<br />
und Wohnen am Wasser, kreatives Arbeiten in alten Industriebauwerken,<br />
Arbeiten im Park, konzentriertes Arbeiten<br />
im stillen Wald. Geboten werden Zukunftsbilder von einem<br />
ruhigen, manchmal aber auch leicht urbanen Raum, der<br />
nicht viel mit den Wirklichkeitsbildern der gängigen Gewerbegebietslandschaften<br />
gemeinsam hat.<br />
• Mit Hilfe positiv belegter Gestaltungselemente wird ein<br />
konsensfähiges Bild erzeugt. Der Entwurf ist ein Angebot<br />
für eine mögliche Zukunft – ohne baurechtliche oder gestalterische<br />
Forderungen. Das Bild und die weitere Kommunikation<br />
über dieses Bild dürfen bei möglichen Investoren kein<br />
Gefühl der Einschränkung oder Regulierung vermitteln. Das<br />
Angebot darf nicht zu bindend gemeint sein. Man scheut<br />
sich, von den potenziellen Bauherren und Bauträgern einen<br />
direkten Beitrag zur Umsetzung dieses Bildes einzufordern.<br />
In einigen Gebieten wird daher der Fokus bei der Umsetzung<br />
auf den öffentlichen, gestalterisch leichter steuerbaren<br />
Raum gelegt. Der öffentliche Raum wird zum gestalterischen<br />
Rückgrat, während den Bauherren auf den Grundstücken<br />
möglichst viel Gestaltungsfreiraum eingeräumt wird.<br />
• Der öffentliche Raum als primäres Gestaltungsfeld wird in<br />
manchen Gewerbegebieten um bestimmte Zonen erweitert,<br />
beispielsweise um den schwer reglementierbaren privaten Raum zwischen<br />
Straße und Gebäudefassade. Vor dem Grundstücksverkauf wird diese Zone<br />
von kommunaler Seite mit gestaltet und realisiert. Ein Teil des Grundstücks<br />
ist dann vor Ankauf im Sinne des übergreifenden städtebaulichen Konzepts<br />
schon fertig gestaltet. Anderenorts werden bestimmte, gebietsprägende<br />
Grundstücke vollständig von der öffentlichen Hand bebaut. Um die Gestaltungsziele<br />
umsetzen zu können, mäandriert der öffentliche Einfluss in den<br />
Privatraum.<br />
• Weniger mit baulich-gestalterischen Vorleistungen, mehr mit planerischem<br />
Vordenken wird dort gearbeitet, wo die Gestaltungsziele mit den einzelnen<br />
Bauherren durch Moderation und Bauberatung ausgehandelt werden, ohne<br />
dass die Gestaltungselemente im Detail in einer Satzung festgelegt sind. In<br />
anderen Fällen setzen Kommune oder Entwickler auf besondere Erstbezieher<br />
als Qualitätspioniere, die mit ihren Bauten und Bauweisen den nachfolgenden<br />
Nachbarn ein bestimmtes Niveau vorleben.<br />
Noch gibt es wenig Erfahrung mit diesen subtilen Instrumenten. Noch sind<br />
es einzelne Projektentwickler, die diese neuen Planungswege und Entwurfskulturen<br />
erkunden. Diese Projekte erzeugen aber ein Interesse an Baugebieten,<br />
die vordem eher am Rande der Planungsdebatte standen und für die<br />
nur selten Gestaltungsinstrumente und Strategien erprobt wurden. Vielleicht<br />
werden diese Gebiete wieder zu selbstverständlichen Teilen der Stadt,<br />
in denen Menschen nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen können. Die<br />
Projekte machen neugierig und sie legen eine neue These nahe.<br />
Gestaltung geht. Auch in Gewerbegebieten.<br />
37
Dirk Haas<br />
Im europäischen Kontext gilt das Ruhrgebiet als einzigartiges Konglomerat<br />
aus verstädterten Territorien, großmaßstäblichen Infrastrukturen und posturbanen<br />
Wildnissen, als ein Typus städtischer oder besser: stadtregionaler<br />
Entwicklung, der mit der feudal-bürgerlichen Tradition der Europäischen<br />
Stadt nur wenig gemein hat. Der vermeintliche Wirrwarr an Nutzungen,<br />
Funktionen und Identitäten, die Vielzahl von Grenzen, Übergangsräumen,<br />
blinden Flecken und oszillierenden Zuständigkeiten, die versteckte Dichte –<br />
ganze Generationen von Ruhrgebietsplanern haben hier in guter Absicht<br />
Raumordnung zu betreiben versucht und sich dabei zumeist an traditionellen<br />
Stadt-Vorstellungen orientiert.<br />
Mittlerweile ist die alte Sehnsucht nach eindeutiger Ordnung, die das Ruhrgebiet<br />
immer als defizitären Raum begreifen musste, einem neuen „poetischen<br />
Realismus” gewichen. Dieser Realismus anerkennt, dass sich das<br />
Ruhrgebiet nach anderen Parametern vermisst: Pluralität statt Einheit, Heterogenität<br />
statt Einheitlichkeit, Hybridität statt klarer Identitäten, Komplexität<br />
statt Einfachheit, Brüche statt Kontinuität. Das sind, so bezeichnen es die<br />
Kulturwissenschaften, die Parameter der Zweiten Moderne. Insofern ist das<br />
Ruhrgebiet für viele grundsätzliche Zukunftsfragen ein viel versprechendes<br />
Experimentierfeld, eine Avantgarderegion wider Absicht. Im Jahr 2010 will<br />
sich diese Region folgerichtig als eine Europäische Kulturhauptstadt ganz<br />
neuen Typs präsentieren.<br />
Die Einsicht, sich angesichts der strukturellen Besonderheiten der Region<br />
von idealisierten Stadt-Vorstellungen befreien zu müssen, fällt zusammen<br />
mit einem generell wachsenden Interesse an der Regionalisierung des Städtischen<br />
und den daraus resultierenden Konsequenzen für die stadtplanerische<br />
und baukulturelle Praxis, und zwar nicht nur im Ruhrgebiet und seinen<br />
zyklisch wiederkehrenden Ruhrstadt-Debatten, sondern im gesamten europäischen<br />
Raum. Im Fokus steht eine andere Form der europäischen Stadt,<br />
die der „Europäischen Agglomeration”. Für die bislang eher an traditionellen<br />
Stadtbildern orientierte Idee der Europäischen Kulturhauptstadt wäre<br />
die Vergabe des Titels an das Ruhrgebiet also ein wichtiger und längst überfälliger<br />
Blickwechsel, wenn künftig von der Zukunft des Städtischen in Europa<br />
die Rede ist.<br />
Die Gestaltbarkeit regionaler Stadtlandschaften ist deshalb ein zentrales<br />
Thema im Bewerbungskonzept der Ruhrgebietsstädte zur Europäischen Kulturhauptstadt.<br />
Im Programmfeld „Stadt der Möglichkeiten” werden verschiedene<br />
Leitprojekte und Schauplätze entwickelt, die richtungweisende<br />
38<br />
Hauptstadtplanungen<br />
Werkstattgespräche zur Bewerbung des<br />
Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas 2010<br />
Ansätze zur Gestaltung einer regionalen Europäischen Kulturhauptstadt<br />
verfolgen und erproben sollen. Wie es gelingen<br />
kann, das weitläufige und unübersichtliche Ruhrgebiet<br />
zu einer atmosphärisch dichten Erlebnislandschaft zu entwickeln,<br />
dazu hat das Europäische Haus der Stadtkultur<br />
gemeinsam mit dem Bewerbungsbüro „Kulturhauptstadt<br />
Europas 2010: Essen für das Ruhrgebiet” ein öffentliches<br />
Forum und zwei Werkstattgespräche durchgeführt, die im<br />
Februar und November 2005 im stadt.bau.raum in Gelsenkirchen<br />
stattfanden.<br />
Die Veranstaltungen haben Akteure und Experten aus den<br />
Bereichen Kultur, Architektur, Planung, Design, Wirtschaft,<br />
Verkehr und Tourismus zu einem überraschend engagierten<br />
und ergebnisreichen baukulturellen Dialog zusammengeführt:<br />
Inwieweit bedarf das Ruhrgebiet neuer ausdrucksstarker<br />
architektonischer Symbole, neuer ikonographischer<br />
Signaturen, die sich zum einen von dem zum Selbstbild<br />
gewordenen Image eines „Nationalparks Industriekultur”<br />
lösen, zum anderen die ästhetische Mittelmäßigkeit der faktischen<br />
neuen Zentren des Ruhrgebiets (Neue Mitte Oberhausen,<br />
Arena AufSchalke etc.) überwinden? Oder braucht<br />
das zuweilen an-ästhetische Ruhrgebiet nicht viel eher eine<br />
neue Alltagskultur des Bauens, ein neues, zu Anfang vielleicht<br />
noch dissidentes Qualitätsempfinden, das sich nicht<br />
über „große Architektur”, sondern über ungewöhnliche,<br />
experimentelle Praktiken in den eher alltäglichen Bauaufgaben<br />
im Ruhrgebiet entwickeln könnte? In der Diskussion<br />
dieser Fragen sind nicht nur neue Einsichten ob der Notwendigkeit<br />
einer stärker investigativen baukulturellen Forschung<br />
und Praxis entstanden, sondern auch einige konkrete<br />
Projektideen für die Kulturhauptstadt selbst: zum Beispiel<br />
die Idee vom „wohnwagenwerk.ruhr” als einem integrierten<br />
und stadt-ästhetisch doch autonomen Mobilitäts- und Beherbungskonzept<br />
für die Besucher der Kulturhauptstadt<br />
oder das „fliegende Rathaus” als mobiles icon für den mit<br />
der Bewerbung verbundenen Gründungsakt einer neuen<br />
(Kulturhaupt-)Stadt.
Die weiteren Diskussionen über die zahlreichen Korridore<br />
und linearen Räume des Ruhrgebiets, die eine bewusste Orientierung<br />
in der Region überhaupt erst ermöglichen, haben<br />
zu einem ersten räumlich-programmatischen Modell der<br />
Kulturhauptstadt geführt. Das „Passagen-Modell” begreift<br />
die verschiedenen Zonen des Ruhrgebiets und ihre schmalen<br />
Mobilitätsbänder als Räume mit einer jeweils eigenen Identität,<br />
Geschichte und Ästhetik, ähnlich den Four Ecologies,<br />
die Reyner Banham in den 70er <strong>Jahre</strong>n in Los Angeles identifizierte.<br />
Das in weiten Teilen romantisch anmutende Ruhrtal,<br />
die urbane Hellwegzone mit den Großstädten zwischen<br />
Duisburg und Dortmund, der starken Wandlungsprozessen<br />
unterliegende Emscherraum und seine industriekulturellen<br />
Ikonen und Merkzeichen, schließlich die vormals ländlich<br />
strukturierte, heute in Teilen zwischenstädtische Lippezone:<br />
Sie stellen sehr unterschiedliche urbane Atmosphären dar,<br />
die den Besuchern der Kulturhauptstadt zugänglich gemacht<br />
werden. Das Passagen-Modell umfasst ein Netz aus<br />
Spielstätten, Ereignisorten, Mobilitätsschnittstellen und<br />
regionalen Räumen, in denen die Kulturhauptstadt ihr Programm,<br />
aber vor allem sich selbst präsentiert. Dabei wird<br />
es neben der dramaturgischen Konzeption und logistischen<br />
Organisation der Passagen genau so um ihr Erscheinungsbild<br />
gehen, also um die Architekturen des Empfangs an den<br />
Veranstaltungsorten und die Szenografien der Bewegung<br />
in den Passagen. Eine durchgreifende Neugestaltung ist<br />
damit nicht gemeint – eher sind es punktuelle, aber systematische<br />
Transformationen und Eingriffe zur möglichst „sinnlichen”<br />
Erschließung der Region.<br />
Es sind solche Orte und Räume wie Zollverein, das Zweistromland<br />
zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal oder<br />
auch die A42 als künftigem parkway des regionalen Emscher<br />
Landschaftsparks, die für ein neues, auch sinnlich erfahrbares<br />
Selbstverständnis des Ruhrgebiets stehen, das sich<br />
nun nicht mehr an traditionellen Erscheinungsbildern einer<br />
Metropole und den damit verbundenen trivialisierten Vorstellungen<br />
von Urbanität orientiert. Der Habitus der Metropole<br />
ist mit seinen notorischen Bildern nächtlich erleuchteter<br />
Skylines längst zu einem austauschbaren Gemeinplatz<br />
geworden. Das Ruhrgebiet hat ganz andere Begabungen –<br />
es kann zur Europäischen „Post-Metropolis” werden.<br />
39
Räume öffnen<br />
41
Udo Weilacher<br />
„George Orwells Prophezeiung wird wahr: nicht im 20. Jahrhundert, sondern<br />
im 21. Jahrhundert“, konstatierte Steven Spielberg (zitiert aus „Deconstructing<br />
Minority Report“, Twentieth Century Fox 2002). Renommierte<br />
amerikanische Experten aus den Bereichen Technologie, Umwelt, Verbrechensbekämpfung,<br />
Medizin, Gesundheit, Soziale Dienste, Verkehr, Computertechnologie<br />
und Stadtplanung lud der amerikanische Regisseur zu einem<br />
dreitägigen think tank nach Venice ein, um am Beispiel von Washington<br />
D.C. darüber nachzudenken, wie die Welt in Zukunft aussehen wird. Dabei<br />
ging es nicht etwa um die weit entfernte, sondern um die vorhersehbare<br />
Zukunft in einem halben Jahrhundert: 50 <strong>Jahre</strong>, in denen sich aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach wohl keine völlig neuen Gesellschaftsformen entwickeln<br />
werden. Interessanterweise wird sich die alte amerikanische Hauptstadt<br />
nach Meinung der Experten in ihrer äußeren Erscheinung kaum verändern,<br />
denn geltende Bauvorschriften verhindern auch in naher Zukunft den Bau<br />
von Wolkenkratzern und das Überbauen vorhandener öffentlicher Parks<br />
und Gärten im zentralen Stadtgebiet. Aber werden noch neue Parks und<br />
Plätze entstehen?<br />
„There is absolutely no need for parks anymore, because the 19th century<br />
problems have been solved and a new type of city has been created“,<br />
behauptete nicht etwa Steven Spielberg, sondern der niederländische Landschaftsarchitekt<br />
Adriaan Geuze vor etwa einem Jahrzehnt (Geuze 1993).<br />
Der Gründer des Rotterdamer Büros West 8 glaubt, dass die Stadtbewohner<br />
schon heute über genügend technische Möglichkeiten verfügen, um sich<br />
ihre individuellen Fluchtwege aus der Stadt in reale oder virtuelle, bevorzugt<br />
exotische Naturbilder zu bahnen. Spielbergs Science-Fiction Film „Minority<br />
Report“ widerspricht dieser These jedoch anschaulich und der Zuschauer<br />
erkennt auch in den zukünftigen, vertikal in die Höhe schießenden Stadtquartieren<br />
jenseits des Flusses Potomac zahlreiche öffentliche, aufwändig<br />
begrünte Freiräume, die sich äußerlich nicht von traditionell gestalteten<br />
Parks und Plätzen unterscheiden, wie wir sie heute schon kennen.<br />
Öffentliche Räume, Gärten, Parks, Plätze und Straßen werden entgegen kulturpessimistischer<br />
Prophezeiungen keineswegs aus dem Bild der Städte verschwinden,<br />
im Gegenteil. Doch gestalterisch entwickeln sie sich offenbar<br />
kaum weiter. Heute werden selbst neue Freiräume in bereits bekannte<br />
Typologien verwandelt, unabhängig von der Frage, ob die dem Industriezeitalter<br />
entstammenden Natur- und Landschaftsbilder dem Leben im 21. Jahrhundert<br />
überhaupt noch angemessen sind, und völlig ungeachtet der Tatsache,<br />
dass die Pflege dieser hübschen Anlagen in Zukunft kaum noch<br />
42<br />
Die Zukunft des öffentlichen Raumes –<br />
Traum oder Alptraum?<br />
öffentlich zu finanzieren sein wird. Wieso also sind Gartengestaltung<br />
und Landschaftsarchitektur in ihrer gestalterischen<br />
Weiterentwicklung gehemmt, während in allen anderen<br />
kulturellen, auch baukulturellen Belangen fieberhaft<br />
nach zeitgemäßen Ausdrucksformen verlangt wird?<br />
Der allgemeine Glaube an die ewig gültigen Gesetze der<br />
„guten“ Natur sitzt tief und unvermindert brennt die Sehnsucht<br />
der Stadtbewohner nach freier Landschaft, die spätestens<br />
seit der Entstehung der dichten europäischen Industriestädte<br />
zum Mythos geworden ist. Darüber hinaus lieben<br />
Architekten und Stadtplaner die Vorstellung von der eindrucksvollen<br />
Bauskulptur, dem prägnanten Stadtkörper auf<br />
neutralem, sprich ungestaltetem, grünem Grund. In Wahrheit<br />
liegt aber die Landschaft längst nicht mehr vor der<br />
Stadt. Die Stadt liegt längst nicht mehr in der Landschaft:<br />
Alles ist Stadt. Alles ist Landschaft. Die überkommenen Klischeevorstellungen<br />
von Landschaft und Natur in der Stadt<br />
erweisen sich aus vielen Gründen als äußerst hartnäckig.<br />
Je dramatischer sich die Städte in den Augen der Gesellschaft<br />
verändern, desto mehr steigt das Verlangen nach traditionellen<br />
Freiraumtypologien, die das sichere Gefühl von<br />
Vertrautheit und beständiger Geborgenheit vermitteln.<br />
Hinter den altbekannten Freiraumkulissen verändert sich das<br />
öffentliche Leben jedoch gravierend, wird stärker kontrolliert,<br />
gesichert und gesteuert. In „Minority Report“, entstanden<br />
nach einer 1956 publizierten Kurzgeschichte von Philip K. Dick,<br />
gibt es keine unüberwachte Privatheit mehr. Der öffentliche<br />
Raum ist gespickt mit Netzhautscannern, die den Menschen<br />
überall und jederzeit identifizieren, ob beim Betreten eines<br />
öffentlichen Gebäudes, dem Benutzen der Metro oder<br />
während der Fahrt im privaten Magnetschwebefahrzeug.<br />
Die Vision von der totalen Überwachung des öffentlichen<br />
Raumes und die damit nach Meinung von Kritikern verbundene<br />
Gefahr restriktiver Nutzungsregulierung – sprich: Privatisierung<br />
des öffentlichen Raumes – scheint keineswegs<br />
übertrieben. Schon vor dem 11. September 2001 geriet der<br />
durchschnittliche Großstädter in Supermärkten, Kaufhäusern,<br />
Hotels, Tiefgaragen, Bahnhöfen und an vielen anderen
öffentlichen Orten in der Stadt etwa 20 Mal pro Tag ins<br />
Visier einer Überwachungskamera. Seit dem Anschlag auf<br />
das World Trade Center ist die alltägliche Überwachungsintensität<br />
im Interesse der öffentlichen Sicherheit noch<br />
gestiegen. Nie zuvor haben wir auf analogen und digitalen<br />
Speichermedien so viele Fährten hinterlassen und nie zuvor<br />
wurden diese Spuren so minutiös aufgezeichnet und ausgewertet<br />
wie heute.<br />
Es ist jedoch keineswegs so, dass die Menschen unter dem<br />
Verlust der Anonymität, unter der Privatisierung des öffentlichen<br />
Raumes oder unter der konstanten Observanz besonders<br />
leiden, stellt der amerikanische Journalist und Schriftsteller<br />
Gundolf S. Freyermuth fest – im Gegenteil: „Surrt die<br />
Kamera in der dunklen Tiefgarage oder vor dem nächtlichen<br />
Bankautomaten in unsere Richtung, fühlen wir uns beschützt.<br />
Die Dienstleistungsunternehmen, die Telefonnummern<br />
von Anrufenden automatisch mit Adresskarteien<br />
abgleichen, schmeicheln unserer Eitelkeit, wenn sie uns mit<br />
unserem Namen begrüßen“ (Freyermuth 1998). Spielbergs<br />
Szenario geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Jahr 2052<br />
identifizieren interaktive Reklamebildschirme in öffentlichen<br />
Einkaufspassagen und Plätzen mittels blitzschneller Augenscans<br />
jede Person schon von weitem und richten Ton- und<br />
Bildinformationen gezielt auf den vorbei eilenden Konsumenten<br />
aus. Was einst das Wesen des öffentlichen Raumes<br />
ausmachte, die zufällige, physische Begegnung mit Mitmenschen,<br />
wird durch die perfekte Simulation ersetzt. Der öffentliche<br />
Raum der Zukunft ist sicher, traditionell gestaltet, eigentumsrechtlich<br />
privatisiert und perfekt zugeschnitten auf<br />
unsere persönlichen Bedürfnisse – Traum oder Alptraum?<br />
Wir sind schon heute auf dem besten Wege, den öffentlichen<br />
Raum zur interaktiven Benutzeroberfläche für die<br />
moderne Informations- und Erlebnisgesellschaft umzugestalten.<br />
Eine ganze Industrie widmet sich unter dem Titel<br />
„Public Design“ der Entwicklung neuer, bevorzugt multifunktionaler<br />
Ausstattungsobjekte, Stadtmöblierungselemente<br />
und Informationskonsolen, die weder Fragen noch Wünsche<br />
der Stadtbewohner und -benutzer offen lassen und<br />
ganz nebenbei zur Animation vermeintlich toter öffentlicher Räume beitragen<br />
sollen. Technical toys nennt Steven Spielberg diese Objekte.<br />
Sie sammeln sich heute bevorzugt in jenen öffentlichen Räumen an, die<br />
gemeinhin als zu leblos, zu anonym und zu ungestaltet empfunden werden.<br />
Raummöblierung ist jedoch häufig nichts anderes als hilflose Symptombekämpfung<br />
und kann keine Öffentlichkeit erzeugen. Einseitig, wohnzimmernah<br />
betrieben, leisten sie der Privatisierung des öffentlichen Raumes<br />
sogar in zweifacher Hinsicht Vorschub: Erstens ist ein hoher Möblierungsstandard<br />
in der Erstellung und Pflege mit hohen finanziellen Aufwendungen<br />
verbunden, die die Kommunen so sehr überfordern, dass oft nur Privatisierung<br />
als Ausweg bleibt. Zweitens schränkt übertriebene Möblierung die<br />
Nutzbarkeit öffentlicher Räume so stark ein, dass sie ihrer eigentlichen<br />
Funktion als freie Bühne öffentlichen Lebens nicht mehr gerecht werden<br />
können. Doch genau solcher Bühnen bedarf es – auch in Zukunft.<br />
Entgegen der Vermutung, dass es in Adriaan Geuzes new type of city keine<br />
öffentlichen Parks und Plätze mehr gibt, weil man die Funktionen des Marktes,<br />
der Kommunikation, der Unterhaltung sowie der politischen Willensbildung<br />
effizienter im Cyberspace als im physischen Raum bedienen kann,<br />
schuf West 8 schon vor <strong>Jahre</strong>n in Rotterdam den hypermodernen Stadtplatz<br />
Schouwburgplein. Auch hier gibt es technical toys in beträchtlichen<br />
Abmessungen: individuell steuerbare, 35 Meter hohe Leuchtmasten und<br />
13 lange Sitzbänke am Rand der leicht erhöhten Platzfläche. Diese wenigen,<br />
aber kraftvollen Requisiten sollten die Zuschauer und Akteure zur uneingeschränkten<br />
Bespielung und entspannten Beobachtung der ansonsten wohltuend<br />
leeren städtischen Bühne einladen. Und das hat sich bewährt. Heute<br />
zählt der Platz, entgegen den Prophezeiungen der Kritiker und obschon teilweise<br />
privat finanziert, zu den lebendigsten öffentlichen Räumen der Stadt.<br />
Trotz abwechslungsreicher Fluchtmöglichkeiten ins Netzwerk der public<br />
domains und ungeachtet der zunehmenden, vorwiegend eigentumsrechtlichen<br />
Privatisierung öffentlicher Räume scheint also in der neuen Stadt<br />
noch ein beachtliches Quantum an lebendiger, sozialer und funktionaler<br />
Öffentlichkeit zu existieren. „Die Krise des öffentlichen Raumes ist in Wahrheit<br />
eine Krise des Gemeinwesens“, stellt Hanno Rauterberg treffend fest.<br />
„Der Streit um den öffentlichen Raum ist also in Wahrheit eine Ersatzdebatte,<br />
denn mehr als der Raum die Gesellschaft prägt, prägt die Gesellschaft ihren<br />
Raum“ (Rauterberg 2001). Städtischer Raum kann keine Öffentlichkeit<br />
erzeugen, sondern braucht eine lebendige, urbane Öffentlichkeit von gewisser<br />
Dichte und Vielfalt, für die er als Handlungsrahmen dienen kann. Insbe-<br />
43
sondere der städtische Platz, verstanden als alltäglich nutzbarer, zentraler<br />
Stadtraum, lebt von vielfältiger Dichte, muss aber auch die Inaktivität als<br />
Ruhephase im Rhythmus des pulsierenden Stadtlebens dulden und für den<br />
Stadtbewohner erträglich, ja sogar reizvoll gestaltet sein, ohne künstlich<br />
animiert zu wirken.<br />
Zugegebenermaßen ist dieser hohe Anspruch an die Gestaltung öffentlicher<br />
Stadträume nicht leicht zu erfüllen, insbesondere was die Ausformulierung<br />
qualitätvoller Leere, beruhigender Entschleunigung und entspannter Inaktivität<br />
anbelangt. Im Zeitalter digitaler Informations- und Bildströme werden<br />
Leere, Langsamkeit und Ruhe zwar einerseits zu raren Luxusgütern im privaten<br />
Raum. Andererseits wird die spürbare Leere und phasenweise Unbelebtheit<br />
öffentlicher Räume in der heutigen Gesellschaft schnell als unerträglich,<br />
ja sogar als bedrohlich empfunden und als Krise des öffentlichen Raumes<br />
problematisiert. Der Zürcher Landschaftsarchitekt Dieter Kienast sprach<br />
vom Zwang zu gestalterischer Reduktion, denn „die Reduktion hat [...] auch<br />
einen gesellschaftlichen Hintergrund: Die Anreicherung des Raumes geschieht<br />
von selbst, während wir Sorge dafür tragen müssen, den tragfähigen<br />
Rahmen zu schaffen“ (Kienast 1996/1999). Alltäglich zu beobachten ist<br />
hingegen eine immer stärkere, vermeintlich gestalterische Anreicherung und<br />
gelegentlich sogar Überfrachtung des öffentlichen Raumes.<br />
In kaum einer anderen Großstadt sind die öffentlichen Räume so perfekt<br />
nach dem Geschmack des Publikums animiert, so makellos gepflegt und<br />
ganz nebenbei auch noch so sicher und so konsequent in privatem Besitz,<br />
wie in der ersten Stadt des 21. Jahrhunderts, in Las Vegas. Selbst wenn es,<br />
was allerdings sehr selten vorkommt, einmal ruhiger wird in den seltsam<br />
vertraut erscheinenden Straßen und auf den pittoresken Plätzen dieser Entertainment-Oase,<br />
wird dies kaum wahrgenommen, weil der animierte Raum<br />
ein ausgeprägtes Eigenleben führt und nahezu keine menschlichen Akteure<br />
zu brauchen scheint. Statt Akteuren bevölkern Konsumenten die Räume<br />
dieser Wüstenstadt. In Europa sind Inszenierungen solchen Ausmaßes noch<br />
selten, doch die Furcht vor leblos erscheinenden öffentlichen Räumen in<br />
schrumpfenden Städten und die Sehnsucht nach wieder erkennbaren Orten<br />
in leerer werdenden Stadtkernen führt auch hier zur vermehrten Entstehung<br />
perfekt inszenierter Malls, wohnlich gestalteter Einkaufspassagen und vollklimatisierter<br />
Freizeitparks, bevorzugt im exotischen Tropenlook. In diesen<br />
Räumen ist die Öffentlichkeit vollkommen unter Kontrolle – nur zur Sicherheit<br />
des zahlenden Publikums, versteht sich. Die Gesellschaft prägt ihre neuen<br />
öffentlichen Räume – in der Tat!<br />
44<br />
Trotz Bevölkerungsrückgang, Stadtschrumpfung und Stadtperforation<br />
schreitet in Mitteleuropa der Prozess der Urbanisierung<br />
unaufhaltsam voran. Es wachsen aber vor allem die<br />
suburbanen Räume, in denen sich ein Teil der Gesellschaft<br />
den trügerischen Traum jener neuen Beschaulichkeit inszeniert,<br />
den sie in der vermeintlich unwirtlichen Stadt nicht<br />
mehr zu finden vermag. Im periurbanen Raum führt das<br />
Fehlen städtischer Dichte zur Entstehung eines neuen<br />
öffentlich nutzbaren Freiraumtypus, der auch dann noch<br />
erträglich wirken soll, wenn sich kaum ein Mensch darin<br />
aufhält: begrünte Plätze und platzartige Parks, also Hybride<br />
zwischen Park und Platz, wie zum Beispiel in der EXPO-Siedlung<br />
am Kronsberg in Hannover.<br />
Die Landschaftsarchitekten Lohaus und Carl suchten 1996<br />
bei ihrer Planung für die beiden Quartierparks in Hannover-<br />
Kronsberg bewusst den Bezug zu squares, den begrünten<br />
Londoner Schmuckplätzen des 18. Jahrhunderts. Die ausgewiesenen,<br />
knapp 1,0 und 1,4 Hektar großen Flächen<br />
erachteten sie für Parks als zu klein. Andererseits wären<br />
Plätze solcher Dimension in dieser periurbanen Situation<br />
angesichts der geringen funktionalen und physikalischen,<br />
politischen und sozialen Dichte nicht überlebensfähig gewesen<br />
und hätten menschen- und möglicherweise sinnentleert<br />
gewirkt. Die neuen Quartierparks am Kronsberg<br />
wurden angelegt, um genau wie die altenglischen squares<br />
als grüne Mitten Intimität und Lebendigkeit auszustrahlen.<br />
Diese Hybride zwischen Park und Platz sollten den Anwohnern<br />
im neuen, noch eigenschaftslosen Stadtteil von Anfang<br />
an identitätsstiftende Orte sein.<br />
Zwei gegensätzliche formale Konzepte charakterisieren<br />
diese beiden Anlagen. Eine Bauminsel, eingelagert in eine<br />
annähernd quadratische Platzfläche, prägt den Quartierpark<br />
Nord. Im Gegensatz dazu präsentiert sich der Quartierpark<br />
Mitte als Waldlichtung in einem dicht gepflanzten Hain<br />
aus Mehlbeerbäumen. Im suburbanen Raum versprechen<br />
die Hybride beides: das Idealbild schöner Natur als Zitat von<br />
Landschaft in der Stadt. Dies ist auch dann zu genießen,<br />
wenn man sich alleine darin aufhält, denn Bäume und
Sträucher „bevölkern“ den Ort. Zugleich verspricht das Zitat<br />
vom Platz eine „gefühlte“ Öffentlichkeit und verheißt gutes,<br />
kulturell reichhaltiges städtisches Leben, ganz egal, wie<br />
lebendig die Öffentlichkeit in den angrenzenden Stadtquartieren<br />
tatsächlich ist.<br />
Solche Hybride sind im übertragenen Sinn transparente<br />
Gebilde und lassen unterschiedliche Lesarten zu. Vordergründig<br />
betrachtet scheinen sich zwei traditionell positiv<br />
besetzte städtische Freiraumelemente auf verblüffend einfache<br />
Weise miteinander zu verbinden. Vielleicht tauchen<br />
sie gerade deshalb seit einigen <strong>Jahre</strong>n in verschiedenen<br />
Variationen auf: Der Parc del Clot von Dani Freixes und<br />
Vicente Miranda in Barcelona, die Place de la Bourse von<br />
Alexandre Chemetoff und der Jardin Caille von Christine<br />
Dalnoky und Michel Desvignes – eigentlich Hybride aus Platz<br />
und Garten – in Lyon, der Platz der Einheit in Potsdam von<br />
WES und Partner, der Invalidenpark in Berlin von Christophe<br />
Girot und schließlich die neuen Quartierparks in Zürich-<br />
Oerlikon, insbesondere der Oerliker Park von Zulauf,<br />
Seippel und Schweingruber sowie der MFO-Park von<br />
Burckhardt und Partner mit Raderschall Landschaftsarchitekten<br />
sind einige europäische Beispiele aus den vergangenen<br />
zwei Jahrzehnten.<br />
Park und Platz zählen längst zu vereinheitlichenden Begriffen<br />
mit breiter thematischer Vielfalt. Infolge eines inflationären<br />
Gebrauchs haben sie ihre spezifische Aussagekraft<br />
verloren und werden deshalb gerne in neuen Kombinationen<br />
als Reizauslöser in unserer „Multioptionsgesellschaft“<br />
benutzt. Für solche hybriden Typologien, die die ersten<br />
Vokabeln einer neuen freiraumgestalterischen Sprache sein<br />
können, werden irgendwann neue Bezeichnungen zu prägen<br />
sein: wie zum Beispiel „urbane Hybridräume“ – eine<br />
Bezeichnung, die dem Umstand Rechnung trägt, dass sich<br />
neue Freiraumtypen in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten,<br />
Architekten und Stadtplanern entwickelt haben<br />
und deren Entstehung nicht nur auf einen tiefgreifenden<br />
Wandel im heutigen Natur- und Landschaftsverständnis<br />
zurückzuführen ist, sondern auch auf den Bedeutungswandel<br />
urbaner Öffentlichkeit.<br />
Der von der romantischen Natursehnsucht im späten 19. Jahrhundert ausgelöste<br />
und gegenwärtig durch die digitale Bildflut angeheizte Hunger der<br />
Industriegesellschaften nach idyllischen Bildern von unberührter, harmonisch<br />
gestalteter Natur und die Sucht nach immer neuen Freizeitoptionen ist<br />
mit traditionellen Stadtparkkonzepten nicht mehr zu stillen. Ebenso wenig<br />
ist von neuen suburbanen Stadtplätzen zu erwarten, dass sich darin noch<br />
das öffentliche Leben in gewohnter Weise widerspiegelt. Das überkommene<br />
Bild städtischer Öffentlichkeit ist längst durch neue Arten des Raumgebrauchs<br />
in Frage gestellt und muss neu definiert werden. „So wäre es<br />
auch möglich“, schreibt Klaus Selle, „unbelastet vom kulturpessimistischen<br />
Postulat des ‚Verfalls und Endes des öffentlichen Lebens’ (vgl. Sennett 1998)<br />
zeitgemäße Funktionen und Nutzungsformen öffentlicher Räume zu entdecken<br />
und nach Folgerungen für Planung, Bau oder Pflege und Entwicklung<br />
zu fragen [...]“ (Selle 2002). Der urbane Hybridraum, jener dialektische,<br />
transparente Ort zwischen Park und Platz, Alt und Neu, Natürlichkeit und<br />
Künstlichkeit entzieht sich der eindeutigen Lesbarkeit und ist womöglich<br />
gerade deshalb als zeitgemäßer Freiraumtyp weiter zu entwickeln.<br />
Literatur<br />
Freyermuth, G. S.: „Warum hast Du so große Ohren?“<br />
in Neue Zürcher Zeitung Folio. Juli 1998<br />
Geuze, A.: „Moving beyond Darwin“.<br />
in Knuijt, M., Ophuis, H., Van Saane, P. (Hg.): Modern Park Design. Recent Trends.<br />
Amsterdam 1993<br />
Kienast, D. zitiert aus: Weilacher, U.: Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art.<br />
Basel / Berlin / Boston 1996/1998<br />
Rauterberg, H.: „Drinnen ist draußen. Draußen ist drinnen. Hat der öffentliche Raum noch eine<br />
Zukunft?“ in Deutsches Architektenblatt. Februar 2001<br />
Selle, K.: „Stadt und öffentlicher Raum. Thema mit Variationen.“<br />
in Kornhardt, D., Pütz, G., Schröder, T. (Hg.):<br />
Mögliche Räume. Stadt schafft Landschaft. Hamburg 2002<br />
Spielberg, S.: Deconstructing Minority Report. Twentieth Century Fox 2002<br />
45
Ernst Hubeli<br />
Öffentlichkeit befand und befindet sich in einem permanenten Strukturwandel;<br />
das Gleiche gilt für den öffentlichen Raum. Ist das, was wir mit öffentlichem<br />
Raum bezeichnen, überhaupt öffentlich? Von welcher Art von Öffentlichkeit(en)<br />
muss man heute sprechen?<br />
Darauf gibt es keine einfachen Antworten. Mit der elektronischen Öffentlichkeit<br />
und ihrer weltweiten Vernetzung durch das Internet ist eine hybride<br />
Konstellation entstanden, die einen historischen Bruch mit traditionellen<br />
Formen und Inhalten von Öffentlichkeit bedeutet. Es existieren heute Gleichzeitigkeiten<br />
von privaten und öffentlichen Sphären, von lokalen Kulturen<br />
und einer globalen Hyperkultur, von Zeit und Nicht-Zeit, von medialer und<br />
wirklicher Wirklichkeit, von realem und virtuellem Raum.<br />
Der mediale Modernisierungsschub stößt aber auch auf Ablehnung und<br />
weckt die Sehnsucht nach einer vergangenen, überblickbaren Öffentlichkeit.<br />
Diese dialektische Situation ist gekennzeichnet durch unberechenbare<br />
und dynamische Wechselwirkungen zwischen der irreversiblen Umwertung<br />
von Raum und Zeit und einem mehr oder weniger schnellen Ablösungsprozess<br />
von der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie wir sie kennen.<br />
Diese Wechselwirkungen äußern sich zunächst in neuen Formen von Öffentlichkeit,<br />
die sehr unterschiedliche Phänomene spiegeln. Einige sollen einleitend<br />
den Strukturwandel veranschaulichen, um ihn im Hinblick auf<br />
eine Theorie und Praxis für den Städtebau und die Architektur zu erörtern.<br />
Der Beitrag enthält hierzu einige zusammenfassende Gedanken und<br />
Schlussfolgerungen.<br />
46<br />
Von der Öffentlichkeit zu einem Universum<br />
von Teilöffentlichkeiten<br />
Phänomen 1: Individualisierung und neue Kollektoren<br />
Ein wichtiger Ausgangspunkt des Strukturwandels des<br />
Öffentlichen ist das Private. Mit der veränderten beruflichen<br />
Stellung der Frau, der Liberalisierung des Eherechts und den<br />
zunehmend vernetzten und flexiblen Arbeitsweisen hat sich<br />
das Grundverständnis des Privaten gewandelt, ist heterogen<br />
geworden. Auch die lange Zeit gültigen gesellschaftlichen<br />
Standards bezüglich der „richtigen” Lebensweisen sind aufgeweicht<br />
worden oder gar in Auflösung begriffen. Was mit<br />
der Individualisierung der Gesellschaft umschrieben wird,<br />
hat sich in demographischen und kulturellen Veränderungen<br />
längst manifestiert.<br />
In den meisten europäischen Städten ist der Anteil traditioneller<br />
Familienhaushalte auf 15 bis 20 Prozent geschrumpft,<br />
während sich gleichzeitig unüberblickbar vielfältige Formen<br />
von Single- und Paarhaushalten entwickelt haben. Damit<br />
einher geht die Suche nach dem eigenen Lifestyle; sie hat<br />
eine befreiende, aber auch eine repressive Dimension. Mit<br />
der zunehmenden Heterogenität der Lebensweisen ist eine<br />
Enthierarchisierung von Kultur verbunden: Was oben und<br />
unten, was vorne und hinten ist, lässt sich kaum mehr<br />
sagen. Andererseits ist ein fast zwanghaftes Bedürfnis nach<br />
Einzigartigkeit entstanden, das eine globale Identitätsindustrie<br />
verwertet und verdinglicht. Ihre Waren werden mit dem<br />
Versprechen angepriesen, dass Stil und Identität käuflich<br />
sind: ich Armani, du Prada, es Comme de Garçons.<br />
Parallel zu dieser „Massen-Individualisierung” sind aber auch<br />
Massenereignisse und urbane Groß-Events bedeutender<br />
geworden. Man kann vermuten, dass sie ein gleichzeitiges<br />
Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach Öffentlichkeit bedienen:<br />
Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht hier von einer<br />
Sehnsucht nach neuen „Kollektoren” und von einer „Stadien-<br />
Renaissance”.
Phänomen 2: privat – öffentlich, öffentlich – privat<br />
Die Ausbreitung von außerfamiliären und temporären<br />
Gemeinschaften hat umgekehrt das Private verändert, das<br />
nun auch kollektive Formen annehmen kann. In den Privatraum<br />
dringt elektronische Öffentlichkeit, die Privates als<br />
öffentliche Angelegenheit inszeniert. Intime Probleme<br />
erscheinen am Bildschirm als kollektives Schicksal, das –<br />
medial zubereitet – sich zum emotionalen Globalkitt verdichtet.<br />
Der privat-öffentlichen stehen öffentlich-private Formen<br />
elektronischer Öffentlichkeit gegenüber. Ein Beispiel dafür<br />
ist eine Fußballsendung in Italien, die als Alternative zum<br />
Pay-TV entstanden ist. Sie hat unerwartet hohe Einschaltquoten<br />
eingespielt, was man zunächst auf die unentgeltliche<br />
Übertragung des Spiels zurückgeführt hat. Doch der<br />
eigentliche Grund war ein anderer.<br />
Bei der sonntäglichen Live-Übertragung sieht man nicht das<br />
Spiel, sondern einen aufgeregt kommentierenden, permanent<br />
schreienden Reporter, der – immer nahe am Herzinfarkt<br />
– von einer blonden Assistentin regelmäßig zu besänftigen<br />
versucht wird. Die wirkliche Attraktion der Sendung ist<br />
die Herausforderung, eigene Deutungsarbeit leisten zu müssen<br />
bzw. dies zu dürfen. Die Rede über das Spiel kann nämlich<br />
wichtiger sein als das Spiel selbst. Das Unsichtbare lässt<br />
viele Deutungen zu, so dass Spiele im Spiel entstehen.<br />
Im Zusammenhang mit Literatur und Kunst haben Roland<br />
Barthes, Michel Foucault und Umberto Eco schon früh auf<br />
den Rollenwechsel zwischen Autor und Leser hingewiesen.<br />
Die postavantgardistische These besteht darin, dass ein<br />
Werk erst durch Deutung vollendet wird. Ähnliches meint<br />
der gängige Begriff „Interaktion“. Er bezeichnet in kommunikativer<br />
wie kultureller Hinsicht ein strukturierendes und<br />
vor allem konstitutives Element von Öffentlichkeit, nicht nur<br />
im Fußball, sondern auch in der modernen Kunst, in der<br />
digitalen Spielewelt, nahezu überall.<br />
Phänomen 3: Reproduktionen von Reproduktionen<br />
Die Medialisierung der Alltagswelt schafft auch neue Verhältnisse zu den<br />
Räumen und zu den Landschaften. Was ist ein wirklicher Raum, was ein fiktiver,<br />
was ein virtueller? Welche Landschaft ist natürlich, welche künstlich?<br />
Auf den Werbetafeln von Marlboro sind die Rocky Mountains abgebildet.<br />
Es handelt sich dabei um die atmosphärische Nachahmung einer Filmszene<br />
aus „Wyatt Earp“, also um die Reproduktion einer Reproduktion.<br />
In den 1990er <strong>Jahre</strong>n ist auch ein Architekturgenre entstanden, das sich an<br />
den Arbeitsweisen der globalen Werbebranche orientiert: Die mediale Wirkung<br />
ist wichtiger als das reale Objekt. Das Guggenheimmuseum in Bilbao<br />
war 1997 das erste Beispiel dieses Genres. Das Gebäude wurde als eine einzigartige<br />
Form für den globalen Bildschirm entworfen, als medialer „Oberflächenknall”<br />
und heiteres Architekturerlebnis.<br />
Was für die Werbung und ihre Wirkmechanismen gelten mag, trifft für die<br />
Architektur allerdings nur bedingt zu: Die Ökonomie der Aufmerksamkeit<br />
hat dort ihre eigenen Gesetze. Die Entmaterialisierung von Objekten und<br />
Produkten suggeriert zwar, dass alles machbar und möglich ist, auch eine<br />
Architektur mit Voodoo-Zauber. In Wirklichkeit verschleißt sich die Suggestivkraft<br />
aber sehr rasch, so wie die Bilder, welche die Medien durchfluten.<br />
Eine Wiederholung ist nicht möglich; der Zwang, immer das Neue zu finden,<br />
das sich zugleich zerstört, ist eben auch eine (Medien-)falle. In sie ist die<br />
globale Architektur hineingefallen und darin zur „Wurlitzerorgel der Form“<br />
geworden. Für das Tempo der Bilder und die mediale Entmaterialisierung,<br />
die eben auch wörtlich gemeint sind, ist die Architektur offenbar ein ungeeignetes,<br />
viel zu träges Medium.<br />
47
Phänomen 4: Hybride<br />
Da mediale Effekte virtuell sind, öffnen sie schier unbegrenzte Projektionsflächen.<br />
Die Steigerung besteht nun darin, sie auch zu verräumlichen. Der<br />
Bildschirm wird dreidimensional auf den künstlichen Raum ausgeweitet,<br />
was das Spektrum möglicher Reproduktionen und Mehrfachcodierungen<br />
von Bildern und Atmosphären potenziert. Voraussetzung dafür sind räumliche<br />
Einkapselungen: In ihnen lösen sich Unterschiede von Kultur und Produkt,<br />
von Geschichte und Gegenwart auf. Kunst, Natur, Lifestyle, Schokolade<br />
und Musik verschmelzen in einem einzigen Allerwelt-Event. Ein solches<br />
Event kann überall stattfinden, in ausgehöhlten Altstadtkernen oder in<br />
Großcontainern an leistungsfähigen Verkehrsknoten. Egal, ob es sich um<br />
Erlebniszentren, Einkaufswelten, temporäre Städte oder Discos handelt, ihre<br />
gemeinsame Eigenschaft ist ihre Entortung: Sie können überall entstehen<br />
und genau so wieder verschwinden.<br />
Sie sind, unabhängig davon, ob man sie noch als öffentliche Räume oder<br />
bereits deren Privatisierung betrachtet, zunächst einmal unhintergehbare<br />
Bestandteile der zeitgenössischen Stadt. Vor allem in den unübersichtlichen<br />
Agglomerationen und Großstadtregionen bilden Einkaufs- und Erlebniszentren<br />
neue Orientierungspunkte „…im gleichförmigen Durcheinander, [...]<br />
wo Halluzinationen und Gedächtnisstörungen auftreten, wo Bilder nichts<br />
vermitteln können. Solche Orte bieten Wiedererkennungseffekte und Identifikationsangebote<br />
– als homogener Raum im unlesbaren Großraum“<br />
(Voeckler, 2001). Sie sind „Volkscontainer”, neue kollektive Orte, die eindeutig<br />
lokalisierbar sind, auch wenn das jeweilige Event überall und überall<br />
ähnlich, wenn auch nicht gänzlich gleich, stattfinden könnte.<br />
Das Paradox besteht in der Gleichzeitigkeit von Ort und Ortlosigkeit, von<br />
Zeit und Nicht-Zeit. Diese Raumkonstellation entspricht einem Hybrid. In<br />
einem solchen Hybrid muss nun nicht zwangsläufig eine Privatisierung von<br />
öffentlichem Raum gesehen werden, sondern eher eine typologische Erweiterung<br />
von öffentlichen Orten, die an Foucaults Begriff der Heterotopie<br />
erinnert – unter dem Vorbehalt allerdings, dass solche Hybride keine privatpolizeiliche<br />
Observation und flächendeckende Ambiente-Regulationen voraussetzen.<br />
Insofern ist der geschützte und kontrollierte Raum nur eine unter<br />
mehreren Varianten eines Hybrids, die Variante, in der sich die mehr oder<br />
weniger Anständigen eben die „elektronischen Engel“ wünschen.<br />
Phänomen 5: Urbanität ist unsichtbar<br />
Gälte es, das Gegenmodell zur kontrollierten Öffentlichkeit in den Erlebniswelten<br />
zu benennen, dann wären dies die unsichtbaren Sphären von<br />
Öffentlichkeit. Ein Beispiel dieser anderen Öffentlichkeit manifestierte die<br />
Jugendbewegung von 1980 in Zürich, eine urbane Revolte, die gegen die<br />
kontrollierte, sozial-räumliche Organisation von Öffentlichkeit aufbegehrte,<br />
die die Jugendlichen als das genaue Gegenteil von Urbanität empfanden.<br />
Hinter verschlüsselten oder ironischen Parolen wie „Wir machen aus dem<br />
Staat Gurkensalat“ oder „Zürich gibt Dir eine Lebensversicherung und<br />
nimmt Dir das Leben“ stand eine bewusste Strategie: Die Revolte sollte politisch<br />
nicht identifizierbar und anonym bleiben, um sich dem sozialpädagogischen<br />
Zugriff zu entziehen. Die Provokationen zielten gegen einen Sozialstaat,<br />
der mit vorausschauender Bevormundung seine Schutzfunktion längst<br />
überschritten hatte.<br />
48<br />
Die urbane Revolte definierte den urbanen Raum ex negativo:<br />
gegen die Trostlosigkeit eines Territoriums, in dem Verhübschungen<br />
und Verniedlichungen wie Verordnungen<br />
aus einem festen Regelwerk von Architektur, Identität und<br />
Authentizität wirkten. Wer planerische und gestalterische<br />
Überschüsse produzierte, so die Lektion, hatte das Gelände<br />
verfehlt, weil er den urbanen Fluss verdickte.<br />
Die Technoszene war in ihren Anfängen, zumindest teilweise,<br />
eine Reaktion auf die Jugendbewegung der 80er <strong>Jahre</strong>.<br />
Anfang der 1990er <strong>Jahre</strong> erfanden Raver, vor allem in Seattle<br />
und Zürich, eine ihnen eigene Öffentlichkeit. Sie spürten<br />
Niemandsländer auf, Durchgangsräume, Fahrradtunnels,<br />
die sie mit körperlicher Selbstinszenierung und autorenloser<br />
Musik aufluden. Dabei stand nicht die Politisierung des<br />
öffentlichen Raumes im Vordergrund, sondern die Form der<br />
Aneignung: die Verwandlung von Nicht-Orten in öffentliche<br />
Orte auf Zeit. Die politischen Provokationen der urbanen<br />
Revolte der 1980er <strong>Jahre</strong> haben die Raver durch Wünsche<br />
ersetzt, die unmittelbar erfüllbar waren.<br />
Die Jugendbewegungen der 80er und 90er <strong>Jahre</strong> lassen die<br />
von Marc Augé gebrandmarkten Non-Lieux in einem anderen,<br />
gar gegensätzlichen Licht erscheinen. Nicht-Orte sind<br />
eine Attraktion, weil sie nichts repräsentieren, keine Macht,<br />
keine Ausgrenzung. Es sind Orte symbolischer Abwesenheit<br />
oder Orte mit austauschbaren Symbolen; Orte ohne Adressen,<br />
wo (noch) nichts geschieht.<br />
Orte des (Fast-)Nichts sind Orte der Potenziale. Ihre Unbestimmtheit<br />
kontrastiert die bürgerliche Öffentlichkeit mit<br />
ihren Repräsentationsfunktionen. Sie veranschaulichen den<br />
Ablösungsprozess zu heterogeneren, wenig hierarchisierten<br />
und instabilen Teilöffentlichkeiten. Ausdruck davon sind<br />
mitunter alltägliche, ungeplante öffentliche Räume: Zwischenräume,<br />
Kioske, Waschsalons und Tankstellen, die<br />
heute den Stellenwert von bedeutenden öffentlichen Orten<br />
haben; Räume, die Teilöffentlichkeiten konstituieren, nachdem<br />
die eine Öffentlichkeit nur noch Fiktion ist (und möglicherweise<br />
auch immer schon war).<br />
Ist Öffentlichkeit, sind öffentliche Räume zerstört?<br />
Die Frage ist der Dauerbrenner des Theoriediskurses. Unbestreitbar<br />
ist, dass sich die Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert<br />
in viele soziale Schichten, mittelständische und andere,<br />
auch nicht qualifizierbare Gruppen und Szenen ausdifferenziert<br />
und dass sich die bürgerliche Öffentlichkeit in viele Teilöffentlichkeiten<br />
zersplittert hat. Dazu gehört auch die elektronische<br />
Öffentlichkeit, die an sich und mit der Einführung<br />
des Internets heterogener geworden ist.<br />
Wird nun, so die Kardinalfrage der Debatte, Öffentlichkeit<br />
zwangsläufig in banale oder private Formen verwandelt und<br />
zerstört oder entwickelt sich daraus etwas anderes, etwas<br />
Unbekanntes?
„Der Strukturwandel der Öffentlichkeit” von Jürgen Habermas,<br />
geschrieben in den1960er <strong>Jahre</strong>n, und „Der Verfall der Öffentlichkeit.<br />
Die Tyrannei der Intimität” von Richard Sennett aus<br />
den 1980er <strong>Jahre</strong>n sind bis heute die Klassiker, die sich mit der<br />
Frage ausführlich befasst haben. Sennetts Kernthese besteht<br />
in der Dialektik zwischen Intimität und Geselligkeit: „Je mehr<br />
die Psyche ins Private gedrängt wird, desto weniger wird<br />
sie stimuliert…”. Die Distanz zwischen den Menschen geht<br />
verloren – sie gehen auf Tuchfühlung. „Die Menschen sind<br />
aber, umso geselliger, je mehr greifbare Barrieren zwischen<br />
ihnen liegen“. Wenn die Distanz verloren geht, entsteht der<br />
„Fetisch der Gemeinschaftlichkeit“. Eine Gemeinschaft ist<br />
„eine pervertierte Brüderlichkeit”, die auf den Ausschluss<br />
von Außenseitern und Fremden angewiesen ist. „Gemeinschaft<br />
und Gesellschaft ist ein Gegensatz”, so wie latenter<br />
Rassismus und soziale Integration, welche die urbane Tradition<br />
in Europa prägt.<br />
Habermas beklagt den Verlust der direkten öffentlichen<br />
Kommunikation, was auch den Verlust eines rationalen Diskurses<br />
und Kritik bedeute. Die elektronischen Massenmedien<br />
ermöglichen zwar, dass die Kulturgüter einem breiten Publikum<br />
zugänglich werden, sie werden aber auch zur Ware.<br />
Die leichtere Zugänglichkeit verlangt eine Entqualifizierung<br />
und Simplifizierung. Geschmacksfragen dominieren schließlich<br />
die Kultur. Habermas meint, dass die Teilnahme des<br />
Publikums nur scheinbar geschieht. In Wirklichkeit bemächtigen<br />
sich die Massenmedien der öffentlichen Sphäre. Der<br />
öffentliche Raum wird „halbiert“, indem die Bürger passiv<br />
sein müssen. Diese Medialisierung führe unter anderem zur<br />
Verwandlung gesellschaftlicher Kategorien in psychologische,<br />
zur Intimisierung von Sachen und Personen durch<br />
Starkult, zur Ablösung der öffentlichen Auseinandersetzung<br />
durch Unterhaltung. In der Öffentlichkeit wird schließlich<br />
um die „Herrschaft über die Herrschaft der nicht-öffentlichen<br />
Meinung“ gerungen. In der Konsequenz führt diese<br />
Öffentlichkeitsarbeit von oben zu einer „Refeudalisierung<br />
der Öffentlichkeit”.<br />
Abgesehen davon, dass in den letzen 20 <strong>Jahre</strong>n ein weiterer<br />
Strukturwandel der Öffentlichkeit stattgefunden hat (Globalisierung,<br />
Internet u.a.), steht weniger die Frage im Vordergrund,<br />
ob die erwähnten Kernthesen richtig oder falsch<br />
sind, sondern ob der Fokus sich nicht auf ein spezifisches<br />
Spektrum von Öffentlichkeit beschränkt.<br />
Es gehört zu einem wesentlichen Merkmal des aktuellen<br />
Strukturwandels, dass sich in den letzten Jahrzehnten Öffentlichkeiten<br />
konstituiert haben, welche die traditionellen, soziologischen<br />
und politischen Bewertungen unterlaufen –<br />
also öffentlich sind, ohne dass sie sich über Diskurse, Kritik<br />
oder Gemeinschaften definieren. So gibt es, um im Jargon<br />
der kritischen Theorie zu bleiben, eine Dialektik der Dialektik,<br />
die der Adorno-Schüler Rudolf Lüscher metaphorisch mit<br />
einer Comicfigur beschrieben hat (ursprünglich aus dem Zusammenhang<br />
mit dem Fordismus): Krümelmonster unterminieren gesellschaftliche Trends,<br />
kapitalistisches Kalkül, Manipulationen und Disziplinierungsmodelle, so dass<br />
sie keineswegs flächendeckend wirken. Das entspricht etwa dem (scheinbaren)<br />
Paradox, dass die Unterschicht das „Unterschicht-Fernsehen” nicht mehr<br />
sehen will, seit es als solches gilt.<br />
Der zweite Einwand bezieht sich auf den Kulturpessimismus, den Habermas<br />
und Sennetts Thesen durchdringen. Er äußert sich in einer unausgesprochenen<br />
Beschönigung oder gar Verherrlichung vergangener Öffentlichkeit. Sie<br />
wurde im 19. Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrundert vom Bourgeois<br />
und vom Bildungsbürgertum beherrscht. So besteht die Gegenthese darin,<br />
dass erst mit der post-bürgerlichen Öffentlichkeit sich Öffentlichkeit entfalten<br />
konnte, insbesondere ihre emanzipatorischen Ansprüche. Mit anderen Worten:<br />
Öffentlichkeit zerstört sich auch selbst, allein durch den Umstand, dass<br />
sie nicht mehr öffentlich ist.<br />
Wie konstituiert sich Öffentlichkeit heute?<br />
Öffentlichkeit hat sich also in ein fast unüberblickbares Universum von Teilöffentlichkeiten<br />
aufgefächert: Sie sind transitorisch, reflexiv, atomisiert,<br />
trivial oder gescheit. Sie entstehen nicht nur über Politik und Diskurs, sondern<br />
vermehrt über Freizeit, Sport, Moden und anderem. Die traditionelle bürgerliche<br />
Öffentlichkeit ist natürlich nicht verschwunden – sie hat nur ihre Leitfunktion<br />
verloren.<br />
Durch diese Enthierarchisierung ist unklar, was in der Öffentlichkeit als Oben<br />
und Unten gilt und überhaupt, was öffentlich ist und was nicht. Es gibt<br />
auch kein verbindliches Interpretationszentrum, das die Welt für alle erklärt.<br />
Auch Medienmonopole müssen sich oft selbst in Frage stellen, um noch<br />
angehört zu werden.<br />
Mit dem Bedeutungsverlust bürgerlicher Öffentlichkeit ist auch die Perspektive<br />
einer alles zentrierenden Öffentlichkeit, einer Art verbindlichen Interpretationszentrums,<br />
verschwunden. Es existieren viele verschiedene, oft parallele<br />
Öffentlichkeiten, Mikro-Öffentlichkeiten, die sich eben nicht mehr zu einem<br />
übergeordneten Diskurs zusammenfügen lassen.<br />
In diesem Zusammenhang hat auch Habermas These, dass Öffentlichkeit<br />
vom Bildschirm verschluckt wird, Beweisnot. Viele empirische Studien belegen,<br />
dass die mediale Öffentlichkeit die physisch-räumliche nicht einfach<br />
ersetzt. Sie wird auch nicht als Ersatz empfunden. Es sprechen viele Indizien<br />
dafür, dass die Medien weitgehend botschaftslos funktionieren und eben<br />
keinen Ersatz für urbane Öffentlichkeit sein können. Das ist vermutlich ein<br />
Grund, wieso die Kneipen in ganz Europa geboomt sind. Eine Forschung<br />
hat bestätigt, dass Kneipenbesucher im Vergleich zu Pantoffelhelden ein<br />
ausgesprochen kritisches Verhältnis zu den Massenmedien haben, im Besonderen<br />
zur manipulierten Meinungsbildung. So findet Habermas „halbierte<br />
Öffentlichkeit“ in der Kneipe die konkrete Gegenthese.<br />
49
Was ist Öffentlichkeit, was öffentlicher Raum?<br />
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Zusammenbruch von der bürgerlichen<br />
Öffentlichkeit sich als deren Erneuerung erwiesen hat.<br />
Öffentlichkeit ist trotz dieser Tendenz zu separierten Teilöffentlichkeiten<br />
natürlich nach wie vor eine spezifische Form gesellschaftlicher Kommunikation<br />
und damit anders als jede private, intime Kommunikation – oder (in<br />
Anlehnung an Wittgenstein): Öffentlichkeit gibt es schon alleine deshalb,<br />
weil es keine Privatsprache gibt, die jemand nur mit sich selbst spricht.<br />
Öffentlichkeit als Kommunikation ist nun nicht einfach herstellbar – weder<br />
institutionell noch mit Architektur oder Animation. Mit Öffentlichkeit ist<br />
also die Ungewissheit verbunden, ob sie überhaupt stattfindet, zugleich<br />
aber auch die Erwartung, dass sie stattfindet. Dieses Phänomen entspricht<br />
der doppelten Kontingenz: Für die einen beruhigt die unruhige Öffentlichkeit<br />
die gesellschaftliche Unruhe und für die anderen beunruhigt sie bloß die<br />
an sich ruhige Gesellschaft.<br />
Das Gleiche gilt für den öffentlichen Raum: Er bildet allenfalls einen Rahmen –<br />
die (zumeist) versteinerte Form eines möglichen Gegenübers der Verständigung,<br />
das entsprechende Erwartungen an Kommunikation, an kommunikatives<br />
Handeln weckt. Dem öffentlichen Raum ist dieses Selbstverständnis<br />
von Öffentlichkeit gewissermaßen eingeschrieben.<br />
50<br />
Öffentliche Räume sind deshalb nicht einfach Räume, die<br />
allen zugänglich sind; sie verweisen auf eine erwartbare<br />
Öffentlichkeit, eine mögliche Kommunikation. Dieser Aspekt<br />
des Verweisens ist das, was man als Selbsttransparenz der<br />
Öffentlichkeit bezeichnen kann; er kann sich freilich auch als<br />
reine Projektion äußern, etwa dann, wenn der touristische<br />
Blick über die Piazza von Siena schweift und von der romantischen<br />
Fernsicht überblendet wird – mit dem Vergangenheitstraum<br />
von einer überblickbaren, damit kontrollierten<br />
Öffentlichkeit, dem Gegenteil der heutigen elektronischen<br />
Öffentlichkeit mit ihrer physisch-räumlichen Abwesenheit.<br />
Selbsttransparenz, die gegenwartsbezogen und real ist,<br />
meint Orte oder Räume, die gegenüber dem normalen<br />
Lebensraum Gegenplatzierungen darstellen. Es sind Orte,<br />
wo Kultur gegenwärtig ist, bestritten und gewendet wird.<br />
Der öffentliche Raum wird zum Ort des öffentlichen Lebens:<br />
wenn er die Differenzen zum Privaten bewusst macht; wenn<br />
er als Ort der Überschreitung wirkt. Wer ihn übertritt, wird<br />
nicht nur anderen begegnen, er wird selbst zum anderen.<br />
Wenn die private Existenz gegenwärtig, aber unwirklich ist,<br />
wenn die eigene Geschichte als bloßer Entwurf erscheint,<br />
wenn der öffentliche Raum sich zur Arena rundet, wo der<br />
Lebenskampf sich im Spiel auflöst.<br />
Gälte es, eine Architektur der Öffentlichkeit zu bezeichnen,<br />
dann wäre es der de-programmierte Raum. Er ist weder<br />
ästhetisch bevormundend, lebenspädagogisch aufgeladen,<br />
noch funktionell vorbestimmt. Ihm eingeschrieben ist gewissermaßen<br />
eine Bedeutungsleere, eine Art Unlesbarkeit;<br />
allenfalls ein Paradox, das Deutungsspielräume eröffnet.<br />
Er macht seine Aneignung möglich und zugleich unberechenbar<br />
– ein Ort der unbekannten Möglichkeiten und des<br />
Zufalls.
Schlussfolgerungen<br />
Die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum bietet<br />
für den Städtebau und die Architektur auf verschiedenen<br />
Ebenen Lernstoff.<br />
Erstens. Architektur ist ein fait social: Der geplante Raum<br />
löst sich bald von architektonischen Absichten und beginnt<br />
ein Eigenleben. Diese „reale“ Architektur ist nicht planbar<br />
und – gerade durch diesen Umstand – relevant. Insofern<br />
hat jeder städtebauliche und architektonische Entwurf eine<br />
unbestimmte, unbekannte und unsichtbare Dimension.<br />
Diese Dimension des Abwesenden ist ein Prozess: Durch<br />
den Gebrauch entformt sich Architektur ständig, so dass der<br />
Architekt (als Autor) wie ein Gesicht im Sand verschwindet.<br />
Die Dimension des Abwesenden bedeutet allerdings nicht<br />
Nicht-Form, eher Strategie: sie konkretisiert sich in der<br />
Anreicherung der Architektur mit Spielräumen, welche die<br />
Freiheit für subjektive Aneignung und Deutungen bieten.<br />
Dies anstelle von objektfixierten, architektonischen Bedeutungen,<br />
die man sklavisch nachvollziehen muss.<br />
Daraus folgt, zweitens, dass die Form als traditioneller architektonischer<br />
Imperativ – im Positiven wie im Negativen –<br />
neu gedacht werden muss. Dabei geht es nicht um formale<br />
Reduktionen – im Gegenteil: Die Form wird durch Komplexität<br />
und Potenziale aufgeladen, so dass man von einer Überform<br />
sprechen kann. Sie ist – im Sinn eines Mehrwertes – unsichtbar.<br />
Dieser misst sich allein an der Erfahrung, dass Architektur<br />
und Raum erst durch Aneignung und Deutung sich konkretisieren<br />
können.<br />
Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich auf die Vielschichtigkeit<br />
und Polyphonie des Alltäglichen. Die Auseinandersetzung<br />
mit dem öffentlichen Raum lässt Niemandsländer,<br />
Nicht-Orte, Orte ohne Adressen, Orte des Dazwischen –<br />
also nicht geplante und wenig gestaltete Räume – in einem<br />
anderen Licht erscheinen, insbesondere ihr architektonischer<br />
Wert. Sie relativeren nicht nur Vorurteile, sondern erzwingen<br />
Respekt, der diametral dem verbreiteten fachlichen Urteil<br />
gegenübersteht. Dieses bewertet solche Orte als blinde<br />
Flecken, die es „aufzuwerten“ gilt.<br />
Viele Beispiele belegen, dass mit der gut gemeinten, traditionell<br />
paternalistischen Stadtplanung öffentliche Orte nicht<br />
aufgewertet, sondern zerstört werden. Ungeplante, nicht<br />
gestaltete Quadratmeter haben oft hohe Gebrauchswerte<br />
und eine vorbildliche, eben nicht vorgedeutete Ästhetik,<br />
gerade weil die Architektur da nicht das letzte Wort hat.<br />
Das heißt nicht, dass dirty realism und Banales nun den<br />
neuen architektonischen Kick darstellen. Es geht vielmehr<br />
um einen Paradigmawechsel: Die Räume haben sich ent-<br />
hierarchisiert. Das heißt, es gibt nicht eine verbindliche, auch keine vorherrschende<br />
Bewertung von dem, was als öffentlicher Raum gilt und was nicht,<br />
auch nicht wie er aussehen soll oder gestaltet werden muss. Das bedeutet<br />
keineswegs Beliebigkeit – im Gegenteil. Es bedeutet, dass sich Architektur<br />
auf eine spezifische Öffentlichkeit beziehen muss, auf eine Teilöffentlichkeit<br />
und nicht einem übergeordneten Architekturkanon folgen kann. Insofern<br />
hat Architektur die gesellschaftliche Voraussetzung, sozial durchlässiger zu<br />
werden. Das heißt: So, wie sich die Öffentlichkeit in viele Teilöffentlichkeiten<br />
aufgesplittet hat, ist eine universale Architekturqualität zum Mythos geworden.<br />
Es gibt kein Entrinnen – Architektur ist eine öffentliche Angelegenheit,<br />
für die es nicht die – sondern viele Öffentlichkeiten gibt, so dass architektonische<br />
und ästhetische Massstäbe heute mit und ohne Architekten gesetzt<br />
werden.<br />
Die Tatsache bedeutet, dass sich der Berufsstand nicht mehr an Zustände<br />
halten kann, als es noch klare, kulturelle und räumliche Hierarchien gab.<br />
Der Wandel kann als Verlust und Trauerarbeit empfunden werden. Sie<br />
gehört jedenfalls zu einem Kernthema des öffentlichen Raumes, das sich<br />
um den Ablösungsprozess von der bürgerlichen Öffentlichkeit dreht. Führt<br />
er in eine Krise oder aus ihr heraus, bedeutet er kulturelle Barbarei oder<br />
Fortschritt? Die Antwort lautet – weder noch. Da der Ablösungsprozess<br />
ohnehin stattfindet, hat Städtebau und Architektur nur die Wahl, sich mit<br />
den Realitäten auseinanderzusetzen oder einmal mehr ihnen nachzuhinken.<br />
Literatur<br />
Augé, M.: Non-Lieu u.a. Vortrag anlässlich des Symposiums „Stadt und Kommunikation“.<br />
TU Stuttgart 2000<br />
Barthes, R.: Semiologie und Stadtplanung. Frankfurt am Main 1988, S. 199<br />
Deleuze, G. Postskriptum zur Kontrolle. in ders. Unterhandlungen. Frankfurt am Main 1993<br />
Eco, U.: Das offene Kunstwerk. Frankfurt am Main 1966<br />
Foucault, M.: Die Stadt der Heterotopien. u.a. im IBA-Katalog. Berlin 1984<br />
Foucault, M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt am Main 1973, S. 338<br />
Foucault, M.: Mikrophysik der Macht. Berlin 1976<br />
Habermas, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit. (Sonderausgabe) Neuwied/Berlin 1962/1971<br />
Harvey, D.: The Condition of Postmodernity. Cambridge 1990<br />
Hubeli. E., Voeckler, K., Saiko, H. (Hg): 100% Stadt. Der Abschied vom Nicht-Städtischen.<br />
Graz 2004<br />
Hubeli, E., Herczog, A., Rupli, P.: Öffentlichkeit und öffentlicher Raum.<br />
Nationales Forschungsprogramm (NFP). ISBN 3-907118-66-9, S. 28ff<br />
Parsons,T.: Towards a General Theory of Action. Cambridge, MA 1951<br />
Ronneberger, K. in: Die Stadt als Event. Edition Bauhaus 2001<br />
Sennett, R.: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Frankfurt am Main 1983<br />
Voeckler, K. in: Die Stadt als Event. Edition Bauhaus 2001<br />
51
Frauke Burgdorff<br />
Öffentlich genutzte Räume in Nordrhein-Westfalen unter einer Überschrift<br />
zu diskutieren, scheint nahezu unmöglich. Denn die Plätze, Straßen und Parks,<br />
die sich zwischen Bielefeld und Bonn, Höxter und Krefeld über die Jahrhunderte<br />
entwickelt haben, haben jeweils einen eigenen Charakter und sind im<br />
besten Falle wesentlicher Bestandteil des Stadtbildes und des städtischen<br />
Lebensgefühls.<br />
Und doch müssen sich die Stadtgesellschaften auch in Nordrhein-Westfalen<br />
zukünftig vergleichbaren Herausforderungen stellen: Wir werden älter und<br />
bunter, die Schere zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften wird<br />
größer und damit auch der Unterschied zwischen lokaler Gebundenheit und<br />
internationalisierter Mobilität. Die private Ökonomisierung und der Zwang<br />
zum Konsum auf zentralen öffentlichen Plätzen in unseren Innenstädten<br />
liegen auf der Hand und die Vernachlässigung der normalen Straßen und<br />
Plätze in den Quartieren ist augenscheinlich.<br />
Dabei ist allen an dieser Entwicklung des öffentlich genutzten Raumes<br />
Beteiligten deutlich, welchen Stellenwert er für die Integrationskraft und<br />
Durchlässigkeit von Gesellschaften einnimmt. Es ist allerdings notwendig,<br />
dass wir uns auf die Suche auch nach nicht bekannten Potenzialen für diese<br />
Räume begeben, damit sie weiterhin lebendige Orte der Begegnung mit<br />
anderen und soziale Informations- und Kommunikationsträger der Stadtgesellschaft<br />
bleiben.<br />
Welche Räume dies in Zukunft sein werden und wie wir mit den Räumen<br />
umgehen, die wir in den Peripherien und Zwischenstädten finden, ist noch<br />
offen. In den letzten <strong>Jahre</strong>n der Arbeit an diesem Thema wurde allerdings<br />
deutlich, dass es gleichermaßen wichtig ist, die zentralen Funktionen der<br />
innerstädtischen Plätze – des klassischen Zentrums der europäischen Stadt –<br />
zu bewahren und gleichermaßen den wenig beachteten Räumen – seien<br />
es Plätze in den Vorstädten und Quartieren oder Einfallstraßen – bei der<br />
52<br />
Räume öffnen<br />
Gestaltung ein neues Gewicht zu geben. Denn Öffentlichkeit<br />
findet längst nicht mehr nur auf unseren Plätzen und in<br />
unseren öffentlichen Institutionen statt. Private Nutzungen<br />
und öffentliche Präsenz haben sich durch elektronische<br />
Medien und durch die zunehmende Mobilität vermischt und<br />
die Hybridisierung der Funktionen wird weiterhin Anlass für<br />
die andauernde Beschäftigung mit dem Thema sein.<br />
Das zentrale Projekt in diesem Handlungsbereich ist der<br />
Landeswettbewerb „Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze“.<br />
Zweimal waren die Kommunen aufgefordert, Entwürfe<br />
für die Neu- und Umgestaltung ihrer öffentlichen Räume<br />
einzureichen. Anlässlich der dritten Auslobung hat das<br />
Wettbewerbsverfahren darauf reagiert, dass die Entwicklung<br />
spezifischer lokaler Lösungen für die globalen Herausforderungen<br />
nur gelingen kann, wenn die unterschiedlichen<br />
lokalen Träger, Nutzer, Anrainer und Engagierten zum Mitwirken<br />
angestiftet und aktiviert werden. So sind hervorragende<br />
Entwürfe entstanden, die sich weniger dem „großen<br />
Wurf“ als der behutsamen Stadterneuerung verpflichtet<br />
fühlen.
Ebenfalls auf die Suche nach neuen Analyse- und Beteiligungsstrategien,<br />
nach neuen Themen und Gestaltungswegen<br />
haben sich die beiden Projekte „Privatgrün“ und „Kunst<br />
trifft Stadt“ begeben. Die künstlerische Öffnung privater<br />
Räume als Statement gegen die Rückzugsbewegung der<br />
Gesellschaft aus dem öffentlichen Raum hat zahlreiche Kölner<br />
einen neugierigen Blick in die Lebenswelten anderer<br />
richten lassen. Die Zusammenarbeit mit den Kunstvereinen<br />
Nordrhein-Westfalens hat deutlich gemacht, dass sowohl<br />
das Publikum der Vereine als auch die künstlerischen Analysen<br />
und Projektstrategien dafür geeignet sind, zu schwierigen<br />
öffentlichen Räumen, den „Urbanen Zäsuren“, einen<br />
Zugang zu finden.<br />
Bei der Gestaltung öffentlicher Räume hat der Einsatz von Licht in den<br />
letzten <strong>Jahre</strong>n eine immer größere Rolle gespielt. Dies geht weit über den<br />
bekannten festivalisierten „Lichtzauber“ hinaus. Der behutsame und gestalterisch<br />
durchdachte Einsatz von Licht im Stadtraum braucht ähnlich wie die<br />
sich ständig weiter entwickelnden Entwürfe der Lichtkünstler unsere ganze<br />
Aufmerksamkeit. Denn eine ästhetisch hochwertige Nachtsicht auf unsere<br />
Städte spielt nicht nur für das Sicherheitsgefühl, sondern auch für das Wohlbefinden<br />
der Bewohner und Besucher eine entscheidende Rolle. Die aktuellsten<br />
Entwicklungen in diesem Feld wurden intensiv in der Ausstellung<br />
„Stadtlicht_Lichtkunst“ und im Lichtkunstkatalog Nordrhein-Westfalen diskutiert.<br />
Sie setzten inhaltliche und formale Akzente, die insbesondere der<br />
dunklen Stadt einen besonderen Reiz und eine eigene städtische Identität<br />
geben.<br />
Nicht nur als Lichtereignisse, sondern vor allem als Einschnitte in die Stadtlandschaft<br />
werden die großen Straßen in unseren Agglomerationsräumen<br />
wahrgenommen. Dass im täglichen Stau und mit dem Blick aus dem Auto<br />
eine ganz eigene Perspektive auf die Stadtgestaltung und eine ganz eigene<br />
Öffentlichkeit entsteht, haben das Symposium „Stadt der Geschwindigkeit“<br />
und der studentische Workshop „Stadtraum B1“ besonders deutlich gemacht.<br />
Mit diesen beiden Projekten hat ein Thema der Stadtentwicklung<br />
Aufmerksamkeit bekommen, das bisher zu Unrecht von den Gestaltern und<br />
Entwerfern stiefmütterlich behandelt wurde und das in Zukunft die Diskussionen<br />
der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> begleiten wird.<br />
53
Franz Pesch<br />
54<br />
Orte der Urbanität<br />
Der Landeswettbewerb<br />
Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze
Nichts ist mehr so wie es ist in der Stadt. Die Stadt verändert<br />
sich und die Stadtgesellschaft weiß nicht mehr so recht, was<br />
anfangen mit ihrem öffentlichen Raum. Infolge des Verlustes<br />
traditioneller städtischer Funktionen befürchten die einen<br />
eine dauerhafte Entleerung des Stadtraums. Andere sorgen<br />
sich gerade um die immer etwas künstlich anmutende neue<br />
Fülle der Städte dank Festivalisierung und eventmäßiger<br />
Aufbereitung, da sie auf lange Sicht eher eine Banalisierung<br />
und Entwertung des öffentlichen Raums befördere. Es werden<br />
Klagelieder einer zunehmenden Ödnis und Verwahrlosung<br />
gesungen und zugleich Hymnen über eine neue Lust<br />
am Stadtraum angestimmt.<br />
Der Stadtplaner, der immer auch Stadtkritiker ist, neigt sich –<br />
je nach Ort und Stimmung – mal der einen, mal der anderen<br />
Seite zu und wäre angesichts der wechselnden urbanen<br />
Szenarien schlicht überfordert, sollte er die Zukunft des<br />
öffentlichen Raums prognostizieren. Es werden wohl – so<br />
viel steht fest – verschiedene Zukünfte sein, abhängig von<br />
Region, Stadtgröße, Nutzung und Kultur. Es gibt genügend<br />
Hinweise darauf, dass konträre Szenarien nebeneinander<br />
existieren und durchaus auch koexistieren werden.<br />
Um das Phänomen des Wandels des öffentlichen Raums<br />
besser in den Blick zu bekommen, ist es hilfreich, den Blickwinkel<br />
zu erweitern: Denn in dem Maße, in dem mit der<br />
gestiegenen Mobilität von Menschen, Gütern und Informationen<br />
die existentielle Angewiesenheit auf die räumliche<br />
Nähe der Stadt entfiel, hat die Stadt auch ihre historischen<br />
räumlichen Schranken überwunden. Von einer Ortsgebundenheit<br />
urbaner Lebenssituationen im klassischen Sinne<br />
kann heute in der europäischen Stadt nicht mehr gesprochen<br />
werden. Und so wie sich die räumlichen Bindungen<br />
gelockert haben, hat sich auch die Stadtgesellschaft ausdifferenziert<br />
in eine große Zahl von gesellschaftlichen Gruppen<br />
mit differenzierten Lebensstilen und Ansprüchen an den<br />
Stadtraum. Je nach Gruppenzugehörigkeit und Lebensstil<br />
werden heute andere urbane Orte gewählt – Orte, die sich<br />
nicht mehr auf einen Quadranten im Zentrum der Stadt<br />
konzentrieren, sondern sich über die Stadtregionen verteilen.<br />
So haben sich in der heutigen Stadtlandschaft, die zu regionalen<br />
Netzen zusammengewachsen ist, parallele Welten der<br />
Urbanität herausgebildet, die – in ihrer scheinbaren Widersprüchlichkeit<br />
– so eng in den heutigen gesellschaftlichen<br />
Prozessen verankert sind wie die mittelalterliche Stadtgesellschaft<br />
im öffentlichen Raum zwischen Handelsplatz, Rathaus<br />
und Kirche oder das Bürgertum im nachrevolutionären<br />
Frankreich auf der Bühne der städtischen Boulevards.<br />
Es sind Orte, die von der sich häutenden postindustriellen<br />
Stadt zurückgelassen werden, teilweise in Privatbesitz, aber<br />
ohne erkennbare Eigentumsgrenzen; ihre Aneignung ist<br />
informell, offen und ungeregelt. Sie sind vielschichtig zu<br />
lesen und in den heutigen Stadtregionen „mindestens so<br />
wichtig wie die Bemühungen um eine Renaissance der<br />
Bürgerplätze“ (Boris Sieverts). Urbane Ereignisse entstehen<br />
zunehmend außerhalb der Stadträume, die ihnen bisher gewidmet waren,<br />
in Übergangszonen, transitorischen Räumen.<br />
Man könnte diese Form des Stadtlebens auch als urbane Episoden bezeichnen.<br />
Wer an ihnen teilhaben möchte, ihre Orte und Netzwerke nutzen will,<br />
muss ihre Landkarte verstehen, muss ihre codes lesen können. Das Entstehen<br />
einer fast schon subversiven Form der Urbanität entspricht den Lebensgewohnheiten<br />
der Stadtbewohner und der Morphologie heutiger Stadtregionen<br />
möglicherweise mehr als die zusammenhängenden Raumgefüge<br />
der alten Stadt.<br />
Welche Rolle kann ein Landeswettbewerb in dieser unübersichtlichen Situation<br />
spielen? Mit dem mehrstufigen Wettbewerb „Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong><br />
macht Plätze“ wurde der Anspruch formuliert, zeitgemäße Antworten auf die<br />
veränderte Bedeutung des öffentlichen Raums zu finden und dabei höchste<br />
Gestaltqualität mit nachhaltigen Nutzungskonzepten zu verbinden. An einigen<br />
charakteristischen Projekten lässt sich der Stand der Dinge dokumentieren:<br />
- Stadtbild.Intervention Pulheim: Über temporäre künstlerische Installationen<br />
werden Nicht-Orte wie ein Parkdeck thematisiert und stadträumliche<br />
Zusammenhänge kenntlich gemacht. Ohne erhobenen Zeigefinger lenkt<br />
die Kunst den Blick auf das urbane Potenzial alltäglicher Orte.<br />
- Rheinbraunplatz Wesseling: Ein ehemaliges Betriebsgelände bietet der<br />
Innenstadt einen neuen Zugang zum Rhein. Zum Wasser orientierte Sitztreppen<br />
bilden den Außenraum für ein neues Bürgerhaus im umgebauten<br />
Werksgebäude. Identität stiftende Elemente der industriellen Nutzung<br />
wie eine Kranbahn sind in die Platzgestaltung integriert.<br />
- Innenstadtplätze Ahaus: Die gestalterische Neuordnung und funktionale<br />
Stärkung der Innenstadt erfolgt durch Platzräume, die unterschiedlichen<br />
Nutzungen entsprechend gestaltet werden. Auf diese Weise wird der<br />
kleinteilige Charakter der Innenstadt gestärkt.<br />
- Bethelplatz Bielefeld: Ein Wettbewerbsverfahren und ein vorgeschalteter<br />
intensiver Beteiligungsprozess sind Kennzeichen der Bemühungen, höchstmögliche<br />
Funktionalität und vor allem Akzeptanz der späteren Nutzer zu<br />
gewinnen.<br />
Die Partizipation gewinnt in der dritten Phase des Wettbewerbs noch stärker<br />
an Bedeutung. Als Beispiel sei die Vorgehensweise der Stadt Münster bei<br />
der Gestaltung des Platzes vor dem Picassomuseum angeführt: Der Platzraum<br />
ergab sich aus einem vor mehreren <strong>Jahre</strong>n durchgeführten städtebaulichen<br />
Wettbewerb. Um zu einer gestalterischen Lösung zu kommen, wurden die<br />
vier Preisträger zu einem mehrtägigen Workshop eingeladen. Als Input dienten<br />
die Ergebnisse eines moderierten Beteiligungsprozesses, in dem eine gut<br />
hundertköpfige Bürgergruppe ihren Vorstellungen über die Zukunft dieses<br />
Stadtraums in Wort, Bild und Modell Ausdruck verliehen hatte. Das Beteiligungsergebnis<br />
ging auch in die Beurteilungskriterien der Jury ein.<br />
Die Lage der Dinge in Sachen öffentlicher Raum hat sich also verändert.<br />
Aus einem sehr scharf gezeichneten Bild des Stadtplatzes mit eindeutig<br />
zugeordneten Bedeutungen und Aufgaben ist eine breite Leinwand geworden,<br />
auf der vielfältige Raumkonstellationen und Nutzungen abgebildet<br />
werden können. Das Panoramabild solcher Plätze und Platzangebote versteht<br />
sich als Möglichkeitsraum. Ob und wie sich Farbe auf ihnen verteilt,<br />
hängt mehr denn je von den Menschen ab, die den Raum nutzen. Je mehr<br />
sie sich dem Stadtraum verpflichtet fühlen, desto klarer wird das Bild.<br />
55
Petra Lindner<br />
56<br />
Kunst trifft Stadt<br />
Die Idee der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>, das Thema Baukultur in die<br />
Kunst zu tragen, kam vom Essener Kulturdezernenten Oliver Scheytt. Damit<br />
war keine Erweiterung des Landesprogramms „Kunst und Bau“ gemeint,<br />
sondern es sollte eine inhaltliche und diskursive Auseinandersetzung von<br />
Kuratoren, Künstlern und Bürgern über Aspekte der Stadtentwicklung,<br />
Architektur und Baukultur oder Theoreme wie Urbanität, Mobilität und<br />
Stadtstrukturen initiiert werden.<br />
Als 2003 das erste <strong>Jahre</strong>sprogramm „Kunst trifft Stadt“ startete, waren zum<br />
ersten Mal ausdrücklich die Kunstvereine und -vereinigungen in Nordrhein-<br />
Westfalen aufgefordert, sich in ihrem Kreis mit den ihnen verbundenen<br />
Künstlern und Mitgliedern dem Anliegen der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
zu widmen. Der Appell lautete, sich aufzumachen in die Stadt, Stadt zu<br />
erfahren, zu erleben, zu erfühlen – aus dem Blickwinkel von Kunstschaffenden<br />
und Kunstfreunden. 2005 wurde dann ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben,<br />
der Leerstände und Brachen in unseren Städten ins Visier nahm.<br />
Mit „Urbane Zäsuren“ war das letztjährige Programm betitelt, an dem elf<br />
Kunstvereine teilnahmen, die sich auf vollkommen unterschiedliche Art und<br />
Weise einer der größten stadtstrukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen<br />
unserer Städte seit den 1980er <strong>Jahre</strong>n widmeten: der Verwaisung<br />
innerstädtischer Orte. Entgegen landläufiger Erwartungen, dass die Kunstvereine<br />
allein Künstler bitten würden, die von ihnen aufgespürten oder seit<br />
langer Zeit mokierten Brachen und Leerstände zu bespielen, entstand ein<br />
komplexes und in seinen Intentionen vollkommen variierendes Konglomerat<br />
von Projekten: Der Kunstverein Ahlen deklarierte zum Beispiel seinen zentralen<br />
Platz als Brache, um seinen Unmut über dessen Gestaltung zu formulieren.<br />
Das Kunsthaus Essen bereitete die Bürger der Stadt auf eine Reise in<br />
andere Urbanitätsmodelle vor und malte den Grundriss des toskanischen<br />
Siena auf den Berliner Platz. Stadtraum.org veranstalteten in der gerade<br />
beginnenden Diskussion über moderne Subsistenzsicherungstrategien ein<br />
survival camp auf einer Düsseldorfer Brache und Mülheim erlebte seinen<br />
Kirchenhügel mit allen Sinnen und einem interdisziplinären Workshop, um<br />
ihm neues urbanes Leben einzuhauchen. Damit ist nur ein kleiner Teil der<br />
Ideen und Projekte genannt.<br />
Die Kunstvereine haben neben den unterschiedlichen eingeladenen<br />
Künstlern die Narrenfreiheit des kreativen Bereichs<br />
genutzt, um sich auf unorthodoxe Art und Weise mit baukulturellen<br />
und stadtstrukturellen Fragen auseinander zu<br />
setzen. So sind spielerische Umgangsweisen, forsche politische<br />
Ansätze ohne jede parteipolitische Verpflichtung entstanden,<br />
mutige Visionen ohne die nüchterne Ernsthaftigkeit<br />
eines stadtplanerischen Gremiums bedenken zu müssen.<br />
„Kunst trifft Stadt“ fungierte auch beim zweiten Mal als ästhetischer<br />
Spielraum mit seriösen Absichten. Allen Projekten<br />
zugrunde liegt die Liebe zur Stadt, die konstruktiv kritische<br />
Betrachtung eines wohlbekannten Gefüges, das dem alltäglichen<br />
Blick immer wieder entgeht. Die Wiederentdeckung<br />
der eigenen Stadt mit ihren Schätzen und desolaten Aspekten<br />
provoziert: In den kreativen Köpfen und denen, deren<br />
Interesse der Kunst gilt, regt sie zu ungeahnten Herangehens-<br />
und Sichtweisen, Inszenierungen oder periodischen<br />
Veränderungen an. Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> sucht<br />
mit der Reihe „Kunst trifft Stadt“ keine neuen Stadtplaner<br />
oder Architekten, aber neue Sichtweisen auf die Stadt. Der<br />
interdisziplinäre Ansatz des gesamten Programms hat in den<br />
letzten fünf <strong>Jahre</strong>n nicht nur zu außergewöhnlichen Kooperationen<br />
geführt, sondern auch Prozesse und Ergebnisse<br />
gezeigt, die ohne die Öffnung der klassischen Expertenrunde<br />
nicht zu Stande gekommen wären.<br />
Im Endeffekt handelt es sich hier um ein Kommunikationsmodell:<br />
„Kunst trifft Stadt“ geht über den inhaltlichen Rahmen<br />
der Stadtbetrachtung hinaus und erweist sich mehr und<br />
mehr als Plattform für Kunstvereine und Kuratoren, Künstler<br />
und Stadtverwaltungen, Politiker und Planer. Die einzelnen<br />
Veranstaltungen werden zu Zusammenkünften von Menschen,<br />
die einander sonst nur skeptisch oder überhaupt nicht<br />
begegnen. Letztlich ist durch dieses Programm eine weitere<br />
Gruppe von Bürgern auf das Thema Baukultur aufmerksam<br />
geworden und eingeladen, sich aktiv damit auseinander zu<br />
setzen. Und das bleibt neben der professionellen und wissenschaftlichen<br />
Weiterentwicklung wichtiges Ziel: baukulturelle<br />
Fragen und Herausforderungen in die Köpfe derjenigen<br />
Menschen zu tragen, die unsere Städte mit Leben füllen.
Moyland<br />
Bonn<br />
Mülheim<br />
Ahlen<br />
Aachen<br />
Düsseldorf<br />
57
Jochen Heufelder<br />
58<br />
Privatgrün 2004
Unter dem Titel Privatgrün 2004 veranstaltete der Fuhrwerkswaage-Kunstraum<br />
in Köln eine Ausstellungstrilogie, in deren Fokus private Gärten als<br />
Orte der Präsentation für zeitgenössische Kunst standen. Die Konzeption<br />
der Ausstellung lehnte sich an das erstmals 1994 unter dem Titel Privatgrün<br />
erfolgreich durchgeführte Projekt an, das 21 Bildhauerinnen und Bildhauern<br />
ebenso viele Gärten wie Präsentationsorte öffnete. In Form von<br />
Skulpturen, Bauwerken und Bepflanzungen reflektierten die realisierten<br />
Arbeiten auf unterschiedliche Weise das Thema der Garten-Kunst und<br />
gaben auf Grund dieses individuellen, originären Ortsbezugs Anregungen,<br />
die eigene Beziehung zu Natur, Garten und Landschaft zu überdenken.<br />
Die positive Resonanz einerseits wie auch ein durch interventionistische<br />
Praxis und temporäre Artikulationen veränderter Blickwinkel auf Kunst und<br />
Garten durch eine neue Künstlergeneration andererseits bildeten zehn<br />
<strong>Jahre</strong> später die Basis für eine Fortsetzung und Erweiterung von Privatgrün.<br />
Im Gegensatz zu Ausstellungen der vergangenen <strong>Jahre</strong>, die zeitgenössische<br />
Kunst in Parkanlagen (hellgruen, Düsseldorf 2001; Aquaplaning, Bad<br />
Oeynhausen 2000) oder im Stadtraum (Hamburg 2000) realisierten, lenkte<br />
Privatgrün 2004 den Fokus auf den Privatbereich des Gartens im urbanen<br />
Kontext. Auf diese Weise soll der breite Diskurs über Kunst im öffentlichen<br />
Raum erweitert werden: auf Fragestellungen nach der künstlerischen Gestaltung<br />
von privaten Räumen und ihrer Relevanz für soziale Systeme als<br />
Orte des Rückzugs und der Utopie, als Spiegel von Gesellschaft, von Ordnung<br />
und Dissens.<br />
In drei separaten Ausstellungen setzten sich die eingeladenen 55 Künstlerinnen<br />
und Künstler mit der jeweiligen Situation des Gartens auseinander.<br />
In einem ersten Teil wurden insgesamt 18 Hausgärten in Kölns südlichem<br />
Stadtteil Sürth zu Orten zeitgenössischer Kunst. Hierbei reichte das Spektrum<br />
der Grünareale vom kleinen Innenhof mit etwa 20 Quadratmetern bis<br />
zum Auengarten mit mehr als 2000 Quadratmetern. Eine gänzlich unterschiedliche<br />
Situation des privaten Gartens markieren Kleingärten in einer<br />
Schrebergartenkolonie. Hier traten die Kunstwerke in einen Kontext,<br />
geprägt von Regularien der Nutzung des Grüns, von unmittelbarer Nachbarschaft<br />
und Vereins-Charakter. Im Übergang vom privaten zum öffentlichen<br />
Raum gelegen, unterscheiden sich die Klein- oder Schrebergärten von<br />
Hausgärten durch ihre Anlage und Konzentration. Dieser<br />
Teil des Ausstellungsprojektes fand in 18 Gärten der Kleingartenanlage<br />
Sonnenhang im Stadtteil Köln-Rodenkirchen<br />
statt. „Grüne Inseln“, Symbiosen von Vorortsituation und<br />
Urbanität bildeten im dritten Teil der Ausstellung dann<br />
18 Dachgärten in der südlichen Innenstadt Kölns (Chlodwigplatz,<br />
Ubierring, etc.). Hoch über dem Stadtverkehr wurden<br />
diese – konstruierten – Grünareale zu Zonen der Ruhe, vor<br />
allem aber auch des weiten Blicks. In allen drei Teilausstellungen<br />
war in jedem Garten ein geschulter Betreuer präsent,<br />
der zu dem jeweiligen Kunstwerk Auskunft geben und über<br />
Absicht und Hintergründe informieren konnte. Anders als<br />
bei Haus- und Schrebergärten – mit freiem Zugang für<br />
Publikum an den Wochenenden – wurden die Besucher der<br />
Dachgärten in Kleingruppen geführt. Mit mehr als 10.000<br />
Besuchern wurde die gesamte Ausstellungstrilogie sehr gut<br />
angenommen.<br />
Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Ausrichtung<br />
thematisierten bei Privatgrün 2004 den privaten grünen<br />
Außenbereich als individuelles Rückzugsgebiet. Sowohl junge,<br />
noch unbekannte, aber bereits positiv aufgefallene als auch<br />
renommierte Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen.<br />
Zehn <strong>Jahre</strong> nach Privatgrün war die Fortsetzung 2004<br />
nicht nur ein Spiegel eines weiterentwickelten Kunstverständnisses,<br />
sondern auch einer anderen Künstlergeneration.<br />
Darüber hinaus sollte Privatgrün 2004 die Aufmerksamkeit<br />
auf den privaten grünen Außenbereich als einen Ort für<br />
Kunst lenken, insbesondere hinsichtlich der originären Ortsbezogenheit<br />
der Skulpturen. Dabei befanden sich alle drei<br />
Ausstellungssituationen geographisch auf einer Nord-Süd-<br />
Achse: vom „Häuschen im Grünen“ im Vorort über den<br />
Schrebergarten am Stadtrand bis zum Dachgarten im<br />
Zentrum.<br />
59
Christoph Brockhaus<br />
Mit der industriellen Revolution und der enormen Expansion der Großstädte<br />
triumphiert die Künstlichkeit des Lebens über den natürlichen Lebensrhythmus,<br />
verdrängt das funktionale Kunstlicht das gestaltende Naturlicht. Seit<br />
1960 akzelleriert dieser Prozess, seitdem mischt sich aber auch die Lichtkunst<br />
in das dominierende Lichtdesign ein. Als immaterielles Element steht<br />
das Licht traditionell im polaren Spannungsfeld von Natur und Technik,<br />
Sakralisierung und Profanierung. Da Licht emotionalisiert wie kein zweites<br />
bildnerisches Medium, haben es auch Werbung und Marketing für sich entdeckt.<br />
Wenn nun das Licht im Stadtraum immer begehrter wird, es immer<br />
ökonomischer, technisch raffinierter und ästhetisch vielseitiger eingesetzt<br />
werden kann, entsteht bei unkoordinierter und unkontrollierter Planung<br />
und Umsetzung eine katastrophale Licht-Kakophonie. Um diesen Prozess zu<br />
stoppen und notwendigerweise eine Bewusstseinsveränderung im Umgang<br />
mit Lichtgestaltungen im öffentlichen Raum herbei zu führen, hat die Initiative<br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen, durch<br />
Diskussionen und Wettbewerbe, Ausstellungen und Publikationen zur Qualifizierung<br />
dieses Themas beigetragen.<br />
Den Anfang zur Qualifizierung von Nordrhein-Westfalen als „Land des Lichts“<br />
haben vor allem die ZERO-Künstler Heinz Mack, Otto Piene und Günther<br />
Uecker in den 1960er und 1970er <strong>Jahre</strong>n geleistet. Mit ihren Werken aus<br />
monochromem und farbprismatischem, statischem, strukturiertem und<br />
kinetischem Licht sowie mit ihren Licht-Aktionen setzten sie dem verrußten<br />
Himmel des Ruhrgebiets das reine Lichtkunstwerk entgegen und beteiligten<br />
sich mit ihrer Lichtkunst schon früh an Auftritten vergleichbarer internationaler<br />
Bewegungen im Ausland.<br />
Auch die Licht-Landmarken der zwischen 1989 und 1999 organisierten<br />
Internationalen Bauausstellung Emscher Park erwuchsen aus spezifischen<br />
Auseinandersetzungen mit dem Ruhrgebiet. Nachdem die rot glühenden<br />
Himmel der Kohle- und Stahlproduktion allmählich verlöschten, sollten weithin<br />
sichtbare Landmarken der Lichtkunst und des Lichtdesigns den Transformationsprozess<br />
ins postindustrielle Zeitalter markieren, zugleich Traditionen<br />
aufgreifen und neue Orientierungen vermitteln.<br />
Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> hat in den vergangenen fünf <strong>Jahre</strong>n durch<br />
ihre Impulse und Förderungen eine bundesweit einmalige Licht-Bewegung<br />
in den Städten des Landes bewirkt, Vorhandenes strukturiert und dokumentiert,<br />
weitere Initiativen entzündet. Allein am Landeswettbewerb „Künstlerisch<br />
orientierte Lichtprojekte im öffentlichen Raum“ im Jahr 2001 haben<br />
sich die Städte und Gemeinden mit 55 Beiträgen beteiligt, 14 Projekte<br />
konnten gefördert und inzwischen teilweise realisiert werden. Wichtiger<br />
noch: Dieser Wettbewerb und seine damit verbundene Diskussion haben<br />
über die Verwaltungen hinaus Gesellschaften, Bürgerinitiativen, Hochschu-<br />
60<br />
Kunstlicht und Lichtkunst<br />
im Stadtraum<br />
len, Museen und Ausstellungshäuser angeregt, selber Lichtthemen<br />
des öffentlichen Raums aufzugreifen und damit zur<br />
Qualifizierung der Situation beizutragen. Dabei hat die Erfahrung<br />
gelehrt, dass nicht nur die Fachwelt, sondern auch<br />
die Bürgerschaft in hohem Maße an diesem Thema interessiert<br />
ist, zahlreich die angebotenen Veranstaltungen besucht<br />
und leidenschaftlich mitdiskutiert.<br />
Als Höhepunkte dieser ersten Licht-Runde dürfen festgehalten<br />
werden: Düsseldorf, Köln und weitere Städte haben<br />
begonnen, zusammenhängende Lichtkonzepte mit hohem<br />
gestalterischem Anspruch zu entwickeln; in vielen Städten<br />
des Landes inspirieren öffentliche Einzelprojekte die weitere<br />
Licht-Diskussion; das weltweit einzigartige und von herausragenden<br />
Lichtkünstlern unserer Zeit bespielte Zentrum<br />
für internationale Lichtkunst Unna kann inzwischen einen<br />
deutsch-englischen Bestandskatalog anbieten; die Nachbarstadt<br />
Lüdenscheid hat sich durch ihre Licht-Routen, die<br />
temporär viele Kräfte und die Bevölkerung mobilisieren, zur<br />
Stadt des Lichts gemausert; das Ausstellungsprojekt<br />
„7 Türme – 7 Lichter“ in Paderborn hat in einer konservativen<br />
Stadt einen ganz neuen Dialog zwischen historischer Stadtarchitektur<br />
und zeitgenössischer Kunst initiiert; die Publikation<br />
„Am Rande des Lichts – Inmitten des Lichts. Lichtkunst<br />
und Lichtprojekte im öffentlichen Raum Nordrhein-Westfalens“<br />
darf als kritische Bestandsaufnahme für zukünftige<br />
Planungen gewertet und benutzt werden; das Handbuch<br />
zur Ausstellung „Stadtlicht – Lichtkunst“ der Stiftung Wilhelm<br />
Lehmbruck Museum in Duisburg hält schließlich vielerlei<br />
Anregungen bereit für ein differenzierteres Verständnis und<br />
eine überlegtere Anwendung des breiten Spektrums an<br />
zeitgenössischer internationaler Lichtkunst im öffentlichen<br />
Raum. Diese Publikation diskutiert zahlreiche Vorschläge zur<br />
Qualifizierung zukünftiger Lichtgestaltungen im öffentlich<br />
zugänglichen Raum unserer Städte. Im Kern geht es um<br />
folgende zwei Fragen, die nur interdisziplinär überzeugend<br />
behandelt werden können: Wie lässt sich das Naturlicht als<br />
gestalterischer Faktor wieder sinnvoller und intensiver in die<br />
Stadtgestaltung integrieren? Wie lassen sich notwendiges<br />
Sicherheits- und Funktionslicht, Lichtkunst und werbendes<br />
Lichtdesign überzeugender als bislang koordinieren, um die<br />
Attraktivität unserer Erlebnisräume in der Stadt für unsere<br />
Bürger zu aktualisieren und zu erhöhen?
Martin zur Nedden<br />
„Kann die B1 die Champs-Élysées oder der Ku‘damm des Ruhrgebiets werden?”<br />
– das ist eine nach wie vor unbeantwortete Frage. Gestellt wurde sie<br />
von Kunibert Wachten und Michael Koch auf der Internationalen Herbstakademie<br />
„Stadtraum B1” im <strong>Jahre</strong> 2001. Sie wurde von den Medien dankbar<br />
aufgegriffen und sicherte, wenigstens kurzzeitig, die Präsenz des Themas<br />
in der Öffentlichkeit, wobei nicht auszuschließen ist, dass sie bei einem Teil<br />
der Bevölkerung eher zu Kopfschütteln geführt hat.<br />
Mit der Herbstakademie ist es gelungen, vor Ort ein neues Nachdenken<br />
über das, was eine Stadt und erst recht eine Metropole ausmacht, zu befördern;<br />
noch wichtiger war jedoch die Diskussion, inwieweit die großen Verkehrsbänder<br />
des Ruhrgebiets eine Besonderheit darstellen und das Potenzial<br />
haben, die Andersartigkeit der Region zu „kultivieren”. Trotzdem muss<br />
man zur Kenntnis nehmen, dass, abgesehen von der Tagung „Stadt der Geschwindigkeit”,<br />
die ebenfalls im Rahmen der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
stattfand, die Diskussionen zur B1 nach wie vor von den problematischen<br />
Aspekten dieses Verkehrsbandes geprägt sind. Es wird geredet über Verkehrsstaus,<br />
über Lärm- und Schadstoffemissionen und noch viel zu wenig<br />
über die möglichen urbanen Qualitäten dieses regionalen Stadtraums. Dabei<br />
soll diese in die Zukunft gerichtete Diskussion die verkehrlichen und gesundheitlichen<br />
Probleme an der B1 nicht bagatellisieren.<br />
Mit den Ergebnissen der Herbstakademie liegen viel versprechende Impulse<br />
für diese Diskussion vor. Sie zeigen, dass es klug war, Studierende von<br />
Architekturfakultäten aus dem In- und Ausland sich mit dem Stadtraum B1<br />
auseinander setzen zu lassen und ihre Kreativität und Phantasie heraus zu<br />
fordern. Die thematische Bandbreite der Beiträge ist auch im Rückblick<br />
bemerkenswert. Sie reicht vom überregionalen Ansatz, bei dem die B1<br />
Bestandteil eines ringförmigen Entwicklungsbandes Dortmund-Duisburg-<br />
Köln-Wuppertal wird, bis zur Neuformulierung der Tankstelle als urbaner<br />
Allround-Servicestation. Sie definieren einerseits ein neues Zentrensystem<br />
an den Auf- und Abfahrten, favorisieren andererseits die peripheren Zwischenräume<br />
als Entwicklungspotenziale. Einem schon fast autistischen<br />
Vorschlag zur Führung der B1 in einem oberirdischen Tunnel, der die<br />
vorhandenen Barrierewirkungen weiter verstärken würde, stehen Arbeiten<br />
gegenüber, die genau dies zu mindern versuchen. Für die überwiegende<br />
Zahl der Entwurfsideen gilt, dass sie an und über der Autobahn neue<br />
Flächen mobilisieren oder vorhandene nutzbarer machen wollen. Die Nutzungen<br />
rücken (noch) näher an das Verkehrsband heran, werden intensiviert<br />
und ergänzt bis hin zur Aktivierung des Mittelstreifens. Für wachsende<br />
Regionen mit Flächenengpässen sind dies diskussionswürdige Visionen.<br />
Im Falle einer Umsetzung bergen sie jedoch auch die Gefahr, dass sie urbane<br />
Strukturen, zum Beispiel die vorhandenen Zentren, schwächen.<br />
62<br />
Herbstakademie Stadtraum B1 und<br />
Stadt der Geschwindigkeit<br />
Die vier <strong>Jahre</strong> seit der Herbstakademie haben einige grundlegende<br />
Entwicklungstendenzen noch deutlicher werden<br />
lassen, zum Beispiel die Unausweichlichkeit des Bevölkerungsrückgangs<br />
in der Region. Auch wenn die Auswirkungen<br />
kleinräumig sehr unterschiedlich sein werden, muss<br />
man akzeptieren, dass spätestens ab 2010, auf absehbare<br />
Zukunft, die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen<br />
nicht mehr zu-, sondern eher abnehmen wird. Damit gewinnen<br />
die jeweiligen Standorteigenschaften noch mehr an<br />
Bedeutung. Für Gewerbeflächen, insbesondere an den Zuund<br />
Abfahrten, wird der Standort Autobahn weiterhin<br />
attraktiv sein. Als Wohnstandort hingegen wird er immer<br />
schlechter vermarktbar sein. Der Entwurf „Koslowskis Urbanismus”,<br />
der mit einem idyllischen Wohnen hinter der Lärmschutzwand<br />
operiert, erscheint da als provokative Negation<br />
künftiger Marktverhältnisse; wesentlich realistischer sind<br />
Ansätze wie die der Arbeit „Innenhafen Duisburg”, die mit<br />
einem landschaftsplanerischen Konzept zwischen Räumen<br />
und konkurrierenden Nutzungen vermittelt, sogar neue<br />
(Frei-)Räume schafft. Sie verweist auf die neuen Chancen,<br />
angesichts des erkennbaren Rückgangs der Flächennachfrage<br />
alte, in Wachstumsphasen entstandene Nutzungskonflikte<br />
und Gemengelagen aufzulösen oder zumindest zu<br />
reduzieren.<br />
Die Frage nach der Zukunft des Standorts Autobahn war<br />
auch Gegenstand der Tagung „Stadt der Geschwindigkeit”,<br />
die 2004 in Gelsenkirchen stattfand. Dort wurden Wege zur<br />
städtebaulichen Integration von Verkehrskorridoren diskutiert.<br />
Ein Verdienst der Tagung war es, nicht nur die städtebauliche,<br />
also die räumliche Komponente der Integration<br />
thematisiert zu haben. Ihr Anliegen war vor allem, die Sichtweisen<br />
unterschiedlicher Fachdisziplinen zu integrieren.<br />
Diesem selbst formulierten Anspruch, eine breite interdisziplinäre<br />
Diskussion in Gang zu setzen, ist die Tagung bereits<br />
gerecht geworden. Der Anspruch auf Interdisziplinarität,<br />
wie er hier zum Ausdruck kam, sollte in jedem Fall weitergeführt<br />
werden, und zwar nicht nur in der Initiative StadtBau-<br />
Kultur <strong>NRW</strong>. Das gilt erst recht mit Blick auf kulturelle bzw.<br />
künstlerische Strategien im Umgang mit der B1. Seit den<br />
1960er <strong>Jahre</strong>n, mit der Künstlergruppe B1, hat es dazu<br />
immer wieder Ansätze gegeben. Im Rahmen der Europäischen<br />
Kulturhauptstadt 2010 soll nun mit „B1_21st” ein<br />
neues, interdisziplinäres Kunstprojekt stattfinden, das die B1<br />
als zeitgenössisches urbanes Labor begreifen will.
Die Suche nach einem neuen Umgang mit stark frequentierten<br />
Verkehrskorridoren steht überall auf der Tagesordnung,<br />
nicht nur im Ruhrgebiet. Die B1 ist jedoch von besonderer<br />
Bedeutung und das in mehrfacher Hinsicht: Sie ist Teil einer<br />
der zentralen europäischen Ost-West-Verbindungen oder,<br />
wie es in der Ausstellung „transit. Brügge-Novgorod” im Jahr<br />
1997 hieß, eine „Straße durch die europäische Geschichte”.<br />
Und sie kann, das hat die Herbstakademie gezeigt, zu einem<br />
Markenzeichen der Region Ruhr werden, wenn es gelingt,<br />
neue Wege zu beschreiten. Neue Wege – das sind auch<br />
neue Kooperationen zwischen den Anliegerkommunen, den<br />
unterschiedlichen Verwaltungsebenen und verschiedenen Fachgebieten.<br />
Eine weiterentwickelte B1 kann zum wichtigen Baustein für die Zukunft der<br />
Region werden, unabhängig davon, ob man ihr Potenzial, Metropole oder<br />
Weltstadt werden zu können, so optimistisch sieht wie Christoph Zöpel in<br />
seinem Buch „Weltstadt Ruhr” oder eher zurückhaltend, wie Klaus Kunzmann<br />
es im Rahmen der Herbstakademie tat.<br />
Die Hoffnung von Michael Koch und Kunibert Wachten, sich trotz aller<br />
Zwänge des Tagesgeschäftes auch einmal zu unüblichen Gedanken und<br />
Konzeptionen verführen zu lassen, harrt noch ihrer Erfüllung – eine Gelegenheit<br />
für die nächste Etappe der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>!<br />
63
Kommunikation suchen<br />
65
Klaus Selle<br />
66<br />
Beredte Sprachlosigkeit?<br />
Die kommunikative Dimension der Baukultur<br />
Baukultur macht von sich reden und viele reden von Baukultur. Bei Bund,<br />
Ländern und Kommunen sind Initiativen, Programme und Aktionen zur Förderung<br />
der Baukultur in Gang gesetzt worden. Sie werden begleitet von<br />
zahlreichen Reden und Publikationen, in denen in schöner Regelmäßigkeit<br />
auf die eminente Bedeutung von Kommunikation für die Baukultur hingewiesen<br />
wird. Was aber ist damit gemeint und was resultiert daraus?<br />
Fragen wie diese sind Anlass genug, dem Zusammenhang von Kultur und<br />
Kommunikation zunächst allgemein (1) nachzugehen und dann zu fragen,<br />
worin denn eigentlich die Verständigungsprobleme bestehen, die durch<br />
mehr Kommunikation gelöst werden sollen. Der Aufgaben sind viele, wie<br />
sich zeigt (2), sie alle lösen zu wollen ist offensichtlich unmöglich. Handelt<br />
es sich also bei der Beschwörung der Kommunikation um Sonntagsreden?<br />
Will man diesen Anfangsverdacht zerstreuen, wird man wohl Ross und<br />
Reiter, Ziele und Mittel benennen und konkret werden müssen (3). Das birgt<br />
seine Tücken, zumal wenn es um die Kommunikation zwischen Fachleuten,<br />
Baukünstlern und Laien geht (4). Trotz mancher Probleme soll man auch<br />
weit gesteckte Ziele im Auge behalten – und sei es nur, um den konkreten<br />
Bemühungen Orientierung zu geben (5).
1. Wovon ist die Rede? Ausgangspunkte<br />
Die Verständigung über komplexe Themen wie Kommunikation und Baukultur<br />
scheitert oft schon daran, dass man sich nicht vergewissert, von was<br />
eigentlich die Rede ist. Daher sei hier eingangs der Versuch unternommen,<br />
bei den beiden Begriffen zumindest jene Aspekte ins Auge zu fassen, die für<br />
die Auseinandersetzung mit den kommunikativen Dimensionen von Baukultur<br />
wichtig sind.<br />
Beginnen wir mit der „Kultur“. Das Wort bezeichnet dem Wortursprung<br />
(colere/cultura) nach unter anderem „Pflege” – von Körper, Geist, Acker<br />
und so weiter. Im erweiterten Sinne ist häufig auch von „Beschäftigung”<br />
die Rede. Aus „Pflege“ und „Beschäftigung” entstehen Produkte materieller,<br />
geistiger und sozialer Art: Werkzeuge, Sprache, Schrift, Kunst, Wissenschaft,<br />
Recht, Gebäude, Städte, soziale Formationen, um nur einige zu nennen.<br />
Weil das Spektrum so weit ist und die Gesamtheit aller Lebensumstände<br />
umfassen kann, liegen Kultur und Zivilisation inhaltlich eng zusammen.<br />
Für die Frage nach der Kommunikation folgt daraus zweierlei: Kultur ist Produkt<br />
(Kulturgüter) und (sozialer) Prozess zugleich und sie ist in dem Maße<br />
vielfältig und widersprüchlich, wie es die Gesellschaft, deren Kultur man<br />
betrachtet, auch ist.<br />
Kommunikation ist daher Bestandteil von Kultur und zugleich Voraussetzung<br />
für ihre Entwicklung, denn das Voranschreiten von Wissenschaft, Kunst,<br />
Recht, sozialer Organisation etc. beruht zweifellos ganz wesentlich auf Verständigungsprozessen<br />
jeglicher Art.<br />
Kommunikation ist zudem unerlässlich, um Vielfalt und Widersprüche zu<br />
bewältigen, denn Kultur ist nicht auf ein Niveau, ein Ziel festgelegt, umfasst<br />
vielmehr alle gesellschaftlichen Hervorbringungen und existiert zumeist im<br />
Plural: Verschiedene (Teil-)Kulturen und kulturelle Praktiken stehen innerhalb<br />
einer Gesellschaft neben- und zum Teil gegeneinander (vgl. Eagleton<br />
2001, S. 21). Das kann zu einem untereinander kaum verbundenen, multikulturellen<br />
Vielerlei führen, entwickelt aber immer dort Spannung und die<br />
Notwendigkeit zur Kommunikation, wo gemeinsame Aufgaben gelöst oder<br />
Entscheidungen, die alle angehen, getroffen werden müssen.<br />
Die Frage zum Beispiel, wie die gemeinsame Umwelt sich<br />
entwickeln soll, was, wo, wie gebaut werden kann und muss,<br />
wirft einen solchen Verständigungsbedarf auf – ob es nun<br />
um Hochhäuser in München, Brücken in Dresden, Plätze in<br />
Stuttgart, Kulturforen in Münster oder Stadien in Aachen<br />
geht.<br />
Womit die „Baukultur” angesprochen ist. Dabei scheint es<br />
sich auf den ersten Blick um einen Ausschnitt der allgemeinen<br />
Kultur zu handeln: Gebautes und zu Bauendes stehen<br />
im Mittelpunkt – und die Menschen, die damit befasst sind.<br />
Bei näherer Betrachtung wird allerdings aus dem Teil schnell<br />
wieder das Ganze: Baukultur ist eben nicht nur auf einzelne<br />
Gebäude gerichtet, sondern auf die Stadt, die Umwelt, in<br />
der wir leben, insgesamt und angesprochen sind nicht nur<br />
Bauschaffende, sondern alle Bürgerinnen und Bürger – mithin<br />
die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite.<br />
Ansonsten teilt die Baukultur wesentliche Merkmale mit<br />
dem allgemeinen Kulturbegriff. Sie ist Produkt und Prozess:<br />
Gebäude, Stadt, gestaltete Landschaft sind ebenso Gegenstand<br />
des Baukultur-Begriffs wie deren Herstellung und der<br />
Umgang mit ihnen. Und sie ist das Abbild von Vielfalt: „Das<br />
gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlicher ästhetischer<br />
Ansätze“ ist für die Baukultur konstituierend und<br />
weist zugleich als „Wesensmerkmal einer demokratischen<br />
und pluralistischen Gesellschaft“ (BMVBW 2001, S.14) über<br />
sie hinaus. Und deshalb gilt auch hier: Kommunikation ist<br />
gleichermaßen Teil, Ausdruck und wesentliche Voraussetzung<br />
von Baukultur.<br />
67
2. Verständigungsprobleme?<br />
Kommunikationsaufgaben?<br />
Um die Fülle der Herausforderungen zu verdeutlichen, kann<br />
man weit ausholen – und früh beginnen, zum Beispiel bei<br />
der Urhütte. Deren Entstehung und Entwicklung wird man<br />
sich als kontinuierliches Palaver vorstellen dürfen: Die Erprobung<br />
geeigneter Techniken bedurfte des Erfahrungsaustausches,<br />
die Beschaffung der Baustoffe musste gemeinsam<br />
organisiert werden und das Zusammenfügen vor Ort wird<br />
wohl auch lautreich erfolgt sein. Dieser Urzusammenhang<br />
der am Planen und Bauen Beteiligten zerfiel im Laufe der<br />
Geschichte in immer stärker ausdifferenzierte Rollen: Bauherren<br />
und Nutzer trennten sich, Handwerker unterschieden<br />
sich in zunehmend spezialisierte Gewerke, die Baumeister<br />
traten auf den Plan – zunächst noch als Generalisten, dann<br />
in immer weitere Einzeldienstleistungen sich aufgliedernd,<br />
das Öffentliche wurde vom Privaten geschieden und – überspringen<br />
wir die Zeiten – heute reichen die viele Quadratmeter<br />
großen Bauschilder kaum aus, um alle Beteiligten<br />
eines Vorhabens aufzulisten.<br />
Dieser Prozess hat nicht zuletzt das Entstehen von wechselseitigen<br />
Vorurteilen befördert: Architekten halten Ingenieure<br />
für gestalterisch unbegabte Techniker und jene diese<br />
für formverliebte Tagträumer. Nutzer sehen in Architekten<br />
gerne Zeitgenossen, die sich auf Kosten anderer Denkmäler<br />
setzen und Stadtplaner sind ihnen diejenigen, die die Städte<br />
hässlich machen. Fachleute hingegen sprechen von den<br />
Nutzern oder der breiten Öffentlichkeit gerne als Laien, die<br />
von der Sache nichts verstehen und denen ein halbwegs<br />
akzeptables Geschmacksempfinden ohnehin abgesprochen<br />
werden muss. Erleichtert wird die Pflege solcher Vorurteile<br />
dadurch, dass man den Kontakt untereinander meidet und<br />
sich an der eigenen Bezugsgruppe orientiert. Beredt ist<br />
man zwar allenthalben, aber weitgehend sprachlos, was die<br />
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen<br />
betrifft.<br />
Solche Vorurteile beinhalten immer auch Unkenntnis. Häufig<br />
wissen zum Beispiel die Produzenten und Entscheider<br />
nicht, was die Nutzer und Endverbraucher eigentlich wollen,<br />
wie sie Gebäude und Stadt wahrnehmen, nutzen, was sie<br />
aus welchen Gründen schön oder hässlich finden, welche<br />
Bedürfnisse und Interessen sie haben. Eine Zeit lang spran-<br />
68<br />
gen hier die Sozialwissenschaften helfend ein, aber die fragt heute kaum<br />
noch jemand. Ihre Lücke füllt in zunehmendem Maße die Marktforschung,<br />
gerade weil der Immobilienmarkt so unstet geworden ist. Der eigentlich<br />
naheliegende Versuch direkter Verständigung – zwischen Produzenten und<br />
Nutzer – wird selten unternommen. Insofern steckt in der unschuldig daher<br />
kommenden Überlegung, es müsse bei der Förderung der Baukultur letztlich<br />
darum gehen, dass die Menschen „sich in ihren Häusern, ihren Städten<br />
wohler fühlen…“ (Rauterberg in: Förderverein 2001, S. 41) gleich in mehrfacher<br />
Hinsicht Sprengkraft: Fühlen sie sich wirklich so unwohl? Wer fragt<br />
sie denn? Und: Würde jemand die Antworten ernst nehmen, die dann zu<br />
hören wären?<br />
Dieses seit alters her bekannte Kommunikationsproblem wird ergänzt und<br />
erweitert durch neuere Aufgaben, die gleichfalls mit den Baukultur-Initiativen<br />
thematisiert werden. So ist die Rede davon, dass auf die Leistungen der<br />
baulichen Berufsstände aufmerksam gemacht werden soll. Diese Marketingbemühungen<br />
richten sich an die hiesige Öffentlichkeit, sollen aber auch<br />
Investoren und Bauherren in aller Welt ansprechen, auf dass deutsche Baudienstleistungen<br />
noch deutlicher als wichtiges Exportgut sichtbar werden<br />
(vgl. auch BMVBW S. 52). Auch der Strukturwandel vieler Städte gibt Anlass<br />
zu mehr Kommunikation: Die Folgen wirtschaftlicher Umbrüche und demographischer<br />
Verwerfungen lassen sich nur in gemeinsamen Anstrengungen<br />
bewältigen. Damit wird zugleich auf tief greifende Rollenveränderungen in<br />
der Aufgabenverteilung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft verwiesen:<br />
Der Staat kann nicht (mehr) alles richten. Kooperationen sind unverzichtbar –<br />
auf allen Ebenen und zwischen verschiedenen Beteiligten (vgl. Selle 2005),<br />
Kooperationen, die ohne intensive Verständigungsarbeit nicht zu haben<br />
sind.<br />
Der Bedarf an Kommunikation ist also groß und besteht aus den verschiedensten<br />
„Kommunikationen”:<br />
- Marketing: Die Öffentlichkeit soll von den Leistungen der Architekten und<br />
Ingenieure in Kenntnis gesetzt werden;<br />
- Qualitätsdiskurs: Alle am Planen und Bauen Beteiligten sollen in Diskurse<br />
über mehr Qualität eingebunden werden;<br />
- kommunikative Projektentwicklung: Einzelne Vorhaben sollen in offenen<br />
und transparenten Verfahren unter Einbeziehung aller relevanter Akteure<br />
projektiert und realisiert werden;<br />
- Kooperation: Für viele Aufgaben sind Partner zu gewinnen und in<br />
gemeinsam getragene Prozesse einzubinden.<br />
Aber reicht das, um die bislang zu beobachtende Sprachlosigkeit zwischen<br />
den verschiedenen Gruppen zu überwinden? Wohl kaum, wenn über die<br />
Verkündung guter Absichten hinaus nicht auch Konkretes geschieht.
3. Jenseits der Sonntagsreden: Konkret werden<br />
Schon beim Blick auf Kultur und ihre Debatten wird immer<br />
wieder deutlich: Allgemein lässt sich gut und wohl tönend<br />
über sie reden, konkret wird es schwierig, kontrovers, gelegentlich<br />
laut und misstönend. Ganz ähnlich verhält es sich<br />
mit Kommunikation und Baukultur. Beide sind untrennbar<br />
miteinander verbunden – in den Sonntagsreden. Sollen die<br />
guten Absichten in den Alltag hinüber gerettet, soll die<br />
kommunikative Dimension von Baukultur praktisch wirksam<br />
werden, beginnen die Herausforderungen. Einige notwendige<br />
Schritte auf dem Weg vom Programm zur Praxis seien<br />
hier kurz angesprochen:<br />
Mit der Förderung der Baukultur werden viele Ziele zugleich<br />
verfolgt; entsprechend breit gestreut sind die Kommunikationsversprechen<br />
und -erwartungen. Das kann nun nicht in<br />
einem unspezifischen Kommunikationsangebot „an alle“<br />
münden. Dann fühlt sich niemand angesprochen und der<br />
Kommunikationsversuch geht im allgemeinen Informationsrauschen<br />
unter. Es liegt daher nahe, nach verschiedenen<br />
Zusammenhängen zu differenzieren und einfache Fragen zu<br />
stellen: Wer soll angesprochen, über was kann und soll mit<br />
welchen Zielen geredet und welche Ergebnisse können<br />
erwartet werden? Bei der Beantwortung solcher Fragen (vgl.<br />
Selle 2000) wird man Handfestes bieten müssen: „Baukultur<br />
muss … konkret werden. Der öffentliche Sektor wird auch<br />
weiterhin seine Vorbildfunktion wahrnehmen und baukulturell<br />
vorbildliche Projekte unterstützen“. Diese Forderung<br />
(in: MSWKS 2001b, S.15) weist in die notwendige Richtung:<br />
Prioritäten setzen und Konkretes in Aussicht stellen, zu dessen<br />
Einlösung man sich selbst verpflichtet. Das bedeutet<br />
zum Beispiel: Auf welche Weise soll der Diskurs der Fachleute<br />
verstetigt werden? Wie kann erreicht werden, dass<br />
öffentliche Vorhaben an offene Qualifizierungsverfahren<br />
gebunden werden? Wie ist sicherzustellen, dass Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
bei hervorgehobenen Maßnahmen auf<br />
Verfahrensstandards verpflichtet wird, die über aufwändige<br />
Internetpräsentationen und Einzelevents hinausgehen?<br />
Denn es steht ja durchaus nicht zum Besten mit der Kommunikation – selbst<br />
bei den besonderen Projekten: Da wird ein Vorhaben durchgepeitscht, weil<br />
die Investition „keinen Aufschub mehr duldet“ und dort bedient man sich<br />
ohne weiterer Worte (und fern vom Gedanken an Wettbewerbe oder ähnliches)<br />
wieder des wohlbekannten Entwicklers und seines Architekten,<br />
denn „da weiß man, was man hat“. Hier vereinbart der Oberbürgermeister<br />
höchstpersönlich mit dem Investor alles Wesentliche und selbst das Stadtparlament<br />
erfährt erst davon, wenn schon die Beschlussdrucksache auf den<br />
Pulten liegt. Und dort wird die Öffentlichkeit einmal mehr mit den wohlbekannten<br />
Pro-Argumenten für ein Projekt abgespeist und alles, was dagegen<br />
zu sprechen schien oder doch eine kritische Revision nahe legte, ist weggewogen,<br />
glattgebügelt, beiseite gewischt.<br />
A propos Öffentlichkeit: Gerade bei den als baukulturell bedeutsam eingestuften<br />
Vorhaben kann man von Verantwortlichen Sätze hören wie „Das<br />
ist zu wichtig, das lasse ich mir nicht zerreden“ oder etwas zurückhaltender,<br />
aber mit gleicher Wirkung: „An dieser Stelle ist Bürgerbeteiligung nicht<br />
zielführend“. Und viele, die daran festhalten, dass die Bürger mit ins Boot<br />
geholt werden sollen, meinen bei genauerem Hinschauen vor allem publikumswirksame<br />
Events. Dagegen wäre ja nichts zu sagen, wenn man sich<br />
zugleich der Mühen eines offenen Prozesses unterzöge, einer Projektentwicklung,<br />
die die Öffentlichkeit wirklich als Partner ernst nimmt. Das heißt<br />
keinesfalls, ihr populistisch hinterher zu laufen. Denn Partner ist jemand,<br />
dessen Sichtweise wichtig ist und ernst genommen wird, mit dem man sich<br />
aber selbstverständlich auch streiten kann und muss. Der Weg zu einer solchen<br />
partnerschaftlichen Kommunikation in der Baukultur ist noch weit und<br />
viele, da darf man sicht nichts vormachen, sind (noch) nicht bereit, ihn zu<br />
gehen.<br />
69
4. Einbahnstraßenkommunikation: Wessen Baukultur?<br />
Kommunikation in Sachen Baukultur bedeutet für viele in erster Linie:<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Andere sollen von den eigenen Anliegen überzeugt<br />
werden, es gilt, Interesse zu wecken, Breitenwirkung zu erzielen – legitime<br />
Anliegen allesamt. Aber das ist nur eine Seite der Kommunikation – die<br />
Information, der Monolog, die Einbahnstraße.<br />
Damit ist keinesfalls gesagt, dass nicht schon die Mitteilung der eigenen<br />
Sichtweisen eine Herausforderung darstellte. Eine kurze Geschichte soll das<br />
illustrieren:<br />
Vor einigen <strong>Jahre</strong>n wurden in einem Fernsehbericht die Planungen für eine<br />
Innenstadt irgendwo in der deutschen Provinz vorgestellt. In einer längeren<br />
Sequenz zeigte man, wie der Planer seine Entwürfe erläuterte. Dann ein<br />
Schnitt: Der Planer, vor dem Plan im Hintergrund, ohne Ton – und dann<br />
quer übers Bild geworfen Schlagworte aus seiner Rede. Das reichte von<br />
„Urbanität“ und „optimaler Dichte“ über „Einzelhandelsbesatz“, „Kammerschließung“,<br />
„Kerngebietsnutzung“ oder „Lauflage“ bis hin zur „reizvollen<br />
Raumfolge“ und dem „besonderen Charme gerade dieses Ortes“. Am Schluss<br />
waren Planer und Plan nicht mehr zu erkennen, nur mehr Fetzen eines<br />
Fachjargons. Viele Worte – keine Verständigung: beredte Sprachlosigkeit.<br />
Mit polemischer Absicht wurde hier deutlich gemacht, wie wenig die<br />
sprachliche Innenwelt eines Berufsstandes zur Kontaktaufnahme mit anderen<br />
Welten taugen kann. Das gilt für viele Fachleute aus unterschiedlichen<br />
beruflichen Welten. Gelegentlich keimt jedoch der Verdacht, dass einem<br />
Teil der Bauschaffenden die Kommunikation über ihre Inhalte besonders<br />
schwer fällt. Architekten etwa seien, hieß es in einer deutschen Tageszeitung<br />
(SZ v. 27./28. 7. 2002, S. 14) „sprach- und kommunikationsgestörte<br />
Autisten“. Das ist scharf formuliert. Aber so ganz von der Hand weisen sollte<br />
man diese Kritik nicht. Könnte es nicht sein, dass mit dieser überspitzten<br />
Formulierung eine déformation professionel getroffen wird, die sich in dem<br />
nicht selten gehörten Satz manifestiert: „Mein Entwurf spricht für sich“?<br />
Einige der Architektenstars, die überall auf der Welt bauen, werden gerne<br />
als „charismatische Persönlichkeiten“ und „große Kommunikatoren“ bezeichnet.<br />
Sie vermögen Bauherren und Öffentlichkeiten von ihren Ideen zu<br />
überzeugen und verfügen gelegentlich sogar noch über kommunikative<br />
Langstreckenqualitäten, wenn es um die Mühsal der Umsetzung eines großen<br />
Wurfs in bau- und finanzierbare Konzepte geht. Das legt die Einsicht nahe,<br />
dass „erfolgreich ist, wer verstanden wird“ (Haupt/Kubitza, 2002, S. 72).<br />
Aber so sehr verbreitet scheinen diese Einsicht und die damit verbundenen<br />
Fähigkeiten noch nicht zu sein. Das mag schon im Studium angelegt sein,<br />
wo die subjektive Selbstentäußerung gefördert und die Herausbildung kommunikativer<br />
Fähigkeiten – trotz aller Bekenntnisse zu den soft skills – häufig<br />
vernachlässigt wird.<br />
70<br />
Aber es gibt noch einen tiefer gehenden Grund, den Architekten<br />
und Planer mit vielen anderen Fachleuten teilen: Man<br />
erwartet nichts von der Kommunikation mit Fachfremden.<br />
Denn die „verstehen ja ohnehin nichts von der Sache“. Im<br />
Zweifel zerreden die anderen nur die fachlich doch so überzeugende<br />
Lösung. Dass hinter solcher Haltung ein grundlegendes<br />
Missverständnis von der Sache und der Rolle der<br />
Fachleute steht, wurde schon oft erläutert (vgl. z.B. Corboz<br />
2002, S. 50 oder Selle 2000, S. 159 ff.) – aber viel geändert<br />
hat sich noch nicht.<br />
Bei der Baukultur gibt es noch eine besondere Zuspitzung:<br />
Die anderen, sie verstehen nicht nur nichts von der Sache,<br />
sie haben auch keinen Geschmack. Wer den Ekel hört, mit<br />
dem die Baumarkt-Kultur gebrandmarkt wird, wer die Häme<br />
sieht, mit der auf den „Letzten Seiten“ mancher Bauzeitschriften<br />
Alltagsarchitekturen vorgeführt werden, der erkennt,<br />
wie tief die Abneigung sitzt, jene, die nicht die eigene<br />
ästhetische Auffassung teilen, als Gesprächspartner ernst<br />
zu nehmen. Was Wunder, dass viele Bekenntnisse zur Kommunikation<br />
in und über Baukultur zu ästhetischen Erziehungsversuchen<br />
geraten. Da ist die Gefahr der „Geschmacksdiktatur“<br />
nicht fern (vgl. Göschel 2003, S. 38).<br />
Aber eigentlich ist ja bekannt, was wirklich Not tut. Im<br />
„Statusbericht Baukultur in Deutschland“ (BMVBW 2001,<br />
S. 50) heisst es: „Eine verbesserte Bürgerbeteiligung verlangt<br />
von den professionellen Planern, von Politik und Verwaltung<br />
eine verständliche Sprache der Darstellung und<br />
die Bereitschaft, sich auf die Diskussion einzulassen (…).<br />
Planungen, die auf breite Akzeptanz bei den Bürgern setzen,<br />
müssen alle Akteure in der Kommune einbinden; sie<br />
setzen den Willen zum Konsens voraus. Prozessorientierte<br />
Kooperationsformen haben jedoch nur dann Erfolg, wenn<br />
der Prozess ergebnisoffen geführt wird.“<br />
Verständliche Sprache, Einbindung vieler Akteure, Wille zum<br />
Konsens und ergebnisoffene Prozesse – klare Anforderungen<br />
sind das. Aber die Bereitschaft, sich ihnen (mit allen<br />
Konsequenzen für die eigene Rolle) zu stellen oder gar die<br />
Fähigkeit, sie umzusetzen, haben noch Seltenheitswert.<br />
Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Ansätze nachdrücklich<br />
zu fördern und zu ihrer Verbreitung beizutragen – auf<br />
dass Anspruch und Wirklichkeit ein wenig näher zueinander<br />
finden.
5. Mehr als Mitreden: Auf wem Weg zur res publica?<br />
„Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, sich in die Gestaltung ihres Wohnumfeldes,<br />
ihres Stadtquartiers oder ihrer Innenstadt einzumischen. Baukultur<br />
wird letztendlich aus Engagement gemacht. Sie hat nur eine Chance,<br />
wenn sie als aufklärerisches und demokratisches Projekt verstanden wird“<br />
(Vesper in: MSWKS 2001b, S.13). Die Bitte des Ministers richtet sich nicht<br />
an die Fachleute, an Politik und Verwaltung, sondern an die Bürgerinnen<br />
und Bürger. Sie sollen, wie er an anderer Stelle (in: Boll u.a. 2004, S. 9)<br />
ergänzt, „die Zukunft der Stadt wieder selbst in die Hand“ nehmen. Hier<br />
geht es nicht mehr um Öffentlichkeitsarbeit der Verbände, um transparente<br />
Wettbewerbsverfahren, verständliche Information über Planungsabsichten<br />
und sinnvolle Beteiligungsangebote, sondern um die andere Seite der gleichen<br />
Medaille: um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, ihr eigenes<br />
Handeln, ihren Beitrag zur Entwicklung der Städte.<br />
Skeptische Geister könnten hier einwenden, solche Forderungen resultierten<br />
aus der Einsicht in die begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten öffentlicher<br />
Akteure und hätten lediglich den Blick frei gemacht für die Potenziale der<br />
lokalen Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist sicher nicht von der Hand zu<br />
weisen – und doch weniger als die halbe Wahrheit. Michael Vesper verweist<br />
darauf, dass es hier auch um ein demokratisches Projekt geht. Und wenn<br />
davon die Rede ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft der Städte<br />
wieder selbst in die Hand nehmen sollen, dann ist das auch historisch<br />
betrachtet sehr berechtigt: Schließlich haben die vielfältigen gemeinschaftsbezogenen<br />
Aktivitäten der lokalen Zivilgesellschaft eine lange Tradition. Die<br />
allerdings muss heute erinnert und in zeitgemäße, neue Formen übersetzt<br />
werden. Die Arbeit daran hat eben erst begonnen.<br />
Letztlich geht es um etwas sehr Altmodisches: Die Stadt soll wieder als res<br />
publica, als gemeinsames Anliegen verstanden werden. Es gilt, deutlicher<br />
noch als bisher, die unter allgemeinem Wohlklang von „Kommunikation<br />
und Baukultur” verborgenen Defizite sichtbar zu machen, nachdrücklich auf<br />
die Notwendigkeit hinzuwirken, eigene Positionen und Rollen zu verändern<br />
(und dies nicht immer nur von den anderen zu verlangen) und vor allem<br />
eine Veränderung der Praxis zu ermöglichen. Aber es ist bei all der Mühsal,<br />
die damit verbunden ist, wichtig, die Alltagsarbeit auf die Ziele hin zu<br />
bedenken, die mit ihr verfolgt werden. Denn es geht eben nicht nur um die<br />
Verbesserung des Marketings hier oder die kommunikative Lösung eines<br />
Konfliktes dort. Es geht um Kultur, um Politik, um Demokratie, einfacher<br />
gesprochen: um den Umgang mit gemeinsamen Aufgaben und Anliegen.<br />
Dieses Verhältnis zwischen weit reichenden Bezügen, Utopien womöglich,<br />
und alltäglichen kleinen Schritten hat niemand so schön beschrieben wie<br />
der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer (2002, S. 85). Ihm gebührt daher<br />
das letzte Wort:<br />
„Ach ja. Ach je. Natürlich ist das eine Utopie. Aber Utopien sind nicht dazu<br />
da, auf der Stelle Wirklichkeit zu werden. Jetzt und sofort und genau so. Sie<br />
dienen aber durchaus dazu, auch fern liegende Möglichkeiten und Hoffnungen<br />
einmal zu bedenken. Damit wir dann, im wirklichen Leben, in jene Richtung<br />
gehen können, sei der Weg noch so mühselig und seien die Schritte<br />
noch so klein. Immerhin gehen wir dann nicht in die Gegenrichtung“.<br />
Literatur<br />
Bischoff, A. u.a.: Informieren, Beteiligen, Kooperieren (Neubearbeitung).<br />
Dortmund 2005<br />
Boll, J. u.a. (Hg): Bürger machen Stadt. Zivilgesellschaftliches Engagement<br />
in der Stadterneuerung – Ein Projektbuch. Dortmund 2004<br />
BMVBW (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen)<br />
(Hg): Statusbericht Baukultur in Deutschland. Berlin 2001<br />
Corboz, A.: Die Kunst, Stadt und Land zum Sprechen zu bringen.<br />
Bauwelt Fundamente Bd. 123. Basel 2002<br />
Eagleton, T.: Was ist Kultur? Eine Einführung. München 2001<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum u.a.: BauKultur.<br />
Auf dem Weg zur Nationalen Stiftung. Berlin / Bonn 2002<br />
Göschel, A.: Baukultur – Chancen und Defizite eines Programms symbolischer<br />
Politik. in Fritz-Händeler, R., Möller, B. (Hg): Politikfeld Baukultur.<br />
Potsdam 2003, S. 37 ff<br />
Fritz-Händeler, R. Möller, B. (Hg): Politikfeld Baukultur. Potsdam 2003<br />
Haupt, E., Kubitza, M. (Hg): Marketing und Kommunikation für Architekten.<br />
Basel 2002<br />
MSWKS (Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen) (Hg): Memorandum <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>.<br />
Düsseldorf 2001<br />
MSWKS (Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen) (Hg): <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> –<br />
Dokumentation der Auftaktveranstaltung am 9.11.2001. Düsseldorf 2001<br />
Negt, O.: Was ist Kultur? Vortrag zum 10. Bestehen des kulturwissenschaftlichen<br />
Studiengangs an der Universität Bremen vom 29.11.1996. unter<br />
http://www.dickinson.edu/departments/germn/glossen/heft3/negt.html<br />
Reuther, I., Stiess, S., Schiffers, B.: Baukultur in ExWoSt – Ein Verständigungsversuch.<br />
Kurzfassung der Dokumentation im Auftrag des Bundesamtes für<br />
Bauwesen und Raumordnung. Bonn/Leipzig 2004, S. 5<br />
Rösener, B., Selle, K. (Hg): Kommunikation gestalten. Beispiele und<br />
Erfahrungen aus der Praxis für die Praxis. Dortmund 2005<br />
Selle, K.: Was? Wer? Wie? Warum? Voraussetzungen und Möglichkeiten<br />
einer „nachhaltigen“ Kommunikation. Dortmund 2000<br />
Selle, K. u.a.: Kommunikative Elemente der Planungskultur. Der Beitrag des<br />
Landes zur Qualitätsentwicklung vor Ort. Neuauflage (Erstdruck Herbst 2001)<br />
Aachen 2004<br />
unter http://www.pt.rwth-aachen.de/publikationen/pt_materialien.php<br />
Selle, K.: Planen, Steuern, Entwickeln. Über den Beitrag öffentlicher Akteure<br />
zur Entwicklung in Stadt und Land. Dortmund 2005<br />
Vesper, M.: Rede anlässlich des Kongresses „Stadt machen! Ziele und<br />
Projekte“ am 1. Februar 2001, Zeche Zollverein Essen (unveröff. Ms.)<br />
Widmer, U.: Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück. Zürich 2002<br />
71
Dietmar Steiner<br />
Architektur vom Nullpunkt<br />
Man stelle sich vor, es gäbe gar keine Kunst der Architektur und auch nicht<br />
ihre Geschichte. Würde uns etwas fehlen? Möglicherweise. Möglicherweise<br />
aber auch nicht. Eine ganze, sich angeblich mit Architektur beschäftigende<br />
akademische Kaste wäre ganz einfach nicht vorhanden. Und auch die Profession<br />
der Architekten selbst wäre bloß in ein allgemeines Baugeschehen<br />
eingegliedert. Architektur als Begriff verbliebe im allgemeinen Sprachgebrauch<br />
bei der Architektur der Europäischen Gemeinschaft, bei der Architektur<br />
von Unternehmensstrukturen oder der Architektur von Computern.<br />
Man stelle sich also vor, es gäbe keine Architekturgeschichte, keine Architekten,<br />
keine Architekturstudierende. Niemand studiert, niemand sammelt,<br />
niemand archiviert Architektur. Eine unvorstellbare Vorstellung?<br />
Möglicherweise. Aber dennoch, und davon bin ich überzeugt, würde Architektur<br />
entstehen. Denn irgendjemand, der nie von Architektur gehört, der<br />
das Wort nicht kennt und nicht das Metier, irgendjemand würde etwas<br />
bauen, das eben mehr als bauen ist.<br />
Architektur entsteht, irgendwo, irgendwann, und niemand kann sie verhindern.<br />
Architektur ist immer da. Aber von Zeit zu Zeit muss man das Metier,<br />
in dem man sich befindet, einfach wieder einmal vom Nullpunkt an denken.<br />
Das ist eine Frage, die sich jenen, die sich im Metier befinden, nur sehr<br />
selten stellt. Denn sie leben ihre Rollen, müssen allein schon zur Rechtfertigung<br />
ihrer Existenz an die Existenz von Architektur glauben. Ob jedenfalls<br />
Architektur eine eigenständige künstlerische Disziplin ist oder sein soll, will<br />
ich jetzt einfach als Frage und Behauptung so stehen lassen. Schließlich hatte<br />
schon der österreichische Volksschauspieler Hans Moser in „Hallo Dienstmann“<br />
den legendären Satz genuschelt: „Auf gebaut kommt’s nicht an“.<br />
Architektur heute vom Nullpunkt zu denken, ist keine Willkür. Denn die<br />
Architektur befindet sich am Nullpunkt. Warum? Weil sie eine Konjunktur<br />
im öffentlichen, im medialen, im politischen Leben hat wie niemals zuvor.<br />
Niemals zuvor in der Geschichte war Architektur populärer als heute. Und<br />
niemals zuvor gab es so viele Architekten, Architekturstudierende, Architekturmuseen,<br />
-archive, -medien. Aber niemals zuvor konnten wir uns darüber<br />
so wenig verständigen, was überhaupt zur Architektur gezählt werden soll,<br />
wie heute!<br />
72<br />
Was Architektur zur Kultur beiträgt<br />
Als die Architektur noch Ideologie war<br />
Die Nachkriegszeit in Europa lebte von den Modernitätsversprechungen<br />
des Wiederaufbaus. Architektur war ein Mittel<br />
zur Überwindung des Faschismus, der gleichgesetzt wurde<br />
mit allen formalen Traditionalismen. Architektur war ein<br />
Minderheitenprogramm der kulturellen Avantgarde, das<br />
sich aber gutgläubig mit der entwickelten Bauindustrie verband.<br />
In den sechziger <strong>Jahre</strong>n opponierte dagegen die utopische<br />
und politisierte architektonische Avantgarde, schon<br />
affirmativ bereit für die neue Popkultur. Ein wenig bedenklich<br />
vielleicht, dass fast alle Stars von damals es bis heute<br />
geblieben sind. Aber Architektur ist eben eine langdauernde<br />
Kunst, auch biographisch.<br />
Dann kam Anfang der siebziger <strong>Jahre</strong> der Paradigmenwechsel,<br />
der Modernitätsbruch: Die Wiederentdeckung des Urbanen,<br />
des Regionalen und der Geschichte mit der Postmoderne,<br />
aber auch als Nachschein der Sehnsucht der Studentenrevolte<br />
nach dem wirklichen Leben die Entdeckung und Verwandlung<br />
des Alltäglichen. Die Zukunft blieb auch in den<br />
achtziger <strong>Jahre</strong>n gebrochen. Ridley Scotts „Blade Runner“<br />
zeigte uns erstmals, dass auch in ferner Zukunft nicht alles<br />
neu gebaut sein wird. Im Besichtigungsbus der Internationalen<br />
Bauausstellung Berlin erzählten Senatsbeamte mit säuerlicher<br />
Miene von den großen Fortschritten im Zeilenwohnungsbau<br />
der sechziger <strong>Jahre</strong>, als den Menschen Licht, Luft<br />
und Sonne geboten wurde, und bedauerten eigentlich, dass<br />
heute die ausländischen Stararchitekten wieder die alte<br />
enge Stadt bauen wollen.<br />
Jawohl, es war schön und spannend, in den sechziger, siebziger,<br />
und auch noch in den achtziger <strong>Jahre</strong>n, als mit Argumenten<br />
und Verleumdungen um die richtige oder falsche<br />
Architektur gekämpft wurde, als Positionen mit Theorien<br />
belegt wurden. Es war schön und spannend, aber es war<br />
eine verdammte Insiderdiskussion, der wahrscheinlich nicht<br />
mehr als rund 500 Architekten und Intellektuelle der westlichen<br />
Hemisphäre wirklich folgen konnten und wollten.<br />
Eine akademisch zerstrittene, aber insgeheim verschworene<br />
Gemeinschaft, die den Rest der wirklichen Welt arrogant<br />
ignorierte.
Als die Architektur entdeckt wurde<br />
Und auf einmal herrschte große Verwirrung. Entlang der<br />
letzten fünfzehn <strong>Jahre</strong> lösten sich alle allgemeinverbindlichen<br />
innerarchitektonischen Kriterien der Architektur auf. Nicht<br />
anders als die Gesellschaft, deren Lebensstile und Kulturen<br />
sich zunehmend fragmentierten. Manche wollten noch zwischen<br />
einer transnationalen kapitalistischen und einer subalternen<br />
lokalen Klasse unterscheiden, obwohl die hybride<br />
Existenz zum Daseinsprinzip geworden war. Im Design verschwindet<br />
die „gute Form“ und kommt als saisonaler Lifestyle<br />
wieder.<br />
Und auf einmal war die Postmoderne als Stil zumindest im<br />
inneren Diskurs der Architektur erstarrt. Sie fand ihr letztes<br />
Aufbäumen im Dekonstruktivismus und wurde abgelöst<br />
von Computerprogrammen, die zumindest auf den Bildschirmen<br />
– und mit viel Bastelei auf den Baustellen – den<br />
Colani-Kitsch der sechziger <strong>Jahre</strong> zum mainstream einer<br />
heutigen Formsprache exhumierten. Wie sagte schon Friedrich<br />
Kittler in den achtziger <strong>Jahre</strong>n: „Das Werkzeug bestimmt<br />
das Sprechen.“<br />
So kann heute niemand mehr unterscheiden, ob es sich bei<br />
all dem was heute auf dem so genannten Markt ist, das heißt<br />
die rund 100 wichtigsten internationalen Architekturmagazine<br />
dekoriert, um gute oder schlechte Architektur, um<br />
wichtige oder unwichtige Bauten oder Projekte handelt.<br />
Alles beschleunigt den Kulturbetrieb, ist ein zumindest<br />
mediales Event oder findet einfach nicht statt.<br />
Vor einigen <strong>Jahre</strong>n noch beklagte ich bei einer Podiumsdiskussion<br />
im Netherlands Architecture Institut, dass jeder<br />
Architekt heute seine Individual-Theorie vor sich her trage,<br />
ohne sie am Bau zu erkennen, und wurde von einem Vordenker<br />
der amerikanischen Universitätsdebatte belehrt, dass<br />
die Theorie eben zum Marketing dazugehöre. Das ist nun<br />
wieder vorbei: Die Theorie wurde von Business-Plänen ersetzt<br />
und die jungen Architekten sind dank Studium aller Lehrbücher<br />
über Architekturmarketing noch vor dem ersten Bau<br />
mediale Superstars. Vor einiger Zeit wurde dem Architekturzentrum<br />
Wien von einer Kunstgalerie das Archiv einer jungen,<br />
berühmten boys and girls group angeboten, die sich noch<br />
vor dem ersten richtigen Bauauftrag schon wieder aufgelöst<br />
hatte.<br />
Wir befinden uns heute in einer Übergangsphase. Aber alle<br />
Auguren sagen uns, dass wir uns für die gesamte Zukunft<br />
nur mehr in Übergangsphasen befinden werden. Übergangsphase<br />
heute bedeutet zunächst einmal einen anhaltend<br />
postmodernen Zustand. Ein Zustand, der alle alten Trennungen<br />
von Hochkultur und Alltagskultur verlassen hat, der keiner<br />
einzelnen Ideologie einen Charakter der Ausschließlichkeit<br />
zubilligen kann.<br />
Übersetzt auf die Kulturtechnik der Architektur ist die Trennung<br />
von kulturell wichtigen Künstlerarchitekten und den<br />
marktkonformen Architekturfirmen, die noch in den achtziger<br />
<strong>Jahre</strong>n in der Szene klar war, heute aufgehoben. Wenn<br />
beispielsweise Peter Cook, der ewige Avantgardist, nach<br />
seiner ersten Bauerfahrung seine Zukunft als Design-Berater<br />
von HOK, einer der weltgrößten Business-Architekturfirmen,<br />
sieht, dann sollen wir darin nicht die tragische Selbstaufgabe<br />
eines alten Mannes erkennen, sondern die veränderten<br />
Rahmenbedingungen der Architektur akzeptieren.<br />
„Great Atttention, Less Seriosity“<br />
Great attention, less seriosity spottet Rem Koolhaas heute<br />
und hat verdammt recht damit. Die Diamanten der Star-<br />
Architekten verbreiten sich wie spam mails über den Erdball.<br />
Sie folgen alle der vielzitierten Ökonomie der Aufmerksamkeit,<br />
obwohl sie vielfach diese wegen Übersättigung gar<br />
nicht mehr erfüllen können. Und die great attention hat<br />
sich ausgebreitet und ausgeweitet. Schon erklimmen spekulative<br />
Freizeitlandschaften wie die Neunutzung der Zeppelin-<br />
Halle und das Design von Formel 1-Strecken die ernsthaften<br />
Architekturmagazine. Michael Eisners Disney-Architektur-<br />
Strategie hat das bereits in den neunziger <strong>Jahre</strong>n vorgelebt.<br />
Warum wohl hat dann Arata Isozaki sein Team Disney Building<br />
in Orlando von 1991 niemals selbst besichtigt? Immerhin<br />
das architektonisch beste Gebäude, das Disney jemals<br />
zusammengebracht hat.<br />
Aber was wäre das Gegenteil davon? Less attention – Great<br />
seriosity? Von Prince Charles und den Kriers, den anhaltend<br />
stilistisch Postmodernen wie Robert Stern oder Michael<br />
Graves, bis hin zum amerikanischen New Urbanism und<br />
Vittorio Magnago Lampugnanis neuem Konservativismus<br />
73
oder den Berliner Steinbaumeistern reicht die Palette derer,<br />
die eine Rückkehr zur Konvention des Bauens fordern.<br />
Jawohl, es wäre dann „Baukultur“, wenn sie sich durchsetzen<br />
könnte. Wir hätten dann wieder verbindliche Konventionen,<br />
wir hätten dann wieder, in neuen Spuren nur und<br />
das ist wichtig, harmonische Dörfer und Städte. Wir hätten<br />
den Verlust der Kultur kompensiert. Aber welche Kultur hätten<br />
wir dann? Die Kultur des Films „The Truman Show“,<br />
einer künstlichen Idylle, die zwar zufällig, aber doch treffend<br />
im realen New Urbanism-Pilotprojekt Seaside in Florida<br />
gedreht wurde. Das ist nicht gerade die great seriosity, die<br />
gefordert wird. Eine gegenwärtige Wiederkehr im Historischen<br />
ist sicherlich kein heutiges Leben im falschen Bewusstsein,<br />
wie viele Ewigmodernen gerne behaupten würden.<br />
Schließlich ist mit dem kompletten Wiederaufbau der Akropolis<br />
oder dem Weiterbau an der Sagrada Familia längst<br />
auch symbolisch das Leben im historisch Inszenierten beschlossen<br />
– und bleibt doch nur eine touristische Marginalie.<br />
Die great attention hat jedenfalls der Architektur eine bislang<br />
nicht bekannte öffentliche und mediale Aufmerksamkeit<br />
gebracht. Mit allen Konsequenzen. Eine davon ist das<br />
Ende der Expertenkultur. Kritik und Vermittlung finden sich<br />
entweder in der Rolle des Marketing-Agenten wieder oder<br />
weichen aus in die Paralleltexte der cultural studies, um von<br />
dort aus das Phänomen der Architektur an sich zu umkreisen.<br />
Individuelle kritische „Wertungen“ von Bauten und<br />
Positionen entpuppen sich als das, was sie seit langem auch<br />
in anderen Kulturdisziplinen sind: als neiderfüllte private<br />
Befindlichkeiten mit dem Odeur des pastorenhaft Unbefriedigten<br />
behaftet.<br />
Das ist die logische Folge des Verlusts aller verbindlichen<br />
Kriterien. Die kämpferische Moderne der Architektur hat<br />
sich im letzten Jahrhundert geboren und vollendet. Keinem<br />
stilistischen Code, keiner künstlerischen Ideologie folgend,<br />
aus reiner Gewohnheit baut sie einfach in der weltweiten<br />
Mittelschicht der Bauindustrie-Dienstleister weitgehend<br />
bewusstlos nach wie vor vor sich hin. Noch immer ausgestattet<br />
mit der Autorität des Berufsstandes des Architekten,<br />
die für sich das Versprechen auf eine bessere Welt behauptet.<br />
Würden wir den Architekten glauben, dann wäre alles besser,<br />
wäre es nur von Architekten geplant.<br />
Provokante Gegenfrage: Würden wir alle in einer Welt leben<br />
wollen, die nur von sogenannten engagierten Qualitätsarchitekten<br />
geschaffen wurde?<br />
74<br />
Wo ist der Nullpunkt?<br />
Diese kursorische Einschätzung der gegenwärtigen architektonischen Situation<br />
ist die Vorbedingung einer Suche nach dem Nullpunkt, von dem aus<br />
die Vermittlung von Architektur immer wieder beginnen muss. Und ich<br />
möchte das an den Aufgaben und Potenzialen einer Institution der Architekturvermittlung<br />
darstellen, die einfach zwischen der Entwicklung der Disziplin<br />
und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit steht. Als ich am Beginn<br />
bemerkte, dass man sich auch eine Welt ohne Architektur vorstellen möge,<br />
so bezog sich das auch auf die tatsächliche Situation der Vermittlung. Wir<br />
haben die paradoxe Situation, dass zwar alle Menschen von Architektur<br />
betroffen sind, alle auch irgendwie beim Bauen – das sie als Architektur<br />
bezeichnen – mitreden zu können glauben, aber absolutes Unverständnis<br />
und vollständige Unkenntnis über Architektur vorherrschend sind. Geschichte<br />
und Terminologie der Architektur sind nach wie vor ein relativ absolutes<br />
Minderheitenprogramm.<br />
Wir hatten mit dem Architekturzentrum Wien die großartige und einmalige<br />
Situation und Voraussetzung, geradezu experimentell fast alle Möglichkeiten<br />
heutiger Architekturvermittlung zu erproben. Architektur als kulturelle<br />
Verpflichtung, wir sagten als Lebensmittel, zu propagieren. Ausstellungen<br />
selbstverständlich, aber auch Workshops, Exkursionen, Kinderprogramme,<br />
Partnerschaften mit der Wirtschaft, Diskussionen, Präsentationen, Publikationen<br />
und die extensive Nutzung dessen, was seit Mitte der neunziger <strong>Jahre</strong><br />
über das Internet vermittelbar ist. Wien war und ist dafür ein heißes Pflaster.<br />
Sich und damit der Architektur Gehör zu verschaffen, ist im Umfeld eines<br />
reichen kulturellen Angebots besonders schwer.<br />
Was lernten wir daraus? Jawohl, wir haben für die Architektur politische<br />
und mediale Aufmerksamkeit erreicht. Nicht als institutionelle Kontrollinstanz,<br />
dazu fehlt die Macht. Aber immerhin konnten wir das Thema Architektur als<br />
kulturelle Aufgabe politisch und medial positionieren. Überraschend dabei<br />
war, dass für den Erfolg einer breiten Vermittlung das Starsystem der Architektur<br />
noch keine wirkliche Rolle spielt. Eine Star-Ausstellung bringt zwar<br />
mediale Aufmerksamkeit, aber letztlich auch nicht mehr Besucher als ein<br />
Alltagsthema mit lokaler Betroffenheit. Wogegen aber an inhaltlich phan-
tastischen Ausstellungen mit historisch bedeutender Architektur<br />
nahezu überhaupt kein Interesse besteht. Schon bald<br />
aber erkannten wir, dass eine zentrale Aufgabe von uns verlangt<br />
wurde: die eines Auskunfts-, Service- und Kompetenzzentrums<br />
für Architektur überhaupt. Archiv, Sammlung,<br />
Bibliothek waren gefordert, um, da ist sie wieder, die Architektur<br />
vom Nullpunkt, überhaupt die Frage nach der Sache<br />
selbst zu beantworten.<br />
Aber selbstkritisch muss gefragt werden, ob wir damit nicht<br />
den Event-Zirkus einer Minderheit verstärken und weiter<br />
bedienen. Star-name dropping und geile Renderings, flotte<br />
Sprüche und Events, die nur mehr für die Medien veranstaltet<br />
werden. Das bedient zufrieden stellend den medialen Markt<br />
der Aufmerksamkeit. Dabei beobachteten wir aber, dass das<br />
historische Wissen immer kürzer greift. Schon jetzt werden<br />
von anderen Veranstaltern Themen wiederholt, die wir in<br />
unserer kurzen Geschichte vor <strong>Jahre</strong>n bereits abgehandelt<br />
hatten.<br />
Wir ziehen daraus die Konsequenzen und reihen die Arbeit<br />
als „Schneepflug“ für die letzten News der Szene etwas<br />
zurück und entwickeln uns vorwärts zum Museum, das als<br />
Zwischenlager der kulturellen architektonischen Produktion<br />
zum Maßstab des Wertes wird. Aber welche Aufgabe haben<br />
wir heute in dieser Funktion?<br />
Das Sammeln von schönen Blättern, die historische Aufgabe<br />
von Architekturarchiven bleibt unverzichtbar für den kulturellen<br />
„Speicher“ der Gesellschaft. Dagegen aber hat uns<br />
die Architekturproduktion der Moderne neue Schwerpunkte<br />
beschert. Nicht mehr die künstlerische Zeichnung allein,<br />
sondern der gesamte Entstehungsprozess eines Bauwerks<br />
benötigt die archivarische und museologische Dokumentation.<br />
Wir müssen darüber Auskunft geben können, wie Architektur<br />
– als Idee und Bau – entsteht. Erst dann wissen wir, was<br />
Baukultur ist, und welchen Beitrag sie für eine allgemeine Kultur leistet.<br />
Wenn wir beispielsweise das Modell der Villa in Bordeaux besitzen, dann ist<br />
dies ein schönes Dokument. Wichtiger aber noch sind die zugehörigen<br />
Mappen mit den Kopien der Korrespondenz zwischen Rem Koolhaas, OMA<br />
und dem Bauherrn. Mit der Dokumentation der Prozesse verfügen wir über<br />
jenes Material, das analytisch und diskursiv die Qualitäten von Architektur<br />
aufarbeiten, aufbereiten und vermitteln kann. Und das ist viel mehr, als die<br />
Denkmalämter der bisher historischen Architektur widmen konnten.<br />
Indem wir die Architektur mit ihren Dokumenten nicht als singuläre künstlerische<br />
Leistung, sondern als Ergebnis eines wirtschaftlichen, technischen,<br />
sozialen und politischen Prozesses verstehen lernen, sind wir auch in der<br />
Lage, das einzelne Objekt der medialen Begierde als Teil einer allgemeinen<br />
Baukultur einzuordnen. Und auf einmal wird mit diesen Parametern jedes<br />
Objekt, jeder Bau zu einer Welterklärung. Ab diesem Moment verschwinden<br />
die Grenzen von Stararchitektur und der alltäglichen Bauproduktion. Beides<br />
wird gleich wichtig.<br />
Damit stehen wir als Wissens- und Kompetenzzentrum mit museologischem<br />
Ewigkeitsanspruch vor der Frage: Was ist Architektur? Und müssen wieder<br />
einmal eingestehen: Wir wissen es nicht! Wir können nur beobachten und<br />
analysieren, wohin sich das Interesse der Architekten und der „Markt der<br />
Architekturvermittlung“ entwickeln. Aber wir dürfen, kraft unserer Kenntnisse,<br />
diesem Interesse nicht bedingungslos folgen.<br />
Architektur vom Nullpunkt heißt für uns, das ständig neue Denken über die<br />
Kunst der Architektur anhand unseres Wissensspeichers zu erkunden, zu<br />
überprüfen, zu dokumentieren und zu präsentieren. Architektur vom Nullpunkt<br />
bedeutet für uns aber auch, diese Architektur mit einem allgemeinen<br />
öffentlichen Interesse an der gebauten Umwelt zu verbinden. Das führt zu<br />
einem ständigen Pendeln des Interesses zwischen den Kategorien des Erhabenen<br />
und des Alltäglichen, zwischen Szene und Öffentlichkeit.<br />
Und zum Schluss darf man auch den grundsätzlichen Unterschied zwischen<br />
Architektur und Architekturvermittlung nicht vergessen: Bauten müssen im<br />
Regelfall benutzt werden. Die Vermittlung aber findet nur statt, wenn man<br />
ein Publikum dafür interessieren und gewinnen kann.<br />
75
Achim Großmann<br />
In unserer Gesellschaft spielt gute Kommunikation eine immer größere Rolle.<br />
Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und bei dem Setzen von Themen<br />
hängt der jeweilige Erfolg von der Qualität und der Kreativität der Kommunikation<br />
ab. Für Baukultur gilt dies in besonderem Maße. Deshalb haben wir<br />
vor fünf <strong>Jahre</strong>n mit zahlreichen Partnern die „Initiative Architektur und Baukultur“<br />
ins Leben gerufen, um eine breite Öffentlichkeit für dieses Anliegen<br />
zu gewinnen.<br />
Eine überzeugende Definition des Begriffs Baukultur ist schwierig. Denn die<br />
Maßstäbe für Baukultur sind abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,<br />
von Werthaltungen, von ökonomischen, kulturellen, ökologischen<br />
und sozialen Anforderungen. Sie unterliegen naturgemäß einem ständigen<br />
Wandel.<br />
Daher stellt sich zunächst die Frage, wie wir mit unserer gebauten Umwelt<br />
umgehen. Wie planen, bauen und nutzen wir, so dass dabei hohe Qualität<br />
entsteht, sich die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft darin widerspiegeln,<br />
Städte attraktiv bleiben, Bürger sich wohl fühlen und der Standort Deutschland<br />
seine Leistungsfähigkeit und Anziehungskraft zeigt?<br />
Hinzu kommt eine Vielzahl der am Planen und Bauen beteiligten Akteure.<br />
Diese in den Auseinandersetzungsprozess einzubinden, ist ebenfalls eine<br />
große Kommunikationsaufgabe. Dabei geht es nicht nur um das Verhältnis<br />
einzelner Berufsgruppen zueinander, sondern vor allem um den „Schulterschluss“<br />
von Fachleuten und Bauherren. Eine bloße Fachdiskussion unter<br />
Fachleuten macht noch keine Baukultur aus.<br />
Und vor allem geht es um die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind die „Nutzer“<br />
von Baukultur.<br />
Um der Komplexität des Themas und der Vielzahl der Beteiligten gerecht<br />
zu werden, setzen wir in hohem Maße auf „Prozessqualität“, d.h. auf die<br />
Qualität von Verfahren. Damit sind die Verfahren der Bürgerinformation<br />
und -beteiligung bei der kommunalen Bauleitplanung gemeint, die Planungswettbewerbe,<br />
die verschiedenen Formen fachkundiger Beratung, Mediations-<br />
und Moderationsverfahren – und konkrete Teamarbeit am Einzelobjekt.<br />
Immer wichtiger wird dabei auch, private Bauherren und Investoren<br />
davon zu überzeugen, dass gute Verfahren die Chance guter Ergebnisse in<br />
sich tragen.<br />
76<br />
Die Bundesinitiative Architektur<br />
und Baukultur<br />
Fünf <strong>Jahre</strong> Stadtbaukultur in <strong>NRW</strong><br />
Als das Land Nordrhein-Westfalen vor fünf <strong>Jahre</strong>n die Initiative<br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> startete, stellte es sich damit als<br />
erstes Bundesland in Deutschland dem Wettbewerb der<br />
Regionen um baukulturelle Standortqualität. Zugleich griff<br />
es damit als eines der ersten Bundesländer die von der Bundesinitiative<br />
Architektur und Baukultur verfolgten Ziele auf.<br />
Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> nähert sich dem Begriff<br />
Baukultur unter dem Aspekt, in welchem Maße eine Gesellschaft<br />
dem Bauen und Planen Aufmerksamkeit, Energie und<br />
Kreativität widmet. Dieser Ansatz zielt – wie auch die Bundesinitiative<br />
Architektur und Baukultur – ganz wesentlich<br />
auf die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit ihrer<br />
gebauten Umwelt ab.<br />
Mit vielfältigen Maßnahmen und Instrumenten hat die<br />
Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> in den vergangenen fünf<br />
<strong>Jahre</strong>n ihr Augenmerk auf spezifische Schwerpunktthemen<br />
wie die Qualität des Bauens, die Gestaltung des öffentlichen<br />
Raumes oder den Denkmalschutz gelenkt. Veranstaltungen<br />
und Projekte wie „Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze“,<br />
„Straße der Gartenkunst <strong>NRW</strong>“ oder „kölnarchitektur“<br />
haben nicht nur in der Fachöffentlichkeit, sondern auch bei<br />
interessierten Bürgerinnen und Bürgern großes Interesse für<br />
die Belange der Baukultur geweckt.<br />
Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative und ihres Erfolges<br />
ist dabei ohne Zweifel die enge Kooperation mit zahlreichen<br />
Partnern, seien es Städte, Gemeinden, Kammern oder Verbände,<br />
die sich ebenfalls der Stärkung des Bewusstseins<br />
für Baukultur in Deutschland verschrieben haben. Der Netzwerkgedanke,<br />
d.h. konkret die Zusammenarbeit mit den<br />
im baukulturellen Bereich vorhandenen Institutionen, Verbänden<br />
und Akteuren, ist eine wichtige Voraussetzung, um<br />
Erfahrungen aus allen Ebenen und Bereichen aufzugreifen<br />
und gebündelt sichtbar zu machen. Denn Baukultur beschränkt<br />
sich nicht auf Architektur im engeren Sinne; sie<br />
umfasst gleichermaßen die Ingenieurbaukunst, Stadt- und<br />
Regionalplanung, Belange des Denkmalschutzes, Landschaftsarchitektur<br />
oder die Kunst am Bau und den öffentlichen<br />
Raum. Und sie entsteht in deutschen Städten und<br />
Gemeinden täglich neu und prägt damit wesentlich das<br />
Erscheinungsbild und die Lebensqualität in Regionen und<br />
Bundesländern.
Bedeutung von Baukultur in Deutschland<br />
Diese Mehrdimensionalität von Baukultur stellt eine wichtige<br />
Qualität dar, deren Förderung sich auch die Bundesregierung<br />
zum Ziel gesetzt hat. Deutschland ist das europäische<br />
Land mit dem höchsten Bauvolumen; mehr als die Hälfte<br />
aller Investitionen in Deutschland werden in der Baubranche<br />
getätigt. Diesem Sektor kommt daher eine hohe Priorität zu.<br />
Darüber hinaus spielt die Qualität der gebauten Umwelt für<br />
Standortentscheidungen von Investoren und die Selbstdarstellungen<br />
von Städten und Gemeinden eine zunehmend<br />
wichtigere Rolle. Städte und Regionen müssen neue Profile<br />
im internationalen Wettbewerb entwickeln. Dabei kann<br />
gerade die Architektur Gradmesser für das Leistungsvermögen<br />
und die Innovationskraft eines Standortes sein. Auch<br />
der Bund als öffentlicher Bauherr bekennt sich mit seinen<br />
Projekten zu seinen baupolitischen Zielen.<br />
Bundesinitiative Architektur und Baukultur<br />
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen<br />
hat im Oktober 2000 die Bundesinitiative Architektur<br />
und Baukultur ins Leben gerufen. Sie wurde und wird dabei<br />
unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für<br />
Kultur und Medien, den Berufsverbänden der Architekten<br />
und Ingenieure sowie zahlreichen Institutionen aus den verschiedenen<br />
Bereichen des Planens und Bauens.<br />
Ziel der Initiative war es zunächst, das Thema Baukultur<br />
wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Nicht nur eine<br />
kleine Fachöffentlichkeit, auch die breite Bevölkerung und<br />
insbesondere die Politik sollten für die Anliegen der Baukultur<br />
sensibilisiert werden. Einen ersten Erfolg konnte die<br />
Initiative im Jahr 2002 verzeichnen, als die Bundesregierung<br />
dem Deutschen Bundestag – erstmals in der Geschichte der<br />
Bundesrepublik – einen „Statusbericht zur Lage der Baukultur“<br />
vorlegen konnte. Das Thema Baukultur war damit nicht<br />
nur wieder Gegenstand der politischen Diskussion, sondern<br />
stand auch verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit.<br />
Der Bundestag hat den Bericht in seinen Ausschüssen ausführlich erörtert<br />
und die mit der Initiative verfolgten Ziele in einem eigenen Entschließungsantrag<br />
zur Qualitätsoffensive für gutes Planen und Bauen (Drs.15/1092) am<br />
16. Oktober 2003 fraktionsübergreifend unterstützt. Insbesondere hat er<br />
das im Statusbericht vorgeschlagene Projekt einer nationalen Stiftung Baukultur<br />
begrüßt und die Bundesregierung aufgefordert, alsbald ein entsprechendes<br />
Gesetz in den Bundestag einzubringen.<br />
Baukultur erfordert Kommunikation aber auch in und mit der breiten<br />
Öffentlichkeit. Denn Baukultur kann nicht staatlich verordnet werden; sie<br />
entsteht nur im Zusammenwirken aller Beteiligten. Eine Nachfrage nach<br />
qualitätvoller Planung und Bauleistung setzt voraus, dass das Bewusstsein<br />
für die Belange der Baukultur auch bei den „Endverbrauchern“ gestärkt<br />
wird. So sind im Rahmen der Bundesinitiative in den letzten <strong>Jahre</strong>n zahlreiche<br />
Veranstaltungen und Projekte durchgeführt worden, um die Anliegen<br />
der Baukultur – über die Fachöffentlichkeit hinaus – einer breiten Öffentlichkeit<br />
zu vermitteln. Beispielhaft seien hier nur der erste Kongress „Baukultur<br />
in Deutschland“ im Dezember 2001 in Köln oder der deutsche Beitrag für<br />
die Architektur-Biennale in Venedig genannt.<br />
Gründerkreis<br />
Der Gedanke, dem mit der Initiative Architektur und Baukultur eingeleiteten<br />
Dialog eine dauerhafte Plattform zu verschaffen, wurde erstmals im Juni<br />
2002 am Rande des XXI. Architektur-Weltkongresses UIA vom so genannten<br />
Gründerkreis artikuliert, dem etwa 100 Personen mit großem Engagement<br />
im Bereich der Baukultur angehörten. Das von diesem Kreis verabschiedete<br />
Statut – unterzeichnet von Peter Conradi, Karl Ganser, Karl<br />
Heinrich Schwinn und dem Autor – weist bereits auf die bundesweite<br />
Kommunikation als Kernaufgabe der Stiftung hin. Erste für diese Aufgabe<br />
so wichtige Kommunikationsinstrumente, Multiplikatoren und Zielgruppen<br />
waren schon damals Gegenstand der Diskussion.<br />
77
Erster Konvent der Baukultur<br />
Einen Höhepunkt erlebte die Bundesinitiative – auch in ihrer Wahrnehmung<br />
in der Öffentlichkeit – im April 2003, als in Bonn der erste Konvent der Baukultur<br />
stattfand. Rund 800 Personen aus allen für das öffentliche und private<br />
Bauen wesentlichen Bereichen waren in Bonn vertreten. Im Vordergrund<br />
standen dabei die Preisträger wichtiger bundesweit ausgelobter Preise auf<br />
dem Gebiet der Architektur, des Ingenieurbaus und der Stadtplanung.<br />
Die Teilnehmer des Konvents berieten intensiv über die Perspektive der<br />
Planung und Architektur in Deutschland und unterstützten die Idee einer<br />
bundesweiten Stiftung für die Anliegen der Baukultur ganz entscheidend.<br />
Die in dieser Zusammensetzung wohl einmalige Versammlung von Experten<br />
und Erfahrungsträgern aus allen Ebenen und Bereichen des Planens und<br />
Bauens hob auch der damalige Bundespräsident, Johannes Rau, in seiner<br />
Eröffnungsrede hervor. Um ein Interesse dafür zu wecken und ein Bewusstsein<br />
zu schaffen, wie sehr Gebäude und die Gestaltung von öffentlichen<br />
Räumen das Gesicht unserer Städte und unser Zusammenleben beeinflussen,<br />
sei es wichtig, „… möglichst viele von denen zu erreichen, die mit Bauen<br />
zu tun haben, mit dem Entwerfen und dem Planen, mit dem Bauen und<br />
dem Verkaufen, mit dem Mieten und dem Kaufen. Der Konvent der Baukultur<br />
kann und soll dafür ein wichtiger Ideen- und Impulsgeber werden.“<br />
Die große Resonanz auf den Konvent bei Teilnehmern, Medien und in der<br />
Öffentlichkeit hat gezeigt, dass eine solche „Vollversammlung“ nicht nur<br />
sinnvoll, sondern auch erforderlich ist, um Erfahrungen aus allen Disziplinen<br />
in den baukulturellen Diskurs einzubringen.<br />
78<br />
Bundesstiftung Baukultur<br />
Wesentliches Ziel der Bundesinitiative war es auch, den von<br />
ihr eingeleiteten Dialog über Baukultur in Deutschland zu<br />
institutionalisieren und zu verstetigen. Die Idee einer Bundesstiftung<br />
hat sich dabei frühzeitig herausgebildet und ist von<br />
allen Beteiligten nachhaltig unterstützt worden.<br />
Als bundesweite Kommunikationsplattform sollte die Stiftung<br />
das Bewusstsein für Baukultur bei Bauschaffenden und<br />
in der Bevölkerung stärken und die Qualität des Bau- und<br />
Planungswesens in Deutschland national wie international<br />
besser herausstellen. Mit dieser Zweckbestimmung hätte die<br />
Stiftung nicht nur an vergleichbare europäische Entwicklungen<br />
anknüpfen, sondern auch die auf Länder- und Gemeindeebene<br />
vorhandenen Institutionen und Aktivitäten im<br />
Bereich der Baukultur ergänzen können.<br />
Im Dezember 2004 hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf<br />
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen<br />
(BMVBW) zur Errichtung einer Bundesstiftung<br />
Baukultur beschlossen und in die parlamentarische Beratung<br />
eingebracht. Zuvor hatte das BMVBW die haushaltsrechtlichen<br />
Voraussetzungen für eine Anschubfinanzierung der<br />
Stiftung durch den Bund mit rd. 5,25 Mio. Euro im Zeitraum<br />
2005 bis 2008 geschaffen. Der Deutsche Bundestag hat das<br />
Stiftungsgesetz in seinen Ausschüssen intensiv beraten und<br />
am 12. Mai 2005 über alle Fraktionsgrenzen hinweg einhellig<br />
verabschiedet.<br />
Trotz dieses überzeugenden Votums und obgleich auch der<br />
Bundesrat die Notwendigkeit, die Baukultur in Deutschland<br />
zu fördern, ausdrücklich anerkannt hat, ist das Stiftungsgesetz<br />
zunächst am Widerstand der Länderkammer gescheitert.<br />
Trotz intensiver Vermittlungsbemühungen der Bundesregierung<br />
hat der unionsgeführte Vermittlungsausschuss die<br />
Beratungen zum Stiftungsgesetz mehrfach vertagt.<br />
Die Haltung des Bundesrates ist in der Sache nicht nachvollziehbar<br />
und wird im Lichte der aktuellen Ereignisse nach der<br />
Bundestagsneuwahl neu betrachtet werden. Baukultur ist<br />
entgegen der bisherigen Auffassung des Bundesrates eben<br />
nicht nur der Ausdruck „künstlerischen Schaffens“, sondern<br />
resultiert aus der Summe aller Aspekte des Planens und<br />
Bauens. Die Bundesstiftung wird sich auf Instrumente mit<br />
bundesweiter oder internationaler Ausstrahlung beschränken<br />
und eine enge Kooperation mit den auf Länder- und<br />
Gemeindeebene vorhandenen Institutionen und Akteuren<br />
suchen. Es ist davon auszugehen, dass die Bundesstiftung<br />
Baukultur sich bald konstituieren wird.
Resümee<br />
Die einmalige Chance, den erfolgreichen baukulturellen<br />
Dialog der vergangenen <strong>Jahre</strong> fortzusetzen und zu verstetigen,<br />
muss jetzt genutzt werden, damit das große Engagement<br />
vieler Beteiligter ebenso wie das gewachsene Interesse<br />
in Politik und Öffentlichkeit nicht erlahmt.<br />
Das Ergebnis der Bundesinitiative jedenfalls, die von Beginn<br />
an als Kommunikationsprojekt angelegt war, kann sich<br />
sehen lassen. Der „runde Tisch“ aller an Baukultur Interessierten<br />
hat Verantwortliche zusammengeführt und sich als<br />
wichtiger Gesprächskreis erwiesen. Im Bundestag haben wir<br />
breites Interesse geweckt, in der Fachdiskussion ist Baukultur<br />
ein zentrales Thema geworden und im Zuge der Vorbereitung<br />
der Bundesstiftung und des zweiten Konvents der<br />
Baukultur wuchs der Kreis von engagierten Persönlichkeiten,<br />
die sich für Baukultur einsetzen wollen, kontinuierlich.<br />
Jetzt kommt es darauf an, das Erreichte zu sichern und in der laufenden<br />
Legislaturperiode hieran anzuknüpfen. Mit dem im August 2005 vorgelegten<br />
zweiten Bericht zur Lage der Baukultur in Deutschland haben wir einen<br />
weiteren Beitrag geleistet, um den Dialog über die Qualität des Planens und<br />
Bauens in Deutschland fortzuführen. Der Forschungsbericht gibt einen guten<br />
Überblick über den aktuellen Diskussionsstand und macht deutlich, wie eng<br />
das Thema in der Baupolitik – dem Städtebau, der Bauplanung, ihren Verfahren<br />
– verankert ist und welche Bedeutung es für unsere Gesellschaft hat.<br />
Die Erfahrungen der bisherigen Initiative zeigen, dass die Bundesinitiative<br />
die Länder und Gemeinden bei der Wahrnehmung ihrer baukulturellen Aufgaben<br />
stärkt. Eine Reihe von Ländern und viele Gemeinden haben eigene<br />
Programme und Initiativen auf den Weg gebracht – mit jeweils eigenen spezifischen<br />
Zielsetzungen und Formen, die vom Bund in keiner Weise beeinflusst<br />
werden. Kommunikation und Kooperation sind zwei Seiten ein und<br />
derselben Medaille und für das Erreichen des gemeinsamen Ziels – der Stärkung<br />
der Baukultur in Deutschland – unabdingbar.<br />
79
Frauke Burgdorff<br />
Die Baukultur eines Landes ist nur so gut, wie sie Teil einer öffentlich geführten<br />
Diskussion ist. Dies ist eine wesentliche Erkenntnis der Arbeit der letzten<br />
<strong>Jahre</strong> in der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>. Dabei wird es in Zukunft immer<br />
mehr darum gehen, dass sich alle Partner der Initiative noch weiter aus den<br />
Fachzirkeln des Bauens hinausbewegen und Allianzen für eine bessere Qualität<br />
der gebauten Umwelt bei den Nutzern, der Bauwirtschaft und den<br />
Investoren suchen.<br />
Der Ruf nach „Breitenwirkung“ ist insbesondere in der Baukultur allgegenwärtig.<br />
Fälschlicherweise wird zuweilen die Forderung damit verbunden,<br />
dass sich Baukultur ähnlich der großen Marken mit globalen Werbestrategien<br />
durchsetzen sollte. Da Baukultur aber kein Konsumgut ist und sich auch<br />
nur selten international vermarkten lässt, ist es notwendig, andere Strategien<br />
zu finden und anzuwenden.<br />
Insbesondere die internationalen Vorbilder aus Österreich und den Niederlanden<br />
zeigen, dass die Zugänge, um eine breitere Öffentlichkeit für die Entwicklung<br />
und Pflege baukultureller Qualität zu schaffen, zunächst einmal<br />
regional oder lokal sind. Denn eine abstrakte Vermittlung baukultureller<br />
Inhalte auf Landesebene kommt weder bei den Geldgebern noch bei den<br />
Nutzern an. Vermittlung wird insbesondere dann virulent, wenn die unmittelbare<br />
gebaute Umgebung von Veränderungen betroffen ist oder wenn<br />
eingeübte Sicht- und Verhaltensweisen durch Veränderungen gestört oder<br />
bereichert werden.<br />
80<br />
Kommunikation suchen<br />
Damit aber der regionale und lokale Diskurs über städtebauliche<br />
und architektonische Entwicklung sich nicht im Streit<br />
um mehr Parkplätze erschöpft, brauchen wir auch vor Ort<br />
kompetente Allianzen, die sich aus Überzeugung und durchaus<br />
mit dem Argument des ökonomischen Nutzens für besseres<br />
Bauen einsetzen.<br />
Diese Allianzen können zwischen den unterschiedlichsten<br />
Partnern entstehen: zwischen Verbänden und Behörden,<br />
zwischen Privatpersonen und Unternehmern, zwischen Vereinen<br />
und den Medien. Die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
hat in den vergangenen <strong>Jahre</strong>n zahlreiche Projekte unterstützt,<br />
die sich zum Auftrag gemacht haben, mehr qualifizierte<br />
Partner für die Debatte zu gewinnen.<br />
Gerade in Köln wurde deutlich, dass die jährlich wiederkehrende<br />
dezentrale Ausstellungs- und Diskussionswoche<br />
„plan“ und das Internetportal „koelnarchitektur.de“ viel zu<br />
einer kritischen Öffentlichkeit in Fragen des Planens und<br />
Bauens beigetragen haben. Während die „plan“ mit ihren<br />
ungewöhnlichen Strategien mittlerweile mindestens 20.000<br />
Besucher zur Eroberung der Stadt verführt, schafft das Internetportal<br />
„koelnarchitektur.de“ eine virtuelle Öffentlichkeit<br />
für Fragen, die weit über die Kölner Belange hinausgehen.<br />
Auf ganz anderen Wegen, aber genauso intensiv, haben<br />
unterschiedliche Baukulturengagierte in Essen im Jahr 2002<br />
ein intensives Diskussions- und Veranstaltungsprogramm<br />
gestaltet, das sowohl die Architektur- als auch die Kunstvereinigungen<br />
vor Ort in die Debatte und Gestaltung einbezogen<br />
hat.
Einige Projekte, die in Kooperation mit der Initiative Stadt-<br />
BauKultur <strong>NRW</strong> entstanden sind, haben sich ganz bewusst<br />
den kommenden Generationen zugewandt. Denn letztendlich<br />
werden es die jetzigen Kinder und Jugendlichen sein,<br />
die mit den heute geschaffenen baulichen Strukturen umgehen<br />
müssen und diese weiter gestalten werden. Das Projekt<br />
„Türme für PISA“ der Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong> ist auf<br />
besonders kreative Weise auf die technisch-gestalterischen<br />
Fähigkeiten der Jugendlichen zugegangen und hat deren<br />
Begeisterung für Ingenieurbauwerke geweckt. Im Rahmen<br />
von „Architektur macht Schule“ der Architektenkammer<br />
NW wurden gemeinsam mit Eltern und Schülern Schulbauten<br />
und -höfe in Lernräume der Zukunft umgebaut. Auf<br />
dem Kongress „Stadt(T)räume“ hat das Städte-Netzwerk<br />
<strong>NRW</strong> deutlich gemacht, wie wichtig und fruchtbar es ist,<br />
Kinder und Jugendliche von Anfang an bei Planungs- und<br />
Bauprozessen zu beteiligen.<br />
Eine ganz andere Zielgruppe hat der alljährlich stattfindende<br />
„Tag der Architektur“ in Nordrhein-Westfalen. Hier reisen<br />
baukulturell interessierte Bürgerinnen und Bürger durch das<br />
ganze Land, um sich über aktuelle Bauwerke zu informieren.<br />
Architekten nutzen diesen Tag, um ihre Leistungen zu<br />
präsentieren. Diese dezentrale Architekturausstellung geht<br />
einen ganz anderen Weg als zum Beispiel die Ausstellung<br />
„RheinRuhrCity“ im <strong>NRW</strong>-Forum Düsseldorf. Hier wurde versucht,<br />
die komplexe urbane Zukunft zwischen Rhein und<br />
Ruhr zu visualisieren und deutlich zu machen, dass die Entwicklungsperspektiven<br />
zwar global beeinflusst, aber regional<br />
steuerbar sind.<br />
Baukultur zu verbessern heißt immer auch, sich in ein Diskussionslabor zu<br />
begeben und Inspirationen von außen zu suchen. Dies ist im Workshop<br />
„Mögliche Orte“ geschehen und gelungen. Studierende der Architektur und<br />
der Planung, der Fotografie und des Fotodesigns haben sich in Gelsenkirchen<br />
gemeinsam auf die Suche nach Orten gemacht, die eine besondere<br />
Aufmerksamkeit verdienen, weil ungeahnte Möglichkeiten in ihnen schlummern.<br />
Die Ergebnisse dieser interdisziplinären Expedition wurden in Projektvorschlägen<br />
und einer Ausstellung verarbeitet, die durch ihren frischen Blick<br />
auf scheinbar verfahrene Situationen überrascht hat.<br />
Bei aller Notwendigkeit, eine breitere Öffentlichkeit in die Baukulturdebatten<br />
einzubeziehen, ist es immer wieder Aufgabe der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong>, auch für die Fachleute im Land, eine Diskurs- und Verständigungsplattform<br />
zu bieten. Dies wird besonders deutlich in den „Baupolitischen<br />
Zielen des Landes <strong>NRW</strong>“, mit denen ein grundlegender Rahmen für die Entwicklung<br />
und Gestaltung von Bauwerken geschaffen wurde. Dies wird aber<br />
auch alljährlich offensichtlich, wenn sich die Baukultur-Interessierten zum<br />
<strong>Jahre</strong>skongress der Initiative treffen. Denn dort werden Schnittstellenthemen<br />
aufgegriffen, die auch für die nähere Zukunft der gemeinsamen Arbeit<br />
bestimmend sein können. Die bisherigen Kongresse zu den Themen<br />
„<strong>NRW</strong>urbanism“ und „Realität Bauen“ haben gezeigt, dass gerade in den<br />
scheinbaren Randbereichen der Baukultur Verständigungsbedarf besteht<br />
und Entwicklungspotenziale existieren, die über Werkstattgespräche für die<br />
Zukunft erschlossen werden können.<br />
Alle Kommunikationsaufgaben der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> laufen<br />
in einer Schnittstelle – dem Europäischen Haus der Stadtkultur und dem<br />
stadt.bau.raum in Gelsenkirchen – zusammen. Ihre Tätigkeit als Herausgeber,<br />
Veranstaltungsplaner und -organisator, Kommunikationsmanager und<br />
Themensucher schafft eine zentrale Klammer für die gesamte Initiative.<br />
81
Christof Rose<br />
82<br />
Architektur macht Schule!
„Die breite Öffentlichkeit interessiert sich kaum für Fragen<br />
der Architektur und des Städtebaus!“ – Wie kann es gelingen,<br />
dieser oft beklagten Tatsache wirksam und nachhaltig entgegen<br />
zu wirken? Ausgehend von dieser Frage initiierte die<br />
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen schon vor zwölf<br />
<strong>Jahre</strong>n das Programm „Kammer in der Schule“ (KidS). Im<br />
Rahmen dieser Aktion wurden an Schulen in <strong>NRW</strong> Projekte<br />
angeregt und durchgeführt, bei denen die Schülerinnen<br />
und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und mit örtlichen<br />
Architekten Lösungen für konkrete bauliche Probleme an<br />
der jeweiligen Schule erarbeiteten. So wurden zum Beispiel<br />
zuvor asphaltierte Schulhöfe aufgebrochen und begrünt,<br />
Innenräume mit Farbkonzepten und Einbauten belebt, Pavillons<br />
und neue Räumlichkeiten für Schülerinnen und Schüler<br />
geschaffen.<br />
„Dass wir so viel verändern können, hätte ich wirklich nicht<br />
gedacht!“ – Aussagen wie diese werden häufig von Schülern<br />
(und nicht selten auch von Lehrern und Schulleitern) am<br />
Ende eines KidS-Projektes geäußert. Die Idee des KidS-Konzeptes<br />
ist ebenso einfach wie zwingend: Wer nachhaltig ein<br />
Bewusstsein für Fragen des Wohnens und der Architektur,<br />
des Städtebaus und der gebauten Umwelt erreichen will,<br />
muss bei den Kindern ansetzen. Nur wer schon in frühen<br />
Lebensjahren erfährt, dass die gebaute Umwelt kein vorgegebenes<br />
Faktum ist, sondern durch aktive Einmischung positiv<br />
beeinflusst werden kann, entwickelt ein Gespür und Interesse<br />
dafür, selber aktiv zu werden und unsere künstlich<br />
generierte Umwelt nicht passiv hinzunehmen.<br />
„Architektur ist echt cool!“ – Die mittlerweile elf realisierten<br />
Projekte der KidS-Reihe zeigen: Kindern und Jugendlichen<br />
macht es Spaß, sich mit planerischen Aufgaben ihrer Alltagsumwelt<br />
zu beschäftigen und sich an Lösungsprozessen<br />
zu beteiligen.<br />
Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hat deshalb<br />
das KidS-Konzept im Rahmen der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> strukturell ausgeweitet. Wo die KidS-Reihe an lokalen<br />
Beispielen vor Ort Lösungen anbietet und Bewusstsein schafft,<br />
stellte sich nun die Frage, wie flächendeckend und dauerhaft<br />
eine Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern<br />
erzielt werden kann. Die Architektenkammer <strong>NRW</strong> entwickelte<br />
dazu ein breites Spektrum an Angeboten, die von<br />
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Interessierten aktiv<br />
aufgenommen werden. Zu den Instrumentarien gehören<br />
folgende Projekte:<br />
• Architektenpool: Die Architektenkammer hat über Kolloquien einen Kreis<br />
von Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten<br />
und Stadtplanern etabliert, die sich für die ehrenamtliche Arbeit in<br />
Schulen zur Verfügung stellen. Schulen, die Architekten als Gesprächspartner<br />
für Berufsinformationstage suchen, können auf diese Weise ebenso zuverlässig<br />
und flächendeckend bedient werden wie Lehrer, die sich kompetente<br />
Partner für Projektwochen oder Themenreihen wünschen.<br />
• Schulmaterial: Das Themenfeld Architektur eignet sich – als interdisziplinäres<br />
Fach – ideal für projektorientiertes Arbeiten in Schulen. Die Architektenkammer<br />
Nordrhein-Westfalen hat deshalb Schulmaterial entwickelt, mit<br />
dessen Hilfe Pädagoginnen und Pädagogen schnell und sicher Projektwochen<br />
entwickeln können. Das Schulbuch „Wie gewohnt?!“ des renommierten<br />
Fachautors Prof. Gert Kähler thematisiert das Wohnen in all seinen historischen,<br />
soziologischen und städtebaulichen Facetten. Die Arbeitsmappe<br />
„Alles nur Fassade?“ bietet Material für eine spannende Projektwoche oder<br />
Unterrichtsreihe, bei der die Schülerinnen und Schüler hinter die Fassaden<br />
ihres Quartiers blicken sollen.<br />
• Best-practice-Sammlung: Auch das Aktionsprogramm „Architektur macht<br />
Schule!“ selbst machte sehr schnell nach seiner Eröffnung im Herbst 2002<br />
Schule. Viele Architekten und Stadtplaner zeigten sich interessiert, an Schulen<br />
ihrer Kommune oder den Schulen ihrer Kinder entsprechende Projekte zu<br />
initiieren. Auch Lehrer und Leiter der verschiedensten Bildungseinrichtungen<br />
fragten bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen nach, wie solche<br />
Schulprojekte initiiert werden können und wie sie konkret ablaufen. Eine<br />
schnelle Antwort gibt es darauf nicht, denn für Schulprojekte über Architektur<br />
gilt wie für Architektur allgemein: Jedes Projekt ist ein Unikat, das von<br />
den Beteiligten, den baulichen Gegebenheiten, der Schulform, den eingebundenen<br />
Schülern und zahlreichen weiteren Faktoren abhängt. Die Architektenkammer<br />
Nordrhein-Westfalen hat deshalb eine Sammlung ihrer eigenen<br />
Schulprojekte sowie weiterer Aktionen, die im Rahmen des Aktionsprogramms<br />
„Architektur macht Schule!“ von Kammermitgliedern initiiert<br />
wurden, angelegt und diese für alle Interessierten im Internet öffentlich<br />
gemacht: Unter www.architektur-macht-schule.de können Konzepte, Projektabläufe<br />
und Erfahrungen der Beteiligten abgerufen werden.<br />
„Architektur macht Schule!“ – Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen<br />
versteht den Titel ihres Aktionsprogramms als motivierendes Statement<br />
und zugleich als Appell. Solange Architektur und Städtebau nicht fest in die<br />
Curricula der nordrhein-westfälischen Schulen integriert sind, stellen die<br />
vielfältigen Aktionen in Schulen vor Ort sicher, dass Kinder und Jugendliche<br />
mit diesem wichtigen Thema in Berührung kommen und ein Bewusstsein<br />
für ihre gestaltete Umwelt entwickeln können. Denn Architektur ist eine<br />
Bereicherung – für den Unterricht, für die jungen Leute und für die Gesellschaft<br />
insgesamt.<br />
83
Birgit Frey<br />
84<br />
Stadt(T)räume
In Gelsenkirchen planen Jugendliche auf einem ehemaligen<br />
Zechengelände eine moderne Trendsportanlage, während<br />
in Bochholt Kinder ein Konzept für neue Bewegungs-, Kommunikations-<br />
und Kunsträume in der Innenstadt erarbeiten<br />
und umsetzen. In Castrop-Rauxel sorgen engagierte Mädchen<br />
dafür, dass Angsträume aus der Stadt verschwinden, und im<br />
Berliner Viertel in Monheim beteiligen sich Kinder, Jugendliche<br />
und deren Familien aktiv an der Verbesserung ihrer<br />
Wohn- und Lebenssituation im Stadtteil.<br />
Eine kinder- und jugendgerechte Stadt ist eine lebenswerte<br />
Stadt. Sie ist eine Stadt der kurzen Wege: zum Treffpunkt<br />
mit anderen Jugendlichen, zur Stadtteilbibliothek oder zum<br />
Schwimmbad. Sie ist eine anregende Stadt, in der Kinder<br />
Natur, Kultur, Technik und vieles mehr entdecken und erleben.<br />
Sie ist eine Stadt mit Wohnvierteln, in denen sich junge Menschen<br />
zu Hause fühlen. Sie ist schließlich eine Stadt, in der<br />
Jugendliche ihre Freude, ihre Ängste und ihre Wünsche artikulieren<br />
und in den Alltag der Stadt einbringen. Eine junge Stadt<br />
ist eine vitale Stadt, in der sich alle Menschen wohl fühlen.<br />
Stadt(T)räume will auf das Engagement und kreative Gestaltungspotenzial<br />
von Kindern und Jugendlichen für eine zukunftsorientierte<br />
Stadtentwicklung aufmerksam machen<br />
und zugleich Wege aufzeigen, wie dem Rückzug junger<br />
Familien aus städtischen und stadtnahen Quartieren entgegen<br />
gewirkt werden kann.<br />
Hintergrund der Initiative ist der demographische und strukturelle<br />
Wandel in Nordrhein-Westfalen, der den interkommunalen<br />
Wettbewerb um die junge Generation immer weiter<br />
anheizt. Kinder- und Familienfreundlichkeit wird zu einer<br />
Standortfrage und es zeigt sich schon heute, dass nur eine<br />
kinder- und jugendgerechte Stadt in Zukunft die wirtschaftlich<br />
erfolgreichere und attraktivere Stadt sein wird.<br />
Um ein drastisches Schrumpfen und Aushöhlen der Innenstädte<br />
zu vermeiden, müssen öffentliche Räume und Ein-<br />
richtungen, das Wohnumfeld und Freizeitflächen für junge Menschen und<br />
deren Familien attraktiver werden. Dies geht jedoch nicht ohne die umfassende<br />
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden<br />
kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen.<br />
Damit aus Stadträumen Stadtträume werden, setzt die Initiative auf drei<br />
Säulen:<br />
Stadt(T)räume recherchiert vorbildliche und kreative Projekte, deren Verfahren<br />
und Methoden relevante Aspekte einer erfolgreichen Beteiligung von<br />
Kindern und Jugendlichen in der Stadtentwicklung abdecken. Diese Projekte<br />
sollen anderen Kommunen wertvolle Anregungen für ihre eigenen Planungen<br />
geben und Basis für differenzierte Handlungsempfehlungen in weiteren<br />
Projekten sein.<br />
• Stadt(T)räume führt Expertenwissen aus Wissenschaft und kommunaler<br />
Praxis in einem landesweiten Workshop zusammen. Unter Stadtforschungs-,<br />
demographischen, architektonischen und ökonomischen Gesichtspunkten<br />
ebenso wie aus Sicht der Jugendforschung, anhand von Leitfragen und konkreten<br />
Methoden- und Praxiserfahrungen in Beteiligungsprojekten werden<br />
wesentliche Rahmenbedingungen und Handlungsfelder der Beteiligung skizziert<br />
und Handlungsempfehlungen formuliert.<br />
• Stadt(T)räume präsentiert in einem landesweiten Kongress und Projektmarkt<br />
kommunales Erfahrungswissen aus so unterschiedlichen Handlungsfeldern<br />
wie Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport, um zu verdeutlichen,<br />
dass es gelingen kann, Jugendliche auf vielfältige Weise für Stadtentwicklungsfragen<br />
zu begeistern und sich für „ihre“ Stadträume zu engagieren.<br />
• Alle aktuellen Studien zeigen, dass Jugendliche bereit sind, sich an kommunalen<br />
Planungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen und Verantwortung<br />
zu übernehmen. Der Bezug zu ihrer direkten räumlichen Umwelt<br />
– ihrer Stadt, ihrem Stadtteil und ihrem Wohnbereich – spielt hierbei eine<br />
zentrale Rolle. Jetzt ist es an den Kommunen, diese Erkenntnisse in ein<br />
kinder- und familienfreundliches Stadtentwicklungskonzept zu integrieren.<br />
Stadt(T)räume liefert hierfür mit breit aufgearbeitetem Expertenwissen<br />
und gut recherchierten Beispielen aus der kommunalen Praxis wertvolle<br />
Anregungen.<br />
85
Andrea Wilbertz<br />
Technik und Gestaltung stehen nicht im Widerspruch zueinander. „Türme<br />
für Pisa“ ist die Antwort der Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong> auf den Technikfrust<br />
von Schülerinnen und Schülern. Als außergewöhnliches Projekt mit<br />
Wettbewerbscharakter stellt es Schüler auf spielerische Weise vor bautechnische<br />
Fragen und lässt sie ingenieurtechnische Gesetzmäßigkeiten erkunden.<br />
Für viele Jugendliche ist dies der erste Kontakt zum Bauingenieurwesen.<br />
Nach den großen Einstiegserfolgen in den <strong>Jahre</strong>n 2002 und 2003 wurde der<br />
Schülerwettbewerb 2004 und 2005 gemeinsam mit neun Hochschulen aus<br />
<strong>NRW</strong> für die Jahrgangsstufen zehn bis zwölf an Gymnasien, Gesamtschulen<br />
und Berufskollegs neu ausgeschrieben.<br />
Auch diesmal war es Aufgabe des Wettbewerbs, einen möglichst stabilen,<br />
aber kreativ gestalteten Turm aus Pappe zu bauen, der im Verhältnis zu<br />
seinem Eigengewicht eine größtmögliche Last tragen kann. Dies musste<br />
gebaut und in schriftlicher Form dokumentiert werden. Die Parameter der<br />
Konstruktion waren jeweils genau definiert und mussten zentimetergenau<br />
eingehalten werden: Der Turm sollte 120 cm hoch sein, die Spitze durfte<br />
nur eine Bierdeckelgröße breit sein und eine Aufstellfläche von nicht mehr<br />
als 50 cm x 50 cm einnehmen.<br />
Zum Bau des Turms wurde den Schülern jeweils eine PISA-Box zur Verfügung<br />
gestellt. Sie enthielt nahezu alles, was angehende Ingenieure brauchen, um<br />
Türme zu bauen - vom Geodreieck über Scheren, Zirkel, Falzbeine, Büroklammern<br />
bis zum großen Stahllineal und natürlich die entscheidenden sechs<br />
Bögen Bastelpappe. In der Planungs- und Bauphase mussten die Jugendlichen<br />
ihrer eigenen Kreativität folgen und ihr Wissen aus dem Mathematik- und<br />
Physikunterricht einbringen. Für ganz spezielle Fachfragen standen dann<br />
jedoch Ansprechpartner der beteiligten Hochschulen (RWTH Aachen,<br />
FH Bielefeld, Ruhr-Universität Bochum, Universität Duisburg-Essen, FH Lippe<br />
und Höxter, FH Köln, FH Münster, Universität Siegen, Bergische Universität<br />
Wuppertal) zur Verfügung.<br />
86<br />
Türme für Pisa<br />
Was bedeutet Biegung? Wie reagiert ein Stab auf Zug? Was<br />
kann ich tun, damit der Druck auf die Pappe erhöht werden<br />
kann? Die Professoren für Baustatik und Baudynamik der<br />
beteiligten Hochschulen hatten sich mit ihren Teams für die<br />
Kick-Off-Veranstaltungen einen anschaulichen Einführungsunterricht<br />
überlegt und kleine Versuchsanlagen aufgebaut.<br />
Mit diesem Grundwissen ausgestattet, bastelten und tüftelten<br />
bis heute rund 230 Schülergruppen mit circa 1.500<br />
Schülerinnen und Schüler aus fünf Regierungsbezirken<br />
in den drei durchgeführten Wettbewerben um den Titel<br />
des besten Turmbauers. Bis zu 60 Stunden in drei Monaten<br />
investierten sie in ihre Bauwerke, bis sie zu den großen<br />
Regionalentscheidungen an die Hochschulen zurückkehrten.<br />
Mit unbestechlichen Abdrückmaschinen wurde geprüft,<br />
welcher Turm im Verhältnis zum Eigengewicht die meiste<br />
Last trägt. Gebannt fieberten die Teilnehmer beim großen<br />
Turm-Test den Ergebnissen entgegen, denn den Siegern<br />
winkte schließlich die Teilnahme am jeweiligen Landeswettbewerb<br />
an der Universität Duisburg-Essen. Den bis heute<br />
überraschendsten Erfolg trug der Landessieger von 2003<br />
davon: Der Turm des Siegers trug bei nur 699 Gramm<br />
Gewicht sage und schreibe 378,9 Kilogramm!<br />
Aber nicht nur die Turmbauer fieberten den Ergebnissen<br />
entgegen. Auch die Medien waren jedes Jahr mit Reportern<br />
vor Ort. Ob Zeitung, Hörfunk oder Fernsehen, alle Veranstaltungen<br />
wurden mit ausführlicher Berichterstattung in<br />
ganz Nordrhein-Westfalen begleitet. Für 2003 resultierte<br />
dies in fast 200 Printartikeln, über 20 Hörfunk- und elf zum<br />
Teil landesweit ausgestrahlten Fernsehbeiträgen.
Michael von der Mühlen<br />
Mit dem Europäischen Haus der Stadtkultur und dem stadt.bau.raum haben zwei wichtige<br />
Einrichtungen der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> eine Heimat in Gelsenkirchen gefunden.<br />
Damit ist unsere Stadt – auch nach der Internationalen Bauausstellung Emscher Park – ein<br />
Zentrum für die Baukultur Nordrhein-Westfalens.<br />
Im Europäischen Haus der Stadtkultur laufen wichtige Fäden der Initiative zusammen, dort<br />
werden Projekte initiiert und begleitet, es werden Veranstaltungen konzipiert und durchgeführt,<br />
die die Diskussionen zum Thema <strong>StadtBauKultur</strong> vorantreiben. Das Europäische<br />
Haus der Stadtkultur gibt mit seinen Partnern vor Ort der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> ein<br />
öffentlich wahrnehmbares Gesicht und ist dabei weit über die Grenzen Gelsenkirchens hinaus<br />
aktiv.<br />
Es versteht sich als Moderator der Initiative und Initiator neuer Partnerschaften und Projektideen.<br />
Die bis dato circa 70 Projekte der Initiative werden dort gebündelt und zum Beispiel<br />
auf der Internetseite www.stadtbaukultur.nrw.de öffentlich präsentiert.<br />
Die Publikationen der „Blauen Reihe der <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>“ werden vom Europäischen<br />
Haus der Stadtkultur herausgegeben und sind mittlerweile auch bundesweit ein anerkanntes<br />
Medium für Baukulturfragen geworden. Hierfür stehen – neben vielen anderen – natürlich<br />
die Publikationen zu „Temporärer Architektur“, zu „Gartenkunst in Nordrhein-Westfalen“<br />
und zum Wettbewerb „Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze“.<br />
88<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur<br />
und stadt.bau.raum
Die Projekte, die die Initiative gemeinsam mit dem Europäischen<br />
Haus der Stadtkultur anstößt und durchführt, zeichnen<br />
sich immer wieder durch ihre neuen Partnerschaften<br />
und qualitätvollen Ergebnisse aus. Dabei nimmt es sich besonders<br />
der Aufgabe an, die Themen, die in den klassischen<br />
Baukulturdebatten keine Heimat finden, mit der Inspiration<br />
der europäischen Nachbarn in Nordrhein-Westfalen zu verankern.<br />
Gemeinsam mit den Projektpartnern spürt es zum<br />
Beispiel herausragende Beispiele für Handelsarchitektur,<br />
Gewerbegebiete und Straßenbau auf und versucht, die<br />
Diskussion unter anderem mit der wiederkehrenden Reihe<br />
„Kunst trifft Stadt“ in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen.<br />
Das Europäische Haus der Stadtkultur verdeutlicht als Moderator<br />
der Initiative, dass <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> mehr sein muss,<br />
als eine fachspezifische Diskussion über „gutes Bauen“.<br />
<strong>StadtBauKultur</strong> wird hier als kritischer Prozess zwischen<br />
Machern und Betroffenen begriffen. <strong>StadtBauKultur</strong> bedeutet<br />
aber immer auch, die alltäglichen Selbstverständlichkeiten<br />
im Planungs- und Bauprozess zu hinterfragen und baukulturell<br />
reicher zu gestalten.<br />
Der stadt.bau.raum ist auf dem Gelände der ehemaligen<br />
Zeche Oberschuir in Gelsenkirchen eine zentrale öffentliche<br />
Plattform für Baukulturdebatten geworden. Insbesondere<br />
die Ausstellungen, Workshops und Vortragsabende machen<br />
dies vor Ort und im Ruhrgebiet deutlich. Ob nun in der<br />
Studentenausstellung „mehr oder weniger“ über die baukulturellen<br />
Auswirkung des Stadtumbaus diskutiert oder die<br />
international anerkannte Ausstellung „Deutschlandschaft“<br />
als Anregung für das alltägliche Bauen in der Peripherie präsentiert<br />
wurde: Der stadt.bau.raum ist eine lebendige Plattform<br />
für die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> und ein wichtiger<br />
Bestandteil der Baukulturdebatten im Ruhrgebiet.<br />
Darüber hinaus hat sich der stadt.bau.raum zum Ort der<br />
Begegnung zwischen Fachleuten und interessierten Bürgern<br />
entwickelt und leistet damit eine wichtige Vermittlungsaufgabe<br />
in die Gesellschaft hinein.<br />
Dabei sind seine 500 Quadratmeter große Halle und die Sitzungszimmer<br />
offen für alle an Baukultur Interessierten. Und<br />
ich freue mich sehr, dass dieses Angebot mittlerweile von<br />
Berufsverbänden und Hochschulen, von Kommunen und<br />
Ministerien intensiv genutzt wird.<br />
89
Martin Gerth<br />
90<br />
Baupolitische Ziele<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Der Staat ist der bedeutsamste Immobilieneigentümer und Bauherr in Nordrhein-Westfalen.<br />
Das staatliche Bauen hat bereits eine große Tradition. In<br />
dieser besonderen Verantwortung, seiner Verpflichtung gegenüber dem<br />
Gemeinwohl, muss es Anliegen des Staates sein, hohe baukulturelle Qualitätsansprüche<br />
und -maßstäbe zu artikulieren. Die Verpflichtung aller Ressorts<br />
auf die baupolitischen Ziele des Landes ist somit ein wichtiger Baustein<br />
auf dem Wege, die ambitionierten Qualitätsansprüche der <strong>Landesinitiative</strong><br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> umzusetzen.<br />
Zu Beginn des <strong>Jahre</strong>s 2001 ist das staatliche Bauen im Rahmen der Modernisierung<br />
der Landesverwaltung und der Errichtung des Sondervermögens<br />
„Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen“ in ein<br />
betriebswirtschaftlich organisiertes Immobilienmanagement übergegangen.<br />
Um die auch zukünftig relevante baukulturelle Vorbildfunktion des Staates<br />
zu stärken, sind in kommunikativer Auseinandersetzung mit den Kammern<br />
und Verbänden des Landes die baupolitischen Ziele formuliert worden.<br />
Durch Verabschiedung im Landtagsausschuss sind sie bindende Maßgaben<br />
geworden. In einer Broschüre der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
wurden die Qualitätsanforderungen an die staatliche Bautätigkeit erstmals<br />
veröffentlicht, so dass sie auch anderen öffentlichen und privaten Bauherrn<br />
sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern als wegweisende Vorgabe<br />
dienen.<br />
Die dort formulierten Qualitätsanforderungen, die neun unterschiedlichen<br />
programmatischen Zielen zugeordnet sind,<br />
reichen von Aspekten der Bauinnovation und Nachhaltigkeit<br />
bis zur Energieeinsparung und Kunst am Bau. Ein besonderes<br />
Augenmerk liegt, nicht zuletzt als Ausdruck demokratischer<br />
Planungskultur, auf Wettbewerben. Das Land konnte<br />
in den letzten <strong>Jahre</strong>n zahlreiche Realisierungswettbewerbe<br />
unter anderem für Justiz- und Finanzamtszentren, Hochschulbauten<br />
und Kliniken ausloben. Diese vermeintlich teuren<br />
Prozesse haben erneut bewiesen, dass der finanzielle<br />
Aufwand für die Wettbewerbsdurchführung in der Regel<br />
deutlich geringer ist als der wirtschaftliche Nutzen, der aus<br />
dem bestmöglichen Gebäudeentwurf resultiert. Unterstützt<br />
wurde die Beurteilung und Auswahl der Entwürfe durch<br />
neueste energetische Simulationsberechnungen.
Um diese Wettbewerbskultur in Nordrhein-Westfalen weiter<br />
zu fördern, hat das Bauministerium mit der Architektenund<br />
der Ingenieurkammer im <strong>Jahre</strong> 2001 zunächst neue<br />
„Regeln für die Auslobung von Wettbewerben (RAW)“ erprobt.<br />
Seit 2004 kommen diese bei Landesbauten dauerhaft<br />
und verbindlich zur Anwendung. Dies war ein wichtiger<br />
Schritt, durch die Vereinfachung des Wettbewerbsverfahrens<br />
und die Senkung der dazugehörigen Kosten die Zahl<br />
der Auslobungen deutlich zu erhöhen – auch bei Projekten<br />
anderer Bauherren in Nordrhein-Westfalen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der baupolitischen Ziele liegt in<br />
der ganzheitlichen Gebäudebetrachtung zur Energieeinsparung<br />
und Emissionsminderung. In der Umsetzung dieser<br />
Aspekte finden umweltpolitische Ziele und betriebswirtschaftlicher<br />
Nutzen, insbesondere bei der Bewirtschaftung<br />
von Gebäuden, eine gegenseitige Ergänzung. Beispielhaft<br />
für diese Bestrebungen stehen zahlreiche Fotovoltaik- und<br />
Solarthermieanlagen. Im Falle fassadenintegrierter Module<br />
konnten diese Maßnahmen sogar neue gestalterische<br />
Impulse für zukunftsweisende Gebäudearchitektur<br />
geben. Auch andere innovative<br />
Entwicklungen wie zum Beispiel im Bereich<br />
neuer Fassaden- oder Tragwerkskonstruktionen<br />
wurden angestoßen und können an Pilot-<br />
projekten bewundert werden. Als ein Projekt, das nicht nur durch singuläre<br />
Aspekte besticht, sondern in der Gesamtheit innovativer Aspekte<br />
vorbildliche Lösungen zeigt, steht die neue Vertretung des Landes <strong>NRW</strong> in<br />
Berlin. Sie wurde sowohl mit dem Holzbau- als auch mit dem Stahlbaupreis<br />
ausgezeichnet.<br />
Dies sind einige erfreuliche Beispiele, derer es zahlreiche zu nennen gäbe und<br />
die für die Kommunikation baukultureller Anliegen so bedeutsam sind.<br />
Auch in anderen Themenfeldern wie der Pflege des baulichen Erbes, die<br />
eine dauerhafte Verpflichtung des Bauministeriums ist, oder auch der künstlerischen<br />
Gestaltung von Bauwerken sind die baupolitischen Ziele des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen auf wegweisende Art manifestiert worden. Insgesamt<br />
tragen über 200 Einzelmaßnahmen, die bis zum <strong>Jahre</strong>sende 2004<br />
realisiert werden konnten, entscheidend zur Profilierung der Baukultur bei.<br />
Natürlich gerät in Zeiten wirtschaftlicher und haushaltspolitischer Engpässe<br />
auch die besondere Finanzierung dieser Maßnahmen aus dem Landeshaushalt<br />
auf den Prüfstand. Vor diesem Hintergrund wird es eine große Herausforderung<br />
sein, gemeinsam mit allen Akteuren und der <strong>Landesinitiative</strong><br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> sich für eine ständige Fortentwicklung der Baukultur<br />
zu engagieren.<br />
91
Karin Bandow<br />
und Volker Katthagen<br />
Ein Experiment, so beschreibt es das Lexikon, ist ein Wagnis – ein gewagtes,<br />
unsicheres Unternehmen. Es ist der Versuch, Neues zu entdecken und sichtbar<br />
zu machen oder Zusammenhänge, Relationen aufzuzeigen, die bislang<br />
nicht gesehen wurden. Immer geht es um Erkenntnisgewinn…<br />
Take 1 – Expertengespräch<br />
Das Europäische Haus der Stadtkultur und Pixelprojekt_Ruhrgebiet, eine<br />
Kooperation freier Fotografen, diskutieren Fragen eines möglichen gemeinsamen<br />
Projekts: Wie lassen sich, am Beispiel des Ruhrgebiets, Potenziale von<br />
Gebäuden, Stadträumen und Landschaften mit Fotografie entdecken und<br />
kommunizieren, und wie lässt sich Baukultur anders als im Format der klassischen<br />
Architekturfotografie vermitteln? Sie debattieren im Rahmen eines<br />
ganztägigen Expertengesprächs mit Lehrenden von neun Hochschulen die<br />
unterschiedlichen Arbeits- und Sichtweisen von Architekten und Planern<br />
92<br />
Mögliche Orte – Bildwelten, Planerwelten?!<br />
Ein experimenteller interdisziplinärer Studentenworkshop<br />
einerseits, von Fotografen und Fotodesignern auf der anderen<br />
Seite. Was erhoffen sich Architekten und Ingenieure<br />
von einer Zusammenarbeit mit Fotografen? Mit welchen<br />
Erwartungen begeben sich Fotodesigner in eine im besten<br />
Sinne „bedingungslose” Kooperation mit Planern? Gemeinsam<br />
vereinbaren sie einen Praxistest, einen interdisziplinären<br />
Studentenworkshop zu einem frei zu wählenden Thema –<br />
mitten im Ruhrgebiet.
Take 2 – Workshop<br />
Mitten im Ruhrgebiet – da liegt der stadt.bau.raum. Von<br />
hier aus starten im Mai 2005 zehn paritätisch mit Architekten/Planern<br />
sowie Fotografen/Fotodesignern besetzte Studentengruppen<br />
– ausgestattet mit Kompass und Kamera –<br />
ihre Expeditionen ins Ruhrgebiet. Ihnen vorgegeben sind<br />
einzig die Himmelsrichtung und die Dauer ihrer Expedition;<br />
Themen und Orte ihrer Arbeit finden sie auf ihrem Weg<br />
selbst. Die 37 Studenten entdecken geheime Orte, die man<br />
besser nicht fotografiert – schließlich sollen sie geheim bleiben<br />
– und manipulieren das betreffende Kartenmaterial, um<br />
das Auffinden der Orte zu erschweren. Sie dokumentieren<br />
den Insel-Urbanismus des Ruhrgebiets, das enge Nebeneinander<br />
unterschiedlicher Lebenswelten und die Vielzahl von<br />
Grenzlinien, Schnittstellen und Rändern. Sie intervenieren<br />
in den monofunktionalen Alltagsräumen durch temporäre<br />
Aneignungen und inszenieren vermeintliche Un-Orte zu<br />
Möglichkeitsräumen – und sie erproben schließlich ganz<br />
eigene, schon fast situationistisch anmutende Formen der<br />
Zusammenarbeit wie jene beiden Gruppen, die im ständigen<br />
gegenseitigen Wechsel an ihren Themen und Orten arbeiten.<br />
Nach einer Woche geht der Workshop zu Ende: Entstanden<br />
ist nicht nur ein besseres Verständnis für die Sichtweisen<br />
und „Motive” des anderen, sondern ein vorbehaltwie<br />
schonungsloser Einblick in die städtischen Wirklichkeiten<br />
und Möglichkeiten Gelsenkirchens.<br />
Take 3 – Ausstellung<br />
Der Studentenworkshop wird zur „schulschau“: Die Studierenden aus Bochum,<br />
Bielefeld, Dortmund, Essen, Hamburg, Wismar und Wuppertal präsentieren<br />
ihre zehn Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung im stadt.bau.raum, dem<br />
base camp ihrer Workshoparbeit und Ausgangspunkt ihrer Expeditionen.<br />
Auch die Ausstellung selbst hat ihr base camp: ein den Raum durchquerender<br />
Leuchttisch veranschaulicht die Kernaussagen des Projekts und erlaubt<br />
anhand hunderter frei arrangierter Dias jedem Besucher einen individuell<br />
zusammengestellten Einblick, vorausgesetzt, er nutzt die Möglichkeit, sich<br />
auf diese Weise sein eigenes Bild zu machen. Jede der zehn Gruppen hat<br />
darüber hinaus ihren eigenen „Claim”, an dem sie ihre Ergebnisse präsentiert:<br />
lange, von der Decke abgehängte Stoffbahnen mit Grafiken und Bildern,<br />
die jeder noch so kleine Windstoß zu „bewegten Bildern” macht, und<br />
große Plattformen mit genau jenem Oberflächenmaterial, das die Gruppen<br />
an „ihren” Orten vorgefunden haben. Wer sich also über Rasen, Ziegelsteine,<br />
Schilfrohr, Betonplatten, Rindenmulch und „Lidl”-Pflaster durch die Ausstellung<br />
bewegt, erlebt die „möglichen Orte” Gelsenkirchen auf eine Weise,<br />
wie es die Bilder dann doch nicht ermöglichen.<br />
…ein Experiment ist dann besonders erfolgreich, wenn es nicht nur ein<br />
solches Resultat, sondern einen Zuwachs an Erkenntnis und Einsicht für die<br />
Beteiligten erzielt. Die Fotografen und Fotodesigner haben während des<br />
Workshops erfahren können, wie sehr ihre Fotografien zu dem Bild von<br />
Stadt beitragen, das gerade in schrumpfenden Städten neu entwickelt wird.<br />
Und die angehenden Planer und Architekten haben erlebt, dass professionelle<br />
Unvoreingenommenheit in solchen Städten häufig weiterführt als ein<br />
Beharren auf den Prinzipien eines traditionellen Städtebaus. Bild- und Planerwelten<br />
– sie haben an diesen möglichen Orten der Stadt zusammengefunden.<br />
93
Hans-Ulrich Ruf<br />
94<br />
Tag der Architektur in <strong>NRW</strong>
Bauen fasziniert die Menschen seit jeher, wie sich kulturhistorisch<br />
zweifelsfrei belegen lässt. Um aber diese eher stille<br />
Faszination in ein bewusstes und dauerhaftes Interesse<br />
an Architektur und Stadtentwicklung weiter zu entwickeln,<br />
müssen Menschen von Architektur bewegt und für sie begeistert<br />
werden; und zwar nicht nur für die Architektur besonderer<br />
Bauwerke, sondern auch für „Alltagsarchitektur“, für<br />
die gebaute Umwelt, die unser Leben Tag für Tag beeinflusst.<br />
Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Architektur<br />
ihrer Stadt und ihrer Region nahe zu bringen, hat die Architektenkammer<br />
Nordrhein-Westfalen vor zehn <strong>Jahre</strong>n den<br />
„Tag der Architektur“ ins Leben gerufen. Am jeweils letzten<br />
Wochenende im Juni stehen seitdem Jahr für Jahr mehrere<br />
hundert neue oder erneuerte Gebäude und Objekte der<br />
Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung<br />
für alle Interessierten offen. Architekten und Bauherren<br />
laden gemeinsam dazu ein, neue Bauten und neu gestaltete<br />
Freiräume, Gärten, Parks und Plätze zu begehen und mit<br />
Fachleuten vor Ort zu diskutieren.<br />
Der Tag der Architektur bietet Einblicke sowohl in Gebäude selbst als auch<br />
in das Leistungsspektrum der Architekten und die persönlichen Motive und<br />
Erfahrungen der Bauherren. Der Tag der Architektur lädt dazu ein, Gebäude,<br />
die sonst verschlossen sind, zu besichtigen, in lockerer Atmosphäre Gespräche<br />
mit Architekten und Bauherren zu führen und Ideen für eigene Vorhaben<br />
zu sammeln. Eine einmalige Gelegenheit, die immer mehr Menschen nutzen:<br />
Seit dem ersten Tag der Architektur ist die Zahl der Besucherinnen und<br />
Besucher kontinuierlich gestiegen, auf mittlerweile über 30.000 allein in<br />
Nordrhein-Westfalen!<br />
Der große Erfolg des Tags der Architektur, der sich bundesweit in der<br />
öffentlichen und medialen Resonanz widerspiegelt, beruht auf dem Zusammenspiel<br />
von menschlicher Neugier und dem Wunsch nach Kommunikation.<br />
Das Bedürfnis nach einem Austausch über konkrete Projekte vor Ort,<br />
aber auch über grundsätzliche Fragen des Planens und Bauens ist dabei am<br />
Tag der Architektur ein gegenseitiges: Die Besucherinnen und Besucher<br />
können – ganz nach individuellem Interesse – Anregungen für eigene Projekte<br />
sammeln, mit den Fachleuten diskutieren oder ganz einfach Architektur<br />
hautnah erleben. Den beteiligten Architektinnen und Architekten ihrerseits<br />
bietet sich ein Forum, ihre jüngsten Arbeiten öffentlich zu präsentieren,<br />
ihr Leistungsprofil darzustellen und Kontakte zu Interessierten und potenziellen<br />
Bauherren knüpfen zu können. Bauherren und Investoren sind in der<br />
Regel gerne bereit, ihr Objekt dem interessierten Publikum zu präsentieren.<br />
Hier wird der Bauherren-Stolz ergänzt um den Wunsch, sich mit anderen<br />
Architektur-Interessierten auszutauschen und Erfahrungen weiterzugeben.<br />
Am Tag der Architektur wird ein öffentlicher Diskurs über Architektur in<br />
einer Breite erreicht wie an keinem anderen Tag im Jahr. Damit rührt die<br />
Veranstaltung an den Kern der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong>, die den Tag<br />
der Architektur zu einem ihrer Leitprojekte ernannt hat. Das gemeinsame<br />
Ziel ist, eine breite öffentliche Diskussion rund um die Themen Architektur,<br />
Wohnen und Stadtentwicklung in Gang zu bringen und die Menschen für<br />
ihre gebaute Umwelt zu sensibilisieren. Dies gelingt am besten, wenn Menschen<br />
in ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt angesprochen werden. Die<br />
Vielfalt des Tags der Architektur ist deshalb seine große Stärke. 2005 waren<br />
in <strong>NRW</strong> über 500 Objekte zu besichtigen: private Wohnhäuser und öffentliche<br />
Einrichtungen, Bürogebäude und Gewerbebauten, Garten- und Grünanlagen<br />
sowie Plätze und Freiflächen – und zwar überall in Nordrhein-Westfalen,<br />
in den Ballungsräumen wie in den dünn besiedelten Regionen, in den<br />
Großstädten wie auf dem Land.<br />
Der Tag der Architektur ergänzt damit die vielfältigen Leitprojekte und<br />
Projekte, mit denen die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> das Bewusstsein für Architektur<br />
in <strong>NRW</strong> schärfen will, um ein zentrales Element: den Diskurs über<br />
„Alltagsarchitektur“ im besten Sinne!<br />
95
Dörte Gatermann<br />
96<br />
koelnarchitektur.de
Wann hören wir in den Medien in Deutschland etwas über<br />
Architektur? Sehr selten! Und wenn es denn einmal geschieht,<br />
dann handelt es sich um gut gemeinte „Bildbesprechungen”<br />
im Feuilleton, die mit der Realität und der Bedeutung von<br />
Architektur für unser aller Leben herzlich wenig zu tun<br />
haben und häufig weder diesem Aspekt noch einer Annäherung<br />
an Architektur als Kulturbeitrag gerecht werden. Im<br />
Wirtschaftsteil unter Immobilien ist schon eher ab und zu<br />
ein Beitrag zu finden, der sich dann aber fast ausschließlich<br />
mit der Vermarktbarkeit von Gebautem beschäftigt und<br />
selten mit deren Qualitätskriterien.<br />
Natürlich erfährt die Öffentlichkeit etwas über die reißerischen<br />
Projekte, die, bei denen es um tatsächliche oder mögliche<br />
große Schäden geht. Denn „nur eine schlechte Nachricht<br />
ist eine gute Nachricht” für die Medien. So wurde der<br />
Schürmann-Bau in Bonn nach der Hochwasserkatastrophe<br />
und den anstehenden hohen Millionensanierungen zur<br />
traurigen Berühmtheit. Und natürlich ist die mögliche Streichung<br />
des Kölner Domes von der Liste der Weltkulturerbestätten<br />
aufgrund des Baus von Hochhäusern auf der dem<br />
Dom gegenüberliegenden Rheinseite zum medialen Dauerbrenner<br />
geworden. Aber werden hier tatsächlich inhaltliche<br />
Diskussionen geführt und fundiert dargestellt? Dabei ist das<br />
Interesse, auch über kleinere lokale Architekturbeiträge zu<br />
sprechen, durchaus vorhanden.<br />
Die Notwendigkeit einer öffentlichen und möglichst fundierten<br />
Diskussion ist keine neue Erkenntnis und wurde vielfach<br />
von unseren Architekturvätern, insbesondere im Bund Deutscher<br />
Architekten BDA, angeregt. Aus diesen Überlegungen<br />
heraus entstand 1991 in Köln der Gedanke, über ein anschauliches<br />
Stadtmodell den baulichen Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
der Stadt deutlich zu machen und<br />
mit diesem Instrument eine breite Diskussion anzufachen.<br />
Über ein Public-Private Partnership wurde ein Konzept für das Zusammenwirken<br />
von Privatwirtschaft und kommunaler Verwaltung erstellt. Gemeinsam<br />
mit dem Stadtplanungsamt und unter Schirmherrschaft des Bürgermeisters<br />
und des Stadtdirektors wurden Sponsoren in der Kölner Wirtschaft<br />
gesucht, wobei die Struktur Kölns als einer kunst- und kulturinteressierten<br />
Bürgerstadt von großem Vorteil war. In <strong>Jahre</strong>n darauf wuchs das Modell<br />
ständig und fand seinen Platz im Jahr 2004 in der öffentlich zugänglichen<br />
und zugleich politiknahen glasgedeckten Halle des Rathauses. Obwohl das<br />
Modell eine gute Arbeitsbasis für Architekten und eine anschauliche Grundlage<br />
für die Diskussion um Veränderungen der Stadt bot, war die kontinuierliche<br />
Auseinandersetzung mit Baukultur hierdurch allein nicht gegeben.<br />
Dieses Vakuum war auch anderen, aus Sicht von Architekten eher Fachfremden<br />
wie den Kommunikationsdesignern Thomas Hebler und Oliver<br />
Schwarz aufgefallen. Gemeinsam mit der Initiative Kölner Stadtmodell entstand<br />
im Jahr 2000 die Überlegung, die Diskussion um Architektur auf einer<br />
anderen Ebene zu führen, nämlich in einem „Haus der Architektur im Internet”.<br />
So entstand „koelnarchitektur.de“, ein Internetportal, das die Diskussion<br />
um Baukultur in Köln auf sehr vielfältige Weise anregen will. Da ein solches<br />
Portal nicht allein von der Idee lebt, wurde hierfür eine Kooperation<br />
aus mehr als zehn Initiativen gebildet, die sich in Köln auf unterschiedlichste<br />
Weise mit Baukultur beschäftigen.<br />
Über die ersten und stetig erweiterten Module eines modernen Architekturführers<br />
und eines aktuellen Pressespiegels hinaus wurde die Plattform kontinuierlich<br />
weiter ausgebaut und stellt heute ein umfangreiches Spektrum<br />
an Themen zur Architektur in Köln dar. Die Kombination aus Informationen<br />
sowohl für Fachleute als auch für interessierte Laien über verschiedene<br />
Module, die einen weiten Blick auch auf die Kultur des Bauens bieten, führte<br />
zu hohen Besucherzahlen des Portals. Gerade in Zeiten anderer Aktivitäten<br />
wie der jährlichen Architekturwoche „plan” wird das Internetportal besonders<br />
stark frequentiert.<br />
Natürlich ersetzt diese Plattform nicht die direkte Auseinandersetzung über<br />
Baukultur in Form von Gesprächen, Ausstellungen, Diskussionsforen und<br />
Berichterstattungen. Aber sie ist eine weitere Möglichkeit, die insbesondere<br />
auch jüngere Interessierte anspricht, eine Auseinandersetzung über unsere<br />
gebaute Umwelt zu führen und diese möglichst positiv zu beeinflussen.<br />
Schließlich ist die Architektur die „Mutter aller Künste” und dieser Bedeutung<br />
gemäß sollten alle Bevölkerungsgruppen ein aktives Interesse an bestmöglicher<br />
Qualität von Architektur entwickeln und einbringen können.<br />
Vielleicht werden auch die klassischen Medien sich dann verstärkt einer<br />
kontinuierlichen, fundierten Auseinandersetzung mit dem so wichtigen<br />
Thema Baukultur widmen.<br />
97
Kay von Keitz und Sabine Voggenreiter<br />
plan – Forum aktueller Architektur in Köln<br />
98
Worum ging es uns, als wir 1998 die ersten Überlegungen<br />
anstellten zu unserem „Forum aktueller Architektur in Köln”,<br />
dem wir dann den Namen „plan” gegeben haben? Wir wollten<br />
eine Plattform, eine Bühne schaffen, auf der sich gegenwärtige<br />
Architektur in einem angemessen weit gefassten<br />
Verständnis – schließlich kennen wir alle die Dehnungskräfte,<br />
denen dieser Begriff ausgesetzt ist – darstellen kann. Physisch<br />
sollte die Stadt selbst mit ihrer Vielzahl von unterschiedlichen<br />
Schauplätzen jene Bühne sein, auf der temporär ein<br />
Ausstellungs-, Installations- und Veranstaltungsnetzwerk<br />
kreiert wird – und somit zugleich ein Parcours, der durch<br />
das „Hyperexponat” Stadt führt. Ein in dieser Form neuartiges<br />
Konzept mit zwei primären Zielen: erstens, das direkte<br />
und inspirierende Kommunizieren zwischen den professionellen<br />
Akteuren, den „Architekturmachern”, zu ermöglichen<br />
oder zu intensivieren und zweitens, ein Vermittlungsinstrument<br />
zu entwickeln, um das große kulturelle und alltagskulturelle,<br />
ja zivilisatorische Thema Architektur einem breiten<br />
Publikum nahe zu bringen. Dass Architektur als „Allgemeinbildungsgut”<br />
in Deutschland zu wenig Beachtung findet,<br />
wird ja inzwischen kaum noch bestritten. Unsere Überzeugung<br />
in der Sache, unser Know-how und eine gute<br />
Portion gesunder Naivität sorgten dafür, dass wir tatsächlich<br />
innerhalb eines <strong>Jahre</strong>s die erste Ausgabe von plan auf die<br />
Beine stellen und bis heute auch jedes Jahr eine weitere<br />
plan-Woche realisieren konnten.<br />
Seit der plan1999 haben wir selbstverständlich einiges dazugelernt<br />
und uns bei einer Reihe von Partnern großes Vertrauen<br />
erworben. Bei allen Verbesserungen und Weiterentwicklungen,<br />
die wir in den letzten <strong>Jahre</strong>n – resultierend aus<br />
den eigenen Erfahrungen, aber auch aufgrund von vielen<br />
produktiven Rückmeldungen und Kommentaren – vorgenommen<br />
haben, sind wir doch im Kern unseres Projektansatzes<br />
nachhaltig bestätigt worden. Mehr denn je sind offene Diskussions-<br />
und Erprobungsräume, wie wir sie mit plan herzustellen<br />
versuchen, vonnöten, da die allgemeine politische<br />
Tendenz, sämtliche Lebensbereiche ausschließlich durch die<br />
Brille ökonomischer Verwertbarkeit zu betrachten, natürlich<br />
Architektur und Stadtentwicklung mit einschließt. Symptomatisch<br />
hierfür ist, dass seit ein paar <strong>Jahre</strong>n Marketing nun<br />
auch in gebeutelten Architektenkreisen zum Schlüsselbegriff mit eingebautem<br />
Heilsversprechen avanciert. Und wenn hier von Kommunikation und<br />
Vermittlung die Rede ist, sind in der Regel mehr oder weniger fragwürdige<br />
Werbestrategien gemeint – entsprechende Agenturen schießen derzeit wie<br />
Pilze aus dem Boden. Wie gesagt, dass eine breit angelegte Vermittlungsarbeit<br />
und die Entwicklung hierfür geeigneter Kommunikationsformen notwendig<br />
sind, um die vielfältigen Potenziale von Architektur und Architektenkompetenz<br />
bewusst zu machen, das entspricht auch unseren Erkenntnissen.<br />
Dieser Aufgabe wird man jedoch in ihrer gesellschaftlich-kulturellen Dimension,<br />
die sie nun mal hat, nicht durch simples Imagestyling und Officebranding<br />
gerecht. Das Gleiche gilt übrigens genauso für die Städte: Der reflexartige<br />
Ruf nach „wirkungsvollen” Marketingkonzepten klingt oft genug wie<br />
der nach billigen Wunderkuren.<br />
Ganz bewusst haben wir für die <strong>Jahre</strong> 2004 bis 2006 das Thema Wohnen<br />
mit seinen unterschiedlichen Facetten zum dreiteiligen plan-Schwerpunktthema<br />
bestimmt, um gleichermaßen „auf der anderen Seite”, beim sogenannten<br />
Laienpublikum, das Bewusstsein für das Alltägliche und Allgegenwärtige<br />
von Gebautem, sprich: eben für das alles, was tatsächlich mit dem<br />
Begriff Architektur bezeichnet wird, zu schärfen. Denn die Vorstellung, dass<br />
mit Architektur lediglich spektakuläre Museumsbauten, Regierungssitzkulissen<br />
im Rücken von Fernsehjournalisten oder umstrittene Hochhaustürme<br />
gemeint seien, ist leider immer noch weit verbreitet. Dabei geht es doch bei<br />
jedweder baulichen Gestaltung oder auch Nichtgestaltung um die mehr<br />
oder weniger prägende Beschaffenheit unserer Lebenswelt. Ganz unmittelbar<br />
bildet sich das ab im Bereich der Wohnarchitektur und ihren Antwortversuchen<br />
auf einschneidende strukturelle und soziale Veränderungen –<br />
immer mal wieder kombiniert mit zaghaften oder auch mutigen Modellen<br />
der Bewohnerbeteiligung. Das sich verstärkende soziale Gefälle, ein gewandeltes<br />
Zentrum-Peripherie-Verhältnis, der zunehmende Umnutzungsdruck<br />
und die inzwischen vieldiskutierten Stadtschrumpfungen bezeugen die<br />
gesellschaftlichen, demographischen und auch ästhetischen Brüche, die hier<br />
zum Tragen kommen. Fragen nach der Demokratisierung architektonischer<br />
und städtebaulicher Entwicklungen werden heute neu gestellt. Die anschauliche<br />
Darstellung dieser Phänomene im Rahmen von plan trägt dazu bei,<br />
dass die alltagskulturelle Bedeutung von Architektur, Städtebau und Stadtplanung<br />
breiter wahrgenommen und erfahren werden kann. In diesem<br />
Sinne ist plan ein Forum und ein Festival, das dem Thema Architektur eine<br />
möglichst flexible Spielstätte zur inhaltlichen Vertiefung und zur kulturellen<br />
Popularisierung bereiten will.<br />
99
100<br />
Peter Brdenk<br />
Essen erlebt Architektur
Am Anfang war „Essen erlebt Architektur“ ein fast unmögliches<br />
Projekt – wie viele andere Projekte, die mit ungewöhnlichen<br />
Ideen beginnen. Nachdem der Bund Deutscher Architekten<br />
(BDA) Essen 1998 seinen neuen Vorstand gewählt<br />
hatte, begannen in darauffolgenden Sitzungen sehr intensive<br />
Überlegungen, wie man jenseits der üblichen, aber notwendigen<br />
Öffentlichkeitsarbeit eines Architektenverbandes seine<br />
zentralen Anliegen – Stadtgestalt, Architektur, Baukultur,<br />
und zwar bezogen auf die eigene Stadt – besser und wirksamer<br />
als bisher thematisieren könne. Es sollte ein Format<br />
gefunden werden, das nicht nur die eigene Klientel und<br />
ein paar Kulturbeflissene der Stadt, sondern die städtische<br />
Öffentlichkeit als Ganzes anspricht: Die Bürger Essens sollten<br />
für die Gestaltung ihres eigenen Lebensraums, für das Bild<br />
ihrer Stadt sensibilisiert werden. Sie sollten die Ästhetik ihrer<br />
Stadt erkennen, nein, „erleben” und ein Bewusstsein für<br />
Gestaltung von Gebäuden, Straßenräumen und Plätzen in<br />
ihrer Stadt entwickeln können.<br />
Ein halbes Jahr später, im Sommer 1999, war es dann soweit:<br />
Wir konnten das Projekt „Essen erlebt Architektur“ der<br />
Öffentlichkeit vorstellen. Es war allerdings weniger ein Projekt,<br />
mehr eine ganze Projektreihe, die über mehrere <strong>Jahre</strong><br />
insgesamt 23 unterschiedliche Themen- und Veranstaltungsschwerpunkte<br />
umfasste. Bei aller Begeisterung begegnete<br />
uns auch ein wenig Skepsis ob der Fülle des Programms. Es<br />
war keine Kritik an den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen –<br />
ganz im Gegenteil; sondern es gab Bedenken, ob das Projekt<br />
überhaupt durchführbar sei. So falsch lagen die damaligen<br />
Skeptiker – auch aus heutiger Sicht – nicht: Die Projektreihe<br />
hat allen Beteiligten über mehrere <strong>Jahre</strong> ein enormes<br />
und sehr zeitintensives Engagement abverlangt, ein Engagement,<br />
das wohl nicht beliebig wiederholbar ist. Es hätte<br />
trotz des hohen Engagements aber nicht funktioniert ohne das stringente<br />
Management der gesamten Programmreihe und die eine oder andere spontane<br />
Eingebung von Aktiven, die über schwierige Situationen hinweggeholfen<br />
hat.<br />
Von 2000 bis 2002, also über die Dauer von drei <strong>Jahre</strong>n, fand die Reihe<br />
dann mit ihren 23 Programmpunkten und ca. 150 Sonderveranstaltungen<br />
statt. Das Rundumprogramm mit Ausstellungen, Diskussionen, Filmen,<br />
Kunstinstallationen, Stadtteilprojekten und interessanten Führungen wurde<br />
zu einem großen Erfolg: Architektur, Stadtgestaltung, Baukultur sind zu<br />
einem öffentlichen Thema in der Stadt geworden, manchmal zum regelrechten<br />
Tagesgespräch. Das ist vor allem dann gelungen, wenn wie in den<br />
Projekten „BauKunst” oder „Das verrückte Stadtteilding” konkrete Objekte<br />
entstanden sind; Projekte also, die sich nicht allein in der Diskussion um das<br />
Stadtbild erschöpften, sondern reale Interventionen im Stadtraum zum<br />
Gegenstand hatten. Sie haben die Wahrnehmung der Orte verändert, an<br />
denen diese Aktionen und Installationen stattfanden.<br />
In den drei <strong>Jahre</strong>n haben mehr als 100.000 Interessierte die Veranstaltungen<br />
besucht, das Medienecho und die zahlreichen Berichterstattungen<br />
brachten jedoch noch sehr viel mehr Menschen mit „Essen erlebt Architektur“<br />
in Berührung. Es sind kreative Netzwerke geknüpft worden, es haben<br />
sich neue Kooperationen entwickelt, die auch heute noch Architektur und<br />
Baukultur in Essen als lebendiges Kulturgeschehen in der Stadt erfahrbar<br />
machen. Zu nennen ist hier zum Beispiel das „Forum Kunst und Architektur”,<br />
das im Jahr 2002 gemeinsam vom BDA Essen, dem Ruhrländischen<br />
Künstlerbund, dem Wirtschaftsverband Bildender Künstler gegründet wurde<br />
und seither als Plattform und Impulsgeber für den Diskurs um Architektur,<br />
Stadtgestalt und Kunst in der Stadt Essen fungiert. Das „Forum Kunst und<br />
Architektur” nimmt – drei <strong>Jahre</strong> nach dem Abschluss des Veranstaltungszyklus‘<br />
„Essen erlebt Architektur“ – an anderen Projekten der Initiative<br />
<strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> teil und ist heute Kooperationspartner in der landesweiten<br />
Veranstaltungsreihe „KunsttrifftStadt”.<br />
101
Henrik Sander<br />
Wohnen in Dortmund, arbeiten in Essen, in Bochum ins Theater gehen, der<br />
Geschäftspartner sitzt in Köln, zum Kaffee nach Düsseldorf und am Wochenende<br />
ins Emschertal oder gleich nach Holland an die Nordsee. Das alltägliche<br />
Leben im Rhein-Ruhr-Raum spielt sich irgendwo zwischen Köln und<br />
Dortmund ab. Dieser alltäglichen Erfahrung fehlt jedoch eine tiefgreifende<br />
regionale Perspektive, eine Perspektive, die den Stolz der Menschen zum<br />
Ausdruck bringen könnte: den Stolz, dass Rhein-Ruhr die größte europäische<br />
Stadtregion ist, größer als Paris, London oder die Randstad.<br />
Die bescheidene Verbundenheit seiner Bewohner ist die große Stärke der<br />
Region: Sie erzeugt dezentrale Strukturen, eine Vielfalt an Orten und Städten<br />
mit eigenen Identitäten und unterschiedlichsten Strategien im Umgang<br />
mit dem Strukturwandel. Vielfalt ist eine der wesentlichen Stärken, aber<br />
auch die entscheidende Schwäche der Region. Denn Vielfalt alleine erzeugt<br />
keine Außenwirkung. Es fehlt die „Story”, die aus Rhein-Ruhr mehr macht<br />
als ein Patchwork an Teilräumen. Dies bestätigte kürzlich auch noch einmal<br />
Saskia Sassen auf dem Metropolenkongress Rhein-Ruhr.<br />
102<br />
RheinRuhrCity<br />
Die Ausstellung RheinRuhrCity suchte eine Story für diese<br />
einzigartige europäische Metropolregion. Sie wagte einen<br />
Perspektivenwechsel, der nicht mehr die Innenwahrnehmung<br />
mit den regionalen Besonderheiten des Karnevals<br />
oder der unterschiedlichen Bundesligatraditionen in den<br />
Mittelpunkt stellte, sondern der Frage nachging, wie sich<br />
der Ballungsraum als zusammenhängende regionale Einheit<br />
beschreiben und nach außen hin darstellen läßt. Das Projekt<br />
sollte provozieren und auch irritieren. Ein „Nachdenken bei<br />
gelockerter Vernunft”, so Minister Michael Vesper, sollte<br />
die Phantasie anregen: Was ist die zentrale Perspektive des<br />
Ballungsraums und wie grenzt er sich eigentlich ab? Liegt<br />
die Zukunft darin, die räumlichen und politischen Zentren zu<br />
stärken oder eher in noch mehr Polyzentralität?<br />
Gemeinsam mit Hochschulen aus der Region und den Niederlanden<br />
unternahm das niederländische Büro MVRDV eine<br />
fiktive Reise in die Zukunft der Region und entwarf für das<br />
heterogene Agglomerat Rhein-Ruhr nicht das eine Zukunftsbild<br />
– sondern vier ganz unterschiedliche Szenarien. Nach<br />
dem Prinzip der Extremisierung, für das MVRDV international<br />
bekannt ist, wurde jeweils eine klar konturierte Entwicklungsperspektive<br />
für die gesamte Region durchgespielt. Im<br />
Park-Szenario verwandelte sich die geschrumpfte Region in<br />
einen Neo-Urwald, das Archipel-Szenario beschrieb die ökonomische<br />
Spezialisierung von Teilräumen mit Essen als
Mega- und Düsseldorf als Airport-City, das Campus-Szenario<br />
machte die Region zu einer unendlichen Wissenschaftslandschaft,<br />
eingebettet in Wälder und Weltraumbahnhöfe, und<br />
das Netzwerk-Szenario befreite Rhein-Ruhr mit doppelstöckigen<br />
Autobahnen, Metrorapid und Luftschiffen von<br />
seinen Verkehrsproblemen.<br />
Aus der Vogelperspektive erlebten die Ausstellungsbesucher<br />
die kontinuierliche Mutation der Region. Durch die Überlagerung<br />
von real gefilmten und künstlich eingefügten<br />
Elementen wurden immer neue Zustände der RheinRuhrCity<br />
komponiert. Im war room konnte darüber hinaus jeder Besucher<br />
seine eigene Metropole basteln. Technische Grundlage<br />
all dieser Szenarien war die Software RegionMaker. Mit<br />
ihr ließen sich Einflüsse unterschiedlicher Faktoren auf die<br />
strukturelle Entwicklung der Region simulieren. Gefüttert<br />
wurde das Programm mit allen Daten, die zu einem Raum<br />
und seiner Gesellschaft gehören: Wohnen, Industrie, Straßen,<br />
Grünflächen, Kriminalität, Stadtwachstum, Landnutzung<br />
und so weiter.<br />
Der RegionMaker ist ein dynamisches Anschauungsmittel,<br />
er suggeriert mit seiner empirischen Datengrundlage Machbarkeit<br />
und Rationalität und repräsentiert doch „mehr einen<br />
Traum, als eine anwendbare Realität”, so MVRDV. Dieser<br />
Zwiespalt gab der Ausstellung ihren gewollt irritierenden Charakter, machte<br />
sie aber gleichzeitig auf merkwürdige Art ungreifbar.<br />
Im Rückblick wirkt sie für den ersten Moment wie ein schöner Traum, der<br />
schnell wieder verblasst. Dabei beschrieb RheinRuhrCity latent Vorhandenes,<br />
und wer sich durch die Vielzahl der Szenarien nicht verwirren ließ, der<br />
konnte in ihnen bestehende regionale Strukturen wiedererkennen. Häufig<br />
waren die Bilder unscharf verortet. Die Bürogebäude wachsen nun mal im<br />
Duisburger Innenhafen und nicht, wie das Campus-Szenario suggeriert, im<br />
Duisburger Hafen. Aber diese Form der Realitätsnähe war auch nicht Ziel<br />
der Ausstellung und eine gewisse Unschärfe der einkalkulierte Preis für den<br />
unvoreingenommenen Blick von außen.<br />
Die Leistung der Ausstellung besteht darin, dass sie grundlegende räumliche<br />
Strukturen sichtbar gemacht hat; sie hat mögliche Stories aufgezeigt, die<br />
die unübersichtliche Vielfalt der Region beschreiben können. Nun liegt es an<br />
uns, aus diesen „Träumen” eine „anwendbare Realität” werden zu lassen,<br />
aus den Szenarien eine (konsistente) Story zu formulieren. Diese Story wird<br />
sicherlich nicht nur auf einem der vier Szenarien basieren, denn RheinRuhr-<br />
City ist schon heute Park, Archipel, Campus und Netzwerk – nicht überall,<br />
nicht gleichermaßen, und natürlich nicht in dieser extremen Form. Die Szenarien<br />
ermöglichen aber eine produktiv-kritische (Selbst-)Reflexion der Region:<br />
Wo ist RheinRuhrCity Park, wo Archipel, wo Campus, wo Netzwerk und<br />
wo etwas gänzlich anderes? Aus dieser Differenzierung, die zugleich Selbstund<br />
Fremdbild der Region und ihrer Teilräume berücksichtigt, ließe sich die<br />
Story entwickeln, die die Vielfalt dieser Metropolregion zu einer nach innen<br />
und außen überzeugenden Botschaft macht: Diversity is the message und<br />
RheinRuhrCity war nur der Anfang.<br />
103
Thorsten Schauz, Yasemin Utku und Angela Uttke<br />
Im September 2004 fand in der Abtei Brauweiler in Pulheim<br />
der Fachkongress „<strong>NRW</strong>urbanism” der <strong>Landesinitiative</strong><br />
Stadtbaukultur <strong>NRW</strong> statt. Inhaltlich wurde die eintägige<br />
Veranstaltung vom Europäischen Haus der Stadtkultur in<br />
Kooperation mit der Universität Dortmund vorbereitet.<br />
Intention war, mit dem Reizthema „New Urbanism” eine<br />
Diskussion über städtebauliche Probleme und Handlungsfelder<br />
in Nordrhein-Westfalen anzustoßen. Drei der Mitorganisatoren<br />
des Kongresses, Yasemin Utku (Institut für Raumplanung,<br />
Universität Dortmund), Thorsten Schauz und Angela<br />
Uttke (beide Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung,<br />
Universität Dortmund), trafen sich im Januar 2005 zu einer<br />
Nachlese des Kongresses.<br />
Schauz: Gibt es ein „Lernen von Pulheim”?<br />
Uttke: Von konkreten Ergebnissen eines Kongresses zu sprechen,<br />
ist kaum möglich. Die intensive Beschäftigung mit dem<br />
Thema der Übertragbarkeit des New Urbanism auf Nordrhein-Westfalen<br />
hat Antworten auf unterschiedlichen Ebenen<br />
geliefert. Das Thema und die Beiträge haben viele Diskussionen<br />
angeschoben und vor allem Denkanstöße gegeben. Das<br />
würde ich schon als einen Erfolg bezeichnen, von dem man<br />
lernen kann.<br />
Utku: Meiner Meinung nach hat während der Diskussionen<br />
eine Entmystifizierung des Begriffs New Urbanism stattgefunden.<br />
Wir sind ja schon im Vorfeld des Kongresses auf<br />
zum Teil heftige, oft ablehnende Reaktionen gestoßen.<br />
Allgemein betrachtet verbinde ich mit „Lernen von Pulheim”<br />
die Erkenntnis, dass man einen fruchtbaren Diskurs stiften<br />
kann, wenn man mit einem guten Thema einen möglichst<br />
breiten Personenkreis anspricht.<br />
Uttke: Ja, die Bandbreite der Teilnehmer war schon beeindruckend:<br />
von Stadtbauräten über Verwaltungsmitarbeiter,<br />
Vertretern aus der Immobilienbranche, Planern, Vertretern<br />
von Universitäten bis hin zu vielen weiteren Akteursgruppen.<br />
Ich denke, das hat entscheidend zu der Diskussionskultur<br />
von Pulheim beigetragen.<br />
104<br />
<strong>NRW</strong>urbanism<br />
<strong>StadtBauKultur</strong>-Kongress 2004<br />
Schauz: Auch die sorgfältige und vielschichtige Beleuchtung des Themas<br />
spielte dabei eine große Rolle, gewissermaßen die Dramaturgie des Kongresses<br />
...<br />
Utku: ... wobei die Eröffnung des Kongresses mit der Einführung in das<br />
Thema „New Urbanism” und die Präsentation unterschiedlicher Standpunkte<br />
wie üblich im Plenum stattfand. Die anschließende Vertiefung und Diskussion<br />
in den vier Arbeitsgruppen anhand konkreter Projekte war auch spannend –<br />
schon in der Vorbereitung haben wir ja von einem „Feuerwerk der Projekte”<br />
gesprochen. Die Stellungnahmen im abschließenden Plenum machten den<br />
großen Diskussionsbedarf dann erneut deutlich. Der Reader mit einer Artikelsammlung<br />
zum Tagungsthema, der jedem Teilnehmer schon im Vorfeld<br />
zur Verfügung stand, war sicherlich ein gutes Fundament für den Kongress<br />
und dient vielen vermutlich auch als Nachschlagewerk über die Veranstaltung<br />
hinaus. Insgesamt denke ich, dass durch die unterschiedlichen Informations-<br />
und Diskussionsebenen schließlich eine Einordnung des Themas in<br />
den nordrhein-westfälischen Alltag ermöglicht wurde.<br />
Schauz: Für die die Abtei Brauweiler mit ihren Räumlichkeiten einen gelungenen<br />
Rahmen bildete! Könnte man aus der großen Resonanz auf den Kongress<br />
in Pulheim schließen, dass ein Nachholbedarf und dementsprechend<br />
ein großes Interesse am Austausch über Fragen des Planens und Bauens in<br />
Nordrhein-Westfalen besteht?<br />
Uttke: Aus meinen Erfahrungen und den Pausengesprächen während des<br />
Kongresses würde ich das unbedingt bestätigen. Mir wurde mehrfach<br />
gesagt, dass es kein Forum in Nordrhein-Westfalen gäbe, in dem anhand<br />
konkreter Projekte über Planungs- und Baukultur in Nordrhein-Westfalen<br />
diskutiert wird. Über das Vehikel „New Urbanism“ ist uns das in Pulheim<br />
gelungen.<br />
Schauz: Das hieße, ein jährlich stattfindender Kongress zu einem planungsrelevanten<br />
Thema wäre ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu mehr<br />
Kommunikation und einer beständigen Diskussionskultur in Nordrhein-<br />
Westfalen – eigentlich eine zentrale Aufgabe der <strong>Landesinitiative</strong> StadtBau-<br />
Kultur <strong>NRW</strong>. Wobei die Kongressthemen streitbar sein sollten, so wie das<br />
Thema „New Urbanism – <strong>NRW</strong>urbanism” ein Streitthema war.<br />
Utku: Ein Ziel zur Durchführung solcher <strong>Jahre</strong>skongresse sollte es auch sein,<br />
für neue Themen oder „Nischenthemen” zu sensibilisieren, Dogmen abzubauen<br />
und Kommunikation und Diskurs zu stiften.<br />
a
nrw urbanism<br />
nrw urbanism<br />
Uttke: Dabei müssten die Themen aber so aufbereitet werden, dass sie eine<br />
möglichst breite Zielgruppe unter den im weitesten Sinne mit Bau- und Planungsfragen<br />
Beschäftigten ansprechen. Auch die Kooperation der <strong>Landesinitiative</strong><br />
mit einer in Nordrhein-Westfalen angesiedelten forschenden Institution<br />
wie einer Hochschule oder einem Institut halte ich für sinnvoll.<br />
Utku: Wenn man an die Abtei Brauweiler zurückdenkt, die für viele Kongressteilnehmer<br />
eine positive Neuentdeckung war, ist auch der Ort für<br />
einen künftigen Kongress sorgfältig auszuwählen. Es wäre eine Chance,<br />
„neue” und weniger bekannte Orte in <strong>NRW</strong> zu entdecken und zu bespielen.<br />
Schauz: Was könnte denn Gegenstand eines Kongresses an so einem „noch<br />
zu entdeckenden” Ort sein?<br />
Uttke: Sicherlich ist die Zugkraft eines internationalen Themas samt internationalen<br />
Gästen nicht zu unterschätzen. So willkommen ein Blick über den<br />
Tellerrand auch ist, ich hatte besonders in den Arbeitsgruppen in Pulheim<br />
den Eindruck, dass ein „Herunterbrechen” internationaler Themen auf den<br />
Bezugsraum Nordrhein-Westfalen in dem begrenzten Zeitrahmen, den ein<br />
Kongress nun einmal besitzt, schwer fällt und kaum zu leisten ist.<br />
Utku: Wie wäre es, die IBA Emscherpark aus der Versenkung zu holen und<br />
den aufgebauten und immer wieder zitierten Mythos zu hinterfragen? Aus<br />
dieser „Revision” könnten sicherlich Ansätze für eine qualitätsvolle „Stadt-<br />
BauKultur <strong>NRW</strong>” abgeleitet werden.<br />
nis 105<br />
Uttke: Wobei für mich ein Thema wie „den Alltag planen” auch seinen Reiz<br />
hat. Wie gehen wir mit den alltäglichen Planungsaufgaben im Wohnungsund<br />
Gewerbebau um und wo liegen hier Spielräume für mehr Qualität und<br />
Varianz? Dieses Thema hat der Biennale-Beitrag „Deutschlandschaft” sehr<br />
gut angeschnitten, doch fehlt hier in Nordrhein-Westfalen bis jetzt noch<br />
eine weitergehende Diskussion anhand konkreter Projekte.<br />
Schauz: Faszinierende Themen gibt es wirklich mehr als genug. Entscheidend<br />
ist bei der Themenwahl sicherlich, vor allem die Balance zu halten zwischen<br />
„Publikumswirksamkeit” und praktischer Relevanz für Nordrhein-<br />
Westfalen.<br />
Utku: „Lernen von Pulheim” bedeutet also unter dem Strich, dass sich ein<br />
Städtebaukongress als Medium für das Stiften einer Diskussionskultur in<br />
Nordrhein-Westfalen bewährt hat. Eine Fortsetzung als feste jährliche Veranstaltungsgröße<br />
der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> mit wechselnden<br />
Kooperationspartnern wäre wirklich eine gute Sache. Ich bin schon<br />
heute gespannt auf die kommenden Kongresse.
Frauke Burgdorff<br />
Die Realität ist nicht einheitlich. Sie setzt sich – wenn man es so formulieren<br />
will – aus unterschiedlichen Wirklichkeiten zusammen. Obwohl die jeweilige<br />
Wirklichkeit aus mess- und fassbaren Dingen besteht, wird sie wahlweise<br />
von unterschiedlichen Parteien anders wahrgenommen oder Teile von ihr<br />
werden bewusst ausgeblendet und nicht beachtet.<br />
Daraus resultiert nicht selten, dass Bauträger und Immobilienentwickler<br />
staunend vor den extravaganten Entwürfen von Architekten und Stadtplanern<br />
stehen und keine Realisierungschance in dem Vorgedachten sehen.<br />
Daraus resultiert aber auch, dass Investitionen nur kurzfristig die gewünschte<br />
Rendite erbringen und auf der Basis von scheinbar effizienten Kriterien<br />
schon nach wenigen <strong>Jahre</strong>n Verluste zu verzeichnen sind.<br />
Der <strong>Jahre</strong>skongress 2005 der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> „Realität [Bauen]”<br />
hatte sich diesem komplexen Zusammenhang gestellt und sich vorgenommen,<br />
abgegrenzte Wirklichkeiten der Baukultur miteinander zu konfrontieren<br />
und die Sicht auf scheinbar fest gefügte Dinge durch den Blick des<br />
jeweilig anderen zu bereichern. Dies hieß konkret, dass wir Macher und Forscher,<br />
Entwerfer und Bauträger, Entwickler und Denker eingeladen hatten,<br />
die sich mit unterschiedlichen Feldern des Planens und Bauens beschäftigen.<br />
Das Konzept für diesen Kongress wurde mit Bernd Kniess diskutiert und von<br />
Yasemin Utku, Leonhard Lagos und mir entwickelt. Die Absicht war, in der<br />
Gegenüberstellung der unterschiedlichen Interpretationen der Realität einen<br />
geschärfteren Blick auf das Realisierbare innerhalb der scheinbar engen<br />
Grenzen der eigenen Wirklichkeit zu schaffen.<br />
Eine Phänomenologin (Susanne Hauser), ein Projektentwickler und Bauträger<br />
(Burkhard Drescher) und einen Architekt (Jean Philippe Vassal) stellten<br />
zum Einstieg ihre jeweilige Position der Alltagswahrnehmung und -praxis<br />
dar. Susanne Hauser hat deutlich gemacht, dass die Orte der Peripherie für<br />
die Wahrnehmung von baukultureller Qualität bestimmend sind und – auch<br />
wenn sie keine wachsende Zukunft haben – sein werden. Burkhard Drescher<br />
hat die Herausforderungen dargestellt, denen sich ein Unternehmen<br />
stellen muss, das in einem schrumpfenden Markt Wohn- und Gewerbestandorte<br />
entwickelt, baut und pflegt. Und schließlich hat Jean Philippe<br />
Vassal Konzepte seines Büros vorgestellt, die das Wohnen mit wenigen<br />
106<br />
Realität [Bauen]<br />
<strong>StadtBauKultur</strong>-Kongress 2005
Mitteln aus dem Bestand oder als Neubau qualitätvoll und an den gegenwärtigen<br />
Lebensweisen orientiert gestalten.<br />
Die Themenfelder, die in den Arbeitsgruppen des Kongresses im Mittelpunkt<br />
der Diskussionen standen, haben wir am Rande der allfälligen Baukulturdebatten<br />
gefunden und ganz bewusst gesetzt. Denn die Beschäftigung mit<br />
Straßen und Einfamilienhäusern, mit Gewerbegebieten und Quartiersentwicklungen<br />
steht leider nur selten auf der Tagesordnung der Baukultur.<br />
Doch gerade diese Bau- und Planungsanlässe, die scheinbar nebensächlichen<br />
urbanen oder disurbanen Bauereignisse machen das Gros der Entwicklung<br />
aus. Sie prägen unsere Räume nachhaltig – im Guten wie im Schlechten.<br />
In allen Arbeitsgruppen kristallisierte sich das heraus, was schon in der<br />
Podiumsdiskussion thematisiert wurde: Bau- und Planungsfachleute müssen<br />
sowohl untereinander als auch gegenüber den Bewohnern einer Stadt ihre<br />
Sprachfähigkeit zurückgewinnen oder besser kultivieren. In den hoch spezialisierten<br />
Handlungsfeldern der Planungslandschaft scheint es zunehmend<br />
schwieriger, Qualität als Basis für eine stabile ökonomische Entwicklung<br />
darzustellen. Und daran ist weniger die Wirtschaftslage als die interne und<br />
externe Kommunikation schuld. Offenbar ist die Vermittlung, dass es sich<br />
mittel- und langfristig für alle Renditeinteressierten lohnt, in Qualität zu<br />
investieren, ein erster wesentlicher Schritt.<br />
Wir haben mit diesem Kongress eine Auseinandersetzung begonnen, die<br />
wohl auch in Zukunft die Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> prägen wird. Denn<br />
es ist deutlich geworden, dass die konstruierten Feindschaften zwischen<br />
baukulturell Gutmeinenden und Missetätern so nicht haltbar sind. Der<br />
Dialog zwischen den Positionen, das vorbehaltlose „kennen lernen” der<br />
Arbeits- und Wirkmechanismen des jeweilig anderen sind essenziell, um in<br />
Zukunft das heimliche Motto des Kongresses Wirklichkeit werden zu lassen:<br />
Jammern verboten, Pragmatismus erwünscht!<br />
107
108
Traditionen (er)finden<br />
109
Jörn Rüsen<br />
Was ist Tradition?<br />
Tradition ist eine Frage der historischen Kultur. Nahezu alle Gruppen, Länder,<br />
sogar ganze Zivilisationen haben ihre besonderen Traditionen und legen<br />
großen Wert darauf, sie zu kultivieren. Tradition wird sichtbar in Monumenten,<br />
in Gebäuden, in Straßennamen, in Museen, in Lehrbüchern, in öffentlichen<br />
Reden und in vielen anderen Formen öffentlicher Präsentation.<br />
Gemeinsames Ziel dieser Repräsentationen ist es, zu bekräftigen, dass man<br />
sich an etwas gebunden fühlt, das in der Vergangenheit geschah und für<br />
die Zukunft normative Bedeutung hat. Nationen zelebrieren den Tag ihrer<br />
Gründung; die damit verbundenen Feierlichkeiten bestätigen zumeist, dass<br />
die Menschen sich heute jenen Normen und Werten verpflichtet fühlen, die<br />
in dem seinerzeit neu gegründeten politischen System Realität geworden<br />
sind. Weit verbreitet sind Werte wie „Unabhängigkeit“ und „Freiheit“;<br />
indem Menschen sich gemeinsam daran erinnern, wie diese Werte in ihre<br />
Form des Zusammenlebens, ihre gesellschaftliche Formation, aufgenommen<br />
wurden, werden sie von den Menschen gegenwärtig – und erfolgreich –<br />
als Tradition wiedergegeben.<br />
Tradition ist die Idee einer unveränderlichen Essenz in den ansonsten wechselhaften<br />
Bedingungen und Umständen des Lebens. Tradition steht nicht<br />
nur für Kontinuität, sondern trägt die Dimension des ewig Gültigen in sich.<br />
Ein simples Beispiel aus dem Alltag internationaler Werbekampagnen:<br />
Mitsubishi wirbt für sein Hochtechnologieprodukt „Automobil“, indem der<br />
Konzern sich auf die alte Tradition japanischer Handwerksperfektion bei<br />
der Herstellung von Samuraischwertern bezieht. „Der Geist der Perfektion“<br />
weht als unveränderte Tradition durch die jahrtausendealte japanische<br />
Geschichte bis zu den neuesten Automodellen von Mitsubishi.<br />
Anerkannte Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind gleichzeitig<br />
empirisch und normativ; sie sind darüber hinaus spezifisch für einzelne<br />
Nationen oder Gruppen. Daher unterscheiden sie sich substanziell voneinander.<br />
Sie spielen eine wichtige Rolle im kulturellen Leben, hauptsächlich als<br />
Grundlage für allgemein akzeptierte Prinzipien. Auf ihnen basiert das<br />
110<br />
Tradition und Identität<br />
Theoretische Reflexionen und<br />
das europäische Beispiel<br />
Im Übrigen mag das Wesentliche einer Tradition,<br />
ihre letzte Rechtfertigung darin bestehen,<br />
in dem Moment, wo kein Ausweg, keine Zuflucht mehr erkennbar sind,<br />
Trost zu spenden, ein Stückchen Traum,<br />
einen kurzen Augenblick der Illusion herbeizuzaubern.<br />
Saul Friedländer<br />
Gefühl, dass man im täglichen und im öffentlichen Leben<br />
die gleichen Haltungen teilt und sich an gemeinsame Grundregeln<br />
halten sollte. Menschen sind daher sehr bemüht, ihre<br />
gemeinsamen Traditionen immer wieder zu bestätigen.<br />
Traditionen sind deshalb immer Gegenstand kultureller Aktivitäten<br />
und kommunikativer Strategien, die sie lebendig und<br />
wirkungsvoll halten sollen.<br />
Man kann vier Ebenen unterscheiden, auf denen Tradition<br />
und ihre Wirkungsweise sichtbar wird:<br />
(1) Die grundlegende Ebene ist die der „unbewussten Dispositionen<br />
und Determinierungen“ des täglichen Lebens. Hier<br />
erscheint und wirkt Tradition als Selbstverständlichkeit.<br />
(2) Auf der Ebene der „alltäglichen Kommunikation“ werden<br />
selbstverständliche Traditionen zur Diskussion gestellt und<br />
auf neue und ungewöhnliche Situationen angewendet.<br />
(3) Diese „reflektierende Legitimation“ von Tradition findet<br />
auch noch auf einer anderen Ebene statt, nämlich dort, wo<br />
Formen des Zusammenlebens normativ verhandelt werden.<br />
Tradition wird dort reflektiert, kritisiert, legitimiert, Vergleichen<br />
unterzogen und schließlich sogar verändert. Obwohl<br />
Menschen zumeist denken, dass Tradition etwas Unveränderliches<br />
und Festes sei, ist sie dennoch Weiterentwicklungen<br />
und Veränderungen unterworfen.<br />
(4) Auf einer anderen Ebene erscheint Tradition als allgemein<br />
akzeptierter Gegenstand offizieller Gedenkfeiern. Hier ist<br />
sie ein fest etabliertes und machtvolles Element historischer<br />
Kultur, das man als „explizite Selbstverständlichkeit einer<br />
verpflichtenden Vergangenheit“ bezeichnen könnte. Im akademischen<br />
Diskurs wird dies als „kulturelles Gedächtnis“<br />
bezeichnet (Assmann, J. 1992; Assmann; J. 1995; Assmann,<br />
A. 1999).
Was ist Identität?<br />
Identität ist die Antwort auf die Frage, wer jemand ist. Diese<br />
Antwort kann durch eine Person, eine Gruppe, eine Nation,<br />
eine ganze Zivilisation gegeben werden. Tatsächlich ist Identität<br />
eine kulturelle Notwendigkeit für jede soziale Einheit<br />
im menschlichen Zusammenleben. Sie ist ein Gefühl und<br />
eine Überzeugung von Zugehörigkeit, von Zusammengehörigkeit;<br />
gleichzeitig ist diese Zugehörigkeit eine Unterscheidung<br />
von anderen. Identität bedeutet nicht unbedingt,<br />
uniform zu sein. Anstatt von Uniformität sollte man vielmehr<br />
von Gemeinschaftlichkeit mit und Verschiedenheit zu<br />
anderen sprechen. Sie ist eine Art verinnerlichter Kohäsion –<br />
oder Kohärenz – in sozialen Beziehungen, eine Frage von<br />
Subjektivität.<br />
Wandel ist eine elementare Herausforderung für Identitätsbildung,<br />
denn Wandel widerspricht dem grundlegenden<br />
menschlichen Bedürfnis nach Beständigkeit und sozialer<br />
Zugehörigkeit (Müller 1987). Deshalb befassen sich Prozesse<br />
der Identitätsbildung immer mit „Zeit“. Sie versuchen, Zeit<br />
eine Form zu geben, in der Identität überleben, bestehen<br />
oder sich entwickeln kann. Das menschliche Selbst erhält<br />
seine Gestalt in einem komplexen Wechselspiel aus Erinnerung<br />
an die Vergangenheit und Projektion in die Zukunft,<br />
indem Vergangenheit im Hinblick auf das Bedürfnis nach<br />
Fortsetzung interpretiert wird.<br />
Historische Identität ist eine äußerst elaborierte Form dieser<br />
gewissermaßen „zeitlichen Gestalt“ des menschlichen<br />
Selbst. Die kulturelle Strategie, diese zeitliche Gestalt des<br />
menschlichen Selbst hervorzubringen, besteht darin, eine<br />
Geschichte zu erzählen. Geschichten, die die Identität der<br />
Menschen in einer zeitlich erweiterten Perspektive erzählen,<br />
bezeichnet man als „Meta-Erzählungen“. Starke Erzählungen,<br />
die die historische Identität der Menschen repräsentieren,<br />
sind aber genauso zerbrechlich wie die menschliche<br />
Identität selbst, sie sind gleichermaßen vom Wandel der<br />
Lebensumstände bedroht und herausgefordert.<br />
Das Wechselspiel zwischen Tradition und Identität<br />
Tradition ist die grundlegende Form, durch die Identität geprägt wird. Die<br />
Menschen werden in ein bestehendes kulturelles System hineingeboren, das<br />
bestimmt, wer sie sind. Und sie haben diese Vorausbedingungen in ihren<br />
mentalen Körpern verinnerlicht, in ihrem Selbst-Sein – als Vermittlungsfeld<br />
zwischen ihren persönlichen Interessen und Zielen auf der einen und den<br />
gesellschaftlichen Ansprüchen und Pflichten auf der anderen Seite. Ohne<br />
eine solche traditionelle Grundlage gibt es keine Identität. Tradition stellt<br />
Identität als selbstverständlich dar, als feste Größe in einer sich verändernden<br />
Welt menschlicher Beziehungen. Um diese Dauerhaftigkeit und Stabilität<br />
des Eigenen geht es auf allen Ebenen, bei denen Tradition eine Rolle im<br />
menschlichen Leben spielt.<br />
(1) Auf der „elementaren Ebene der unbewussten Selbstverständlichkeit“<br />
erhält das menschliche Selbst seine erste Form von Selbstwahrnehmung<br />
und Selbstachtung und die ersten Überzeugungen über Zusammengehörigkeit<br />
und Verschiedenheit zu anderen.<br />
(2) Diese Grundmuster geraten auf der zweiten Ebene in „eine kommunikative<br />
Bewegung“, wenn die Menschen ihre Selbst-Erfahrung interpretieren<br />
müssen – also die Art und Weise, wie ihnen andere begegnet sind und wie<br />
sie mit ihrem Konzept ihres Selbst anderen begegnen.<br />
(3) Auf der dritten Ebene, dort wo „Traditionen explizit thematisiert“ werden,<br />
wird Tradition zum Gegenstand mehr oder weniger systematischer Reflektion.<br />
Die stärkste Form von Kommunikation ist hier die Frage „Wer bin ich?“<br />
oder „Wer sind wir?“– unausweichliche Fragen, weil das menschliche Leben<br />
von Zeit zu Zeit mit einer Situation konfrontiert wird, in der die Stabilität<br />
bestehender Identitätskonzepte radikal herausgefordert, angegriffen und<br />
gefährdet wird.<br />
(4) Auf der vierten Ebene, auf der „obligatorische Modelle und Paradigmen<br />
historischer Identität“ sich etabliert haben, wird Tradition permanent kultiviert,<br />
heraufbeschworen und legitimiert. Dort werden die Ursprünge nach<br />
wie vor gültiger Lebensweisen zelebriert. <strong>Jahre</strong>stage und Jubiläen bestätigen<br />
und festigen die gemeinsamen Wertesysteme und Modelle von Selbst-<br />
Verständnis und historischer Repräsentation.<br />
Meta-Erzählungen und Grundsatzdiskurse über historische Identität finden<br />
auf all diesen Ebenen statt, sie werden jeweils an neue Situationen angepasst,<br />
die durch neue Erfahrungen und Erwartungen gekennzeichnet sind.<br />
Hier ist traditionelle Identität eine Frage von zeitlichem Wandel. Gerade<br />
wenn die Umstände sich ändern, muss sich auch traditionelle Identität verändern,<br />
um die Vorstellung von Stabilität und eine Kontinuität von Verpflichtung,<br />
die sich aus traditioneller Identität ergibt, aufrechterhalten zu<br />
können.<br />
Modernität steht in einem grundsätzlichen Gegensatz zur Idee der unveränderbaren<br />
Gültigkeit von Lebensweisen. Sie betont den Wandel als Voraussetzung<br />
für Kontinuität. Die Kategorie des Fortschritts, die typisch für das<br />
moderne historische Denken und seine Logik ist, widerspricht der Art, wie<br />
historische Identität durch Tradition geformt wird. Aber dennoch ist die<br />
Überzeugung, dass sich die Grundlagen der eigenen Identität nicht verändern,<br />
sondern stabil bleiben, ein machtvolles Element moderner historischer<br />
Kultur. So erhält Tradition ihre spezifischen modernen Formen, z.B. eine<br />
innere zeitliche Dynamik, wenn es um die Darstellung von Stabilität und<br />
Kontinuität geht (Assmann, A. 1999).<br />
111
Konstruktion und Konstruiertheit<br />
Historische Identität ist immer eine Synthese aus Erfahrung aus der Vergangenheit<br />
und Erwartungen an die Zukunft. Sie wird von den beiden konstituierenden<br />
Motiven des menschlichen Denkens über Zeit bestimmt. Husserl<br />
hat sie „Retention“ und „Protention“ genannt (Husserl 1980). In der Alltagssprache<br />
können wir von Gedächtnis und Erwartung sprechen. Das „Gedächtnis“<br />
bezieht sich auf Erfahrungen und die „Erwartung“ steht in Beziehung<br />
zu Zielen, Werten und Normen. Wir alle wissen, dass das Gedächtnis die<br />
Vergangenheit, auf die es sich bezieht, so verändert, dass sie den Interessen<br />
der Person oder der Menschen entspricht, die sich erinnern. Das ist der<br />
Effekt der Erwartung in ihrer Synthese mit dem Gedächtnis. Auf der anderen<br />
Seite ist Identität mehr als das, was Menschen sein wollen. Sie müssen<br />
diesen Wunsch und diese Projektion mit ihrer Selbsterfahrung in Einklang<br />
bringen, und das trifft auf Individuen ebenso zu wie auf Gruppen, Nationen<br />
und Zivilisationen.<br />
So entsteht ein enger Zusammenhang von Tradition und Identität; konstituiert<br />
durch eine sehr spannungsreiche Mischung und Synthese aus Erfahrung<br />
und Normen und Werten, von faktischen Bedingungen und fiktionalen Vorstellungen.<br />
Das menschliche Leben als kultureller Prozess ist eine Errungenschaft<br />
dieser Synthese, die durch die Kräfte des menschlichen Verstandes<br />
hervorgebracht wird. Der Verstand strebt danach, die Beziehung eines Menschen<br />
zu den Anderen unter sich verändernden Bedingungen zu begreifen.<br />
112<br />
Europäische Identität: eine Forderung für die Zukunft<br />
Der andauernde Prozess der europäischen Vereinigung ist<br />
ein faszinierendes Beispiel für die Möglichkeiten und Grenzen<br />
des Schaffens von Traditionen, um neue Identitäten zu<br />
formen. Der Ausgangspunkt für diesen Prozess ist die traditionelle<br />
Dominanz nationaler Identität in nahezu allen<br />
europäischen Ländern. Die verschiedenen europäischen<br />
Nationen zu vereinen bedeutet überhaupt nicht, die Vielfältigkeit<br />
und die Unterschiede der nationalen Identitäten<br />
zugunsten einer einzigen europäischen Identität aufzugeben.<br />
Europäisch zu sein ist etwas ganz anderes. Es ist eine<br />
wechselseitige Beziehung der Nationalitäten, eine Kommunikation<br />
zwischen sehr unterschiedlichen nationalen und<br />
regionalen Traditionen. Damit in Europa ein Gefühl der<br />
Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit entstehen kann,<br />
muss diese Vielfalt integriert werden. Das Motto dieser Integration<br />
ist von großer Bedeutung: Einheit durch Vielfalt.<br />
Die entstehende historische Identität ist supranational, aber<br />
nicht anti-national. Sie integriert Unterschiede, ohne sie aufzulösen.<br />
Integration bedeutet, dass diese Merkmale und<br />
Strukturen der nationalen Identität, die eine stark exklusive<br />
Natur haben, so verändert werden müssen, dass die nationalen<br />
Traditionen eine supranationale Gemeinsamkeit<br />
einschließen. Diese europäische Zusammengehörigkeit muss<br />
eine starke normative Logik aufweisen, wenn sie zu einer<br />
allgemein gültigen Logik von Identitätsbildung, die an Tradition<br />
gekoppelt ist, heranreifen soll. Was passiert in diesem<br />
Integrationsprozess auf der Ebene der identitätsbildenden<br />
Traditionen?<br />
Zuerst muss die aggressive Exklusivität der traditionellen<br />
nationalen Identität zugunsten eines inklusiven Nationalismus<br />
überwunden und verändert werden. Dies ist ein sehr<br />
wichtiger Aspekt in der Logik historischer Sinngenerierung<br />
und Identitätsbildung (Rüsen 2000). Exklusiver Nationalismus<br />
ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel für die weit verbreitete<br />
und tief verwurzelte Art der historischen Sinngenerierung<br />
und Identitätsbildung, die man als „Ethnozentrismus“<br />
bezeichnen kann. Die Bedrohung durch den Ethnozentrismus<br />
und seine permanente Gefahr resultieren aus kulturellen<br />
Prozessen, die problematische, störende, irritierende,<br />
unterdrückte Elemente dem Bild der Anderen zuschreiben.<br />
Indem man die negativen Elemente des eigenen Selbst in<br />
die Andersartigkeit der Anderen exterritorialisiert, wird die<br />
identitätsbildende Vorstellung vom eigenen Volk untrennbar<br />
auf die Andersartigkeit der Anderen fokussiert.
Der europäische Vereinigungsprozess ist ein bemerkenswertes<br />
Beispiel für den Versuch, diesen Ethnozentrismus zu<br />
überwinden, der durch traditionelle Konzepte von Nationalität<br />
verkörpert wird. Europäisierung kann nur dann ein<br />
überzeugendes Konzept für eine transnationale Identität<br />
werden, wenn es die zerstörerischen Elemente des exklusiven<br />
Ethnozentrismus überwindet, der die europäische Geschichte<br />
für eine lange Zeit beeinflusst und letztlich in zwei<br />
Weltkriege geführt hat. Historisches Denken kann zu dieser<br />
Überwindung des Ethnozentrismus durch die „Aufnahme<br />
der negativen historischen Erfahrungen in das Selbstbild der<br />
historischen Identität“ beitragen. Dies ist in Europa definitiv<br />
der Fall. Eines der deutlichsten Beispiele, das den deutschen<br />
Ethnozentrismus betrifft, ist die Entscheidung des deutschen<br />
Parlaments, im Zentrum der deutschen Hauptstadt ein<br />
Monument zum Gedenken an die Millionen der von Deutschen<br />
ermordeten Juden zu errichten (Kirsch 2003).<br />
Es gibt Tendenzen in anderen europäischen Nationen, in<br />
denen diese wachsende Ambivalenz in der eigenen Identitätsbildung<br />
ebenfalls beobachtet werden kann. In Schweden<br />
hat eine Studie über die europäische Dimension des Holocaust<br />
bemerkenswerte Resultate hervorgebracht (Karlsson<br />
und Zander 2003; van Vree 2002) und die Nachbarn Deutschlands<br />
haben erkannt, dass es in ihren Ländern bemerkenswert<br />
viel Kollaboration von Nicht-Deutschen mit den Nazis<br />
gegeben hat, ohne die den Nazis das ganze Ausmaß des<br />
Holocaust nicht möglich gewesen wäre.<br />
Aber nicht nur der Holocaust ist eine schwierige und herausfordernde<br />
historische Erfahrung, die aus dem historischen<br />
Selbstbild der Deutschen und ihrer Nachbarn langfristig nicht<br />
exterritorialisiert werden kann, sondern auch der europäische<br />
Imperialismus: Er wird zu einer Bürde in der europäischen<br />
historischen Identität und löst auf diese Weise das traditionelle<br />
westliche Gefühl der Überlegenheit gegenüber nichtwestlichen<br />
Zivilisationen auf. Die Katastrophe des Zweiten<br />
Weltkrieges demonstriert die verheerenden Konsequenzen<br />
exklusiver Formen von Tradition und traditioneller Identität.<br />
Niemand kann vorhersagen, wie erfolgreich die Versuche sein werden, den<br />
tief verwurzelten Ethnozentrismus in den kulturellen Praktiken traditioneller<br />
Identitätsbildung in Europa zu überwinden. Für allzuviel Optimismus gibt<br />
es wenig Anlass: Es ist nicht zu übersehen, dass der Ethnozentrismus als<br />
bedeutendes Element selbst in der akademischen Welt noch nicht ausreichend<br />
reflektiert wurde: Ein einflussreicher Spenglerismus ist in vielen Versuchen<br />
des interkulturellen Vergleichs immer noch gültig. Sehr oft werden<br />
Kulturen oder Zivilisationen als semantische Ganzheiten definiert, die nur in<br />
einer externen Beziehung zueinander stehen. In diesem Fall geht die Idee<br />
der Menschheit nicht über kulturelle Unterschiede hinaus. Vielmehr sollte<br />
sie aber die verschiedenen Traditionen in eine lebendige Kommunikation<br />
führen, in der das Erkennen von Unterschieden eine gemeinsame, alltägliche<br />
Angelegenheit ist.<br />
Der Ethnozentrismus und sein Ansatz, Welt-Kulturen und ihre wechselseitigen<br />
Beziehungen in vergleichenden akademischen Studien zu thematisieren,<br />
widerspricht eigentlich der methodischen Rationalität der Kulturwissenschaften.<br />
Er verstößt grundsätzlich gegen den Anspruch auf Wahrheit, der<br />
für alle gilt, die gemeinsam versuchen, kulturelle Unterschiede zu verstehen<br />
und zu erkennen. Dies geschieht – und das gilt wohl für eine Vielzahl von<br />
Sphären, in denen unterschiedliche Traditionen und Identitäten begründet<br />
werden und in Beziehung zueinander treten – auf der Basis universeller<br />
Gleichheit. Gerade für die akademische Welt sollte ein solcher „Geist der<br />
Vernunft“ selbstverständlich sein.<br />
Übersetzung aus dem Englischen: Heike Reintanz-Vanselow<br />
Literatur:<br />
Assmann, A.: Zeit und Tradition. Kulturelle Strategien der Dauer.<br />
Beiträge zur Geschichtskultur Bd. 15. Köln 1999<br />
Assmann, A.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses.<br />
München 1999<br />
Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen<br />
Hochkulturen. München 1992<br />
Assmann, J.: „Collective Memory and Cultural Identity.“ in New German Critique<br />
No 65. 1995, S. 125-133<br />
Friedländer, S.: Wenn die Erinnerung kommt.<br />
Stuttgart 1979, S. 74f.<br />
Husserl, E.: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins.<br />
herausgegeben von Heidegger, M. (Zweite Auflage) Tübingen 1980<br />
Karlsson, K., Zander, U. (Hg.): Echoes of the Holocaust.<br />
Historical cultures in contemporary Europe. Lund 2003<br />
Kirsch, J.: Nationaler Mythos oder historische Trauer?<br />
Der Streit um ein zentrales „Holocaust-Mahnmal“ für die Berliner Republik.<br />
Beiträge zur Geschichtskultur Bd. 25. Köln 2003<br />
Müller, K. E.: Das magische Universum der Identität. Elementarformen sozialen Verhaltens.<br />
Ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt am Main 1987<br />
Rüsen, J.: „Cultural Currence. The Nature of Historical Consciousness in Europe.“<br />
in Macdonald, S. (Hg.): Approaches to European Historical Consciousness:<br />
Reflections and Provocations. Hamburg 2000, S. 75-85<br />
van Vree, F.: „Auschwitz and the Origins of Contemporary Historical Culture.<br />
Memories of World War II in a European Perspective.“<br />
in Pok, A., Rüsen, J., Scherrer, J. (Hg.): European History: Challenge for a Common<br />
Future. Eustory Serie, Shaping European History Bd. 3.<br />
Hamburg 2002, S. 202-220.<br />
113
Friedrich Achleitner<br />
114<br />
Regionalismus – Zwischen Tradition<br />
und Erfindung<br />
Die Skepsis ist berechtigt, ob es sich heute beim Thema „Regionalismus”<br />
nicht letzten Endes doch nur um eine Debatte um Scheinfragen handelt.<br />
Welchen Sinn haben regionale Begrenzungen in einer totalen Informationsgesellschaft,<br />
in einer sich mehr und mehr global organisierenden Welt?<br />
Was leisten regionale Bauformen in einer sich immer mehr gleichenden<br />
Produktions- und Dienstleistungswelt? Wird nicht das Regionale auf Folklore<br />
und damit auf den Tourismus beschränkt, auf die Darstellung und den Ausverkauf<br />
von Regionen, auf Einkleidung und die Inszenierung von „Events“,<br />
also auf eine sehr flüchtige Veranstaltungskultur?<br />
Ich möchte zu Beginn eine alte These wiederholen: Es handelt sich um den<br />
Antagonismus von regionalem Bauen und regionalistischer Architektur.<br />
Was beide trennt, ist vor allem auch eine zeitliche Distanz, ein Vor und<br />
Danach. Das regionale Bauen scheint jenen arglosen „paradiesischen“ Zustand<br />
zu zeigen, in dem die einfachen (nicht minder komplexen) Dinge<br />
ihren natürlichen Platz haben, es erscheint künstlerisch absichtslos, es orientiert<br />
sich an den Lebensumständen (der Arbeitswelt, dem Klima, den ökonomischen<br />
Ressourcen, den meist unreflektierten kulturellen Traditionen etc.),<br />
es dient dem Leben in der Region und ist oft arglos offen für das Neue,<br />
soweit es brauchbar ist, es denkt a priori rational, praktisch, ist schweigsam,<br />
an sachliche Bedingungen gebunden.<br />
Dieses regionale Bauen, fälschlich auch als anonyme Architektur bezeichnet,<br />
ist eben keine Architektur ohne Autoren, sondern es ist ein Bauen, das<br />
lange Zeit aus der architektonischen Wahrnehmung ausgeschlossen war.<br />
Natürlich kann man auch von Architektur reden, wenn man es in einem<br />
architektonischen Kontext betrachtet. Aber das ist ein anderes Thema. Und<br />
Autoren hatte die anonyme Architektur allemal, nur hatten sie als Handwerker<br />
eine andere Rolle als die Künstler in der Gesellschaft und sie wurden<br />
nicht von der „Kunstwelt“ wahrgenommen.<br />
Die regionalistische Architektur ist ein Kind des Historismus, der Verfügbarkeit<br />
über historische Formen, ein akademisches Phänomen der Wahrnehmung<br />
von baulichen Traditionen in einem architektonischen Kontext. Sie<br />
lebt von der städtischen Entdeckung der Regionen, sie kommt von außen,<br />
ist von urlaubendem und sommerfrischelndem Interesse. Die regionalistische<br />
Architektur ist die fortgesetzte Einkleidung einer Region mit vermeintlichen<br />
Formen ihrer selbst. Sie ist a priori selbstbespiegelnd, inszeniert, theatralisch,<br />
semantisch, ja narrativ und voll von Absichten, ist erprobt in der<br />
Selbstdarstellung von Ort- und Talschaften, spekulativ, kulturpolitisch und<br />
touristisch gesteuert, sie ist ein Bauen nach Stilmerkmalen und Formklischees.<br />
Die regionalistische Architektur ist aus dem Paradies, das sie im besten Falle<br />
noch verherrlicht, vertrieben.<br />
Natürlich muss ich einsehen, dass man zwar solche Gegensätze<br />
konstruieren kann, dass sie aber praktisch nicht mehr<br />
existieren, also keiner kulturellen Realität entsprechen. Wir<br />
müssen uns damit abfinden, dass auch der paradiesische<br />
Zustand, die Feier der einfachen Dinge, Konstrukte sind,<br />
Ergebnisse höchster Konzentration und geistiger Anstrengung.<br />
Die Jungfräulichkeit des absichtslosen Denkens, diese<br />
platonischen Existenzen gibt es nicht oder nicht mehr. Alles,<br />
was heute gebaut wird, findet vor dem Hintergrund unserer<br />
kulturellen Standards und höchsten Ansprüche statt. Ich<br />
begebe mich also auf das Glatteis von Verdächtigungen.<br />
Wenn auch niemand Regionen beschreiben, definieren oder<br />
gar ihre Merkmale, Grenzen, Eigenschaften, Charakteristika<br />
beschreiben kann, so existieren sie doch. Regionen können<br />
sich geographisch, ethnisch, sprachlich, religiös oder alles in<br />
einem definieren. Jeder, der in eine Region kommt – und je<br />
größer die Distanz zu seinem Herkommen ist, umso besser –<br />
nimmt diese wahr. Und was wäre ein Europa ohne seine<br />
Regionen?<br />
In den Regionen steckt auch ein subversives Element etwa<br />
gegenüber den Nationalstaaten, den kulturellen und politischen<br />
Zentren, gegenüber den oft beliebigen Grenzziehungen<br />
(über Regionen hinweg). Regionen, etwa in den Alpen,<br />
zerfallen selbst wieder in regionale Zonen, Täler zum Beispiel,<br />
und deren Bewohner können oft – gepaart mit hartnäckigen<br />
„Feindschaften“ – Dörfer einander ausgrenzen. So<br />
sind auch Regionen zufällige Produkte eines sehr komplexen<br />
zeitlichen und territorialen Gemenges. Die Art ihrer Wahrnehmung<br />
hängt nicht zuletzt von der Distanz zu ihnen ab.<br />
Der architektonische Historismus, die Aufarbeitung, Dokumentation<br />
und Bewertung der Architekturgeschichte, die<br />
Entdeckung, Beschreibung und damit auch Konstruktion<br />
von Stilen, ihre zeitliche „Verortung“ hat zu einem neuen<br />
und vor allem bewussten Umgang mit architektonischen<br />
Phänomenen geführt. Mit der Entwicklung und Konsolidierung<br />
der europäischen Nationalstaaten entstand die Frage<br />
„In welchem Style sollen wir bauen“ (Heinrich Hübsch,<br />
1828). Der Überblick und die Verfügbarkeit über historische<br />
Formen – einschließlich ihrer Transformation – haben zu
einem sehr bewussten, semantischen Umgang mit diesen<br />
geführt. Analog zur Sprachensituation diskutierte man<br />
Architektursprachen mit inhaltlichen Fixierungen und Zusammenhängen.<br />
So gesehen war eigentlich das 19. Jahrhundert,<br />
der Historismus, schon die Revolution der Moderne.<br />
Die Heimatschutzbewegungen, die sich gegen die erste<br />
Phase der Industrialisierung, der bautechnischen und typologischen<br />
Entwicklung und angeblichen architektonischen<br />
Gleichmacherei im 19. Jahrhundert wandten, haben nicht<br />
nur nationale Traditionen entdeckt – und wenn sie nicht<br />
vorhanden waren, konstruiert –, sondern auch regionale.<br />
Analog zu den zahlreichen Uniformen, die die Strukturen<br />
der Gesellschaft sichtbar machten (nicht nur im Militär),<br />
kamen die Trachten der Talschaften, der Stände und „Landmannschaften“.<br />
Analog wurde auch die regionalistische<br />
Architektur eingekleidet, so dass von Gottfried Semper bis<br />
Adolf Loos ein „Prinzip der Bekleidung“ diskutiert werden<br />
konnte.<br />
Die eigentliche Frage liegt also eher auf einer Wahrnehmungs-<br />
und Interpretationsebene: Was passt in eine Region<br />
und was passt nicht? Und solche Interpretationen sind natürlich<br />
abhängig von Denkweisen, Ideologien, politischen<br />
Absichten oder einfachen ökonomischen Interessen. Wenn<br />
eine Region für den Tourismus aufbereitet wird, werden selten<br />
echte, also meist falsche Interpretationen einer Region<br />
ins Spiel gebracht. Es werden leicht kopier- und multiplizierbare<br />
Klischees, plakative Elemente erzeugt, die mit der Vielfalt<br />
traditioneller Bauformen und -strukturen nichts mehr zu<br />
tun haben. So wurde der Regionalismus in Europa zu einem<br />
internationalen Phänomen, das – paradoxerweise – über<br />
die Regionen hinweg gerade das Gegenteil von dem produzierte,<br />
was es erreichen wollte: statt Vielfalt und kulturellen<br />
Landschaftsbezug eine öde Gleichmacherei.<br />
Deshalb geht es heute nicht mehr um die formale Interpretation von Regionen,<br />
um stilistische Einkleidung, um die Interpretation von kulturellen Situationen,<br />
sondern um ihre Erneuerung aus den heutigen Bedingungen. Die<br />
Moderne des 20. Jahrhunderts, obwohl aus einer Ablehnung des Stildenkens<br />
des 19. Jahrhunderts geboren, ist immer wieder, angefangen vom Heimatstil,<br />
Expressionismus, Funktionalismus, Internationalen Stil bis zur Post- und<br />
Spätmoderne, in die stilistische Falle getappt. Erfindungen, neue Gedanken<br />
und Entwicklungen wurden fast gleichzeitig formal repetiert, das heißt, der<br />
Historismus ist ein „systemimmanentes Phänomen“ der Moderne. Vielleicht<br />
wissen wir auch zu viel über das Medium Architektur, so dass uns immer<br />
wieder die Erinnerung einen Streich spielt, dass uns Sehgewohnheiten und<br />
das damit verbundene Zitieren den klaren Blick auf die Probleme verdecken.<br />
Außerdem sind unsere Erinnerungen in Bildern gespeichert, in Bildserien,<br />
und diese sind von ihren formalen Strukturen (also den „Stilen“) nicht zu<br />
trennen.<br />
Obwohl in Österreich, abgesehen von Tourismuszonen in den Alpen, der<br />
Begriff der Region kein aktuelles (modernes) Thema war, ist in der architektonischen<br />
Entwicklung nach 1945 eine merkwürdig vitale Regionalisierung<br />
festzustellen. Ein Impuls lag sicher in den vier Besatzungszonen von 1945-55,<br />
in denen die Besatzer – Amerikaner, Engländer, Franzosen und „Russen“<br />
(die Sowjetunion) – eine sehr unterschiedliche Kulturpolitik betrieben. Langzeitwirkung<br />
hat aber die politische Struktur Österreichs, wobei die Kulturpolitik<br />
Ländersache ist, sich also sehr unterschiedlich in den neun Bundesländern<br />
entwickelt. In vier Bundesländern gibt es Architekturhochschulen<br />
(Wien, Graz, Linz und Innsbruck), und inzwischen gibt es in allen Bundesländern<br />
sehr unterschiedlich strukturierte und benannte „Architekturhäuser“,<br />
die wesentlichen Anteil an der Erforschung, Aufarbeitung und permanenten<br />
Verbreitung von Architektur auf allen möglichen Ebenen haben. Allen Ländern<br />
gemeinsam ist, dass der Regionsbegriff ein offener, zeitzugewandter,<br />
nicht selbstdarstellerischer oder gar rückwärtsgewandter, formal inszenierter<br />
ist. Die regionalen Unterschiede entwickeln sich nicht entlang touristischer<br />
Selbstdarstellungsprogramme – so sehr dies der Tourismus beständig<br />
versucht –, sondern aufgrund der ökonomischen und kulturellen Ressourcen,<br />
unter den Bedingungen der Länder und vor allem aufgrund der personellen<br />
Aktivitäten in der Architektenschaft. Dazu gehört auch eine langsam anwachsende<br />
öffentliche Architekturrezeption (ständige Berichte in den<br />
Tageszeitungen, Ausstellungen, Besichtigung von Baustellen und sehenswerten<br />
Bauten, Atelierbesuche etc.), die in den verschiedenen Bundesländern,<br />
unseren „Regionen”, sehr unterschiedlich ausgebildet ist.<br />
115
Carl Fingerhuth<br />
Mein psychologisches Wörterbuch bezeichnet „Pubertät”<br />
als „eine Zeit der Selbstorientierung und Selbstfindung”.<br />
Sie sei verbunden mit einer „Entwicklung von Gefühlen und<br />
Intelligenz”. In der Pubertät werde nach „Zielen und Zwecken<br />
gefragt” und es komme zu einem „Nachdenken über die<br />
Sinnhaftigkeit traditioneller Rollen und Institutionen”. So<br />
scheint mir dieser Begriff hervorragend geeignet, unsere<br />
heutige Situation beim Umgang mit der ständigen Transformation<br />
der Stadt zu beschreiben. Wir erleben eine Zeit des<br />
Nachdenkens über sich verändernde Ziele der Gesellschaft<br />
und müssen neue Instrumente, Methoden und Verfahren<br />
für eine Betreuung dieser Transformation der Stadt finden.<br />
Ich möchte versuchen, dieses Nachdenken zu begünstigen.<br />
Dafür verwende ich „Zeugen”, die von Wahrnehmungen<br />
berichten, die mit meinen Vermutungen übereinstimmen.<br />
Zeuge Nr. 1: der französische Philosoph François Jullien in<br />
seinem im <strong>Jahre</strong> 2002 erschienenem Buch „Der Umweg<br />
über China – Ein Ortswechsel des Denkens”<br />
„Das Denken den Ort wechseln lassen, um andere Arten<br />
von Intelligibilität zu berücksichtigen, um durch einen<br />
Umkehreffekt die Ausgangsbedingungen der europäischen<br />
Vernunft zu hinterfragen”: So beschreibt der französische<br />
Philosoph François Jullien den Sinn seiner zwölfjährigen<br />
Studienzeit in China und Japan. In meinem Buch „Learning<br />
from China” habe ich einen ähnlichen Ansatz gewählt. Ich<br />
habe versucht, mithilfe des Taoismus einen „Ortswechsel<br />
des Denkens” zu vollziehen, um Hinweise für das Betreuen<br />
der Transformation unserer westlichen Stadt zu suchen.<br />
Ich will hier noch einen weiteren Versuch wagen, um den<br />
Diskurs über den Umgang mit der Stadt jenseits der Moderne<br />
zu fördern; wieder mit einem Ortswechsel, dieses Mal aber<br />
nicht in eine fremde Kultur, sondern mit einem Ortwechsel<br />
in Erfahrungsbereiche, die zwar direkt nichts mit der Stadt<br />
zu tun haben, aber mit den gleichen kulturellen Themen<br />
wie die Stadt konfrontiert sind – um auf diese Weise andere<br />
„Arten von Intelligibilität” zu aktivieren. Daraus ergeben sich<br />
Vermutungen für ein erfolgreicheres Betreuen der Stadt jenseits<br />
der Moderne; ich spreche ganz bewusst nicht von<br />
„planen”, sondern von „betreuen”.<br />
116<br />
Von der Pubertät der Stadt<br />
jenseits der Moderne<br />
Und ich rede bewusst provokativ von der Stadt „jenseits der Moderne”,<br />
weil ich überzeugt bin, dass gerade für den Diskurs über die Stadt die klassische<br />
Moderne zu einer schwierigen Altlast geworden ist. Die sogenannte<br />
„Europäische Stadt” gibt es als Residuum, als alte Schicht im geologischen<br />
Aufbau der Stadt. Diese Schicht muss mit Sorgfalt und Respekt behandelt<br />
werden, ohne Zweifel. Sie ist aber im ständigen Prozess der Transformation,<br />
im ständigen Wandel der Stadt heute nur noch beschränkt tragfähig. Und<br />
ihr Hauptproblem besteht darin, dass sie aggressiven Widerstand leistet gegen<br />
Bemühungen, das Denken den Ort wechseln zu lassen, andere Arten von<br />
Intelligibilität zu berücksichtigen, um durch den von Jullien skizzierten Umkehreffekt<br />
„die Ausgangsbedingungen der europäischen Stadt zu hinterfragen.”<br />
Seit zwei <strong>Jahre</strong>n werde ich zu den Sitzungen des Kölner Gestaltungsbeirats<br />
eingeladen. Ein Haupttraktandum ist immer wieder das neue Stück Stadt,<br />
das am rechten Ufer des Rheins gegenüber dem Dom im Entstehen begriffen<br />
ist. Der Ort wäre eine phantastische Chance, eine neue gemeinsame<br />
„Intelligibillität” zu entwickeln, zumindest zu erproben. Es scheint sich<br />
jedoch vorläufig nicht mehr als eine chaotische Addition autistischer Stadtbausteine<br />
auszubilden. Der Gestaltungsbeirat hatte empfohlen, möglichst<br />
rasch zumindest ein Konzept für den öffentlichen Raum des neuen Stückes<br />
Stadt zu suchen. Der Wettbewerb für die Neugestaltung des Außenraumes<br />
um den Deutzer Bahnhof soll jetzt weiterhelfen. Wenn sich dann aber zeigen<br />
sollte, dass die Messe sich eigentlich nicht für die Qualität des Zugangs zu<br />
ihrem Haupteingang interessiert und dass nach dem Bau des Hochhauses<br />
von Helmut Jahn am Deutzer Bahnhof für die zentrale Fußgängerachse<br />
Dom – Rathaus an dieser Stelle nur noch einige wenige Meter übrig bleiben,<br />
dann werden die Beschwörungen der „Europäischen Stadt” zum reinen<br />
Schlangenzauber.
Zeuge Nummer 2: der polnische Philosoph Jean Gebser in<br />
seinem 1973 erstmals publizierten Buch „Ursprung und<br />
Gegenwart”<br />
Jean Gebsers Thema ist – zusammen mit Teilhard de Chardin<br />
und Ken Wilber – die Evolution des menschlichen Bewusstseins.<br />
Er beschreibt in einer faszinierenden Berichterstattung,<br />
wie der Mensch in kontinuierlichen Schritten das<br />
Potenzial seines Bewusstseins erweitert hat. Wie dies auch<br />
in der aktuellen Wissenschaftstheorie – im Speziellen durch<br />
Thomas S. Kuhn in „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen”<br />
– gezeigt wird, erfolgt dies nicht in vielen kleinen<br />
Schritten, sondern in periodischen intensiven Transformationssprüngen,<br />
die Kuhn mit „Paradigmenwechsel” bezeichnet<br />
hat. Jean Gebser identifiziert vom Ursprung bis zur Gegenwart<br />
vier grose Paradigmen: die Archaische, die Magische,<br />
die Mytische und die Mentale Struktur. Die Mentale Struktur<br />
entspricht dem, was auch als „die Moderne” bezeichnet<br />
wird. Damit soll nicht die architektonische oder städtebauliche<br />
Moderne verstanden sein, sondern die Moderne als kulturelle<br />
Epoche. Sie beginnt für Europa vor 2500 <strong>Jahre</strong>n mit<br />
der klassischen griechischen Philosophie. Sie erhält immer<br />
wieder neue Impulse über verschiedene „Ortswechsel des<br />
Denkens” in den unterschiedlichsten Disziplinen wie der<br />
Kunst, der Wissenschaft, der Religion oder der Politik.<br />
Für mein Thema sind Jean Gebsers Texte vor allem dort<br />
interessant, wo er von der „Integralen Struktur” spricht. Er<br />
meint damit die sich jetzt in den vielfältigsten Formen manifestierende,<br />
neue Zeitepoche. Ich habe früher dafür den<br />
Begriff der Postmoderne verwendet. Er wurde jedoch im<br />
formalen Architekturdiskurs derart diskreditiert, dass er<br />
nahezu unbrauchbar geworden ist, obwohl er in der zeitgenössischen<br />
Philosophie einen festen Platz hat. Ich habe<br />
deshalb auf eine andere Bezeichnung gewechselt und<br />
schreibe von der Periode, respektive der Stadt „jenseits der<br />
Moderne”.<br />
Jean Gebser interpretiert die Phänomene unserer Zeit, ihre Interdependenzen,<br />
und zeigt ihre Bedeutung für die Zeit jenseits der Moderne. Er dokumentiert<br />
diesen Wandel in den verschiedensten Aspekten dieser neuen<br />
„Integralen Struktur”: Raum- und Zeitbezogenheit, Bewusstseinsgrad, Denkformen<br />
oder soziale Bezüge. Ich greife ein Thema heraus, das für unseren<br />
Umgang mit der Transformation der Stadt von wesentlicher Bedeutung ist.<br />
Es geht dabei um die Dimensionalität der Stadt im Bewusstsein der Menschen.<br />
Hier postulierte Gebser schon vor 50 <strong>Jahre</strong>n eine dramatische Evolution<br />
von einem dreidimensionalen in ein vierdimensionales Verständnis von<br />
Raum. Was mit Albert Einstein für die Physik jenseits der Moderne selbstverständlich<br />
geworden ist, nämlich dass sich der Raum mit der Integration der<br />
Zeit zu einem wesentlich komplexeren Phänomen erweitert, das hat auch<br />
ein radikal neues Verständnis der Stadt entstehen lassen.<br />
Im Übergang von der mythischen in die mentale (moderne) Epoche wurde<br />
aus der flachen Stadt die dreidimensionale Stadt. Sie wird zuerst in der Kunst,<br />
bei Giotto und Piero della Francesco, sichtbar. Mit der perspektivischen Darstellung<br />
des Raumes in der Malerei positioniert sich der Betrachter an einem<br />
Punkt des dreidimensionalen Raumes. Zu Beginn durften nur die Allmächtigen,<br />
die Herrscher und die Kirche, in den dreidimensionalen Raum eintreten;<br />
mit der Erfindung des Lifts und des Flugzeugs wurde die dritte Dimension<br />
gewissermaßen demokratisiert und für alle selbstverständlich.<br />
Bei der Recherche über diesen Aspekt der Moderne ist mir aufgefallen, dass<br />
praktisch alle Modelle und Visionen für die Neue Stadt der Moderne finale,<br />
dreidimensionale Vorstellungen sind: von der Zeichnung des himmlischen<br />
Jerusalems von Albrecht Dürer bis hin zu der Garden City von Ebenezer<br />
Howard, von der Vision Holleins und seinen „Stadtwolken” über Wien bis<br />
zu den Konstruktionen Buckminster Fullers. Die Dimension „Zeit” war für<br />
die Neue Stadt nicht relevant; sie war es aber auch nicht in Bezug auf die<br />
vorhandene Stadt: Diese konnte auf den Plänen ausgekratzt und in der Realität<br />
abgerissen werden.<br />
Das neue vierdimensionale Verständnis der Stadt zwingt zu neuen Visionen<br />
für die Stadt. Um sie wirksam werden zu lassen, müssen andere Instrumente,<br />
Verfahren, Methoden und Haltungen bei der Betreuung der Transformation<br />
der Stadt gefunden werden. An einem praktischen Beispiel: Die Hochtief<br />
Projektentwicklung GmbH veranstaltete einen Wettbewerb auf dem Areal<br />
der Commerzbank an der Komödienstraße in Köln. Hans Kollhoff hat den<br />
Wettbewerb nicht gewonnen, weil er klassizistische Elemente in seinen Entwurf<br />
integriert hat, sondern weil er die Geschichte und die spezielle Qualität<br />
des Ortes in Zeit und Raum ernst genommen hat. Alle anderen Teilnehmer<br />
hatten auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Dom ein großes<br />
Haus projektiert. Hans Kollhoff hat respektvoller und sorgfältiger hingeschaut<br />
und ein Ensemble von fünf Häusern vorgeschlagen, das der Morphologie<br />
dieses Ortes gerecht wird.<br />
117
Zeuge Nummer 3: der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung in seinem<br />
1928 erschienenem Buch „Psychologische Typologie”<br />
Carl Gustav Jung hat ein Leben lang über den Menschen nachgedacht und<br />
dabei immer wieder auf die Tiefe und Breite seiner Essenz aufmerksam<br />
gemacht. Immer wieder hat er auch vor der Reduktion des Menschen auf<br />
seine Rationalität gewarnt, die, wenn sie übermächtig wird, zum „Schädiger<br />
der Seele” werde. Das Denken, als eines der großen Potenziale des Menschen,<br />
darf die anderen Potenziale nicht ausgrenzen und diskrimieren. Dies<br />
ist die schwierige Seite der Moderne. Es ist auch die schwierige Seite der<br />
modernen Stadt. Die Moderne hat die Stadt demokratisiert, sie hat sich<br />
bemüht, sie zu einer sozialen Stadt zu machen, für ihre ökonomische Entwicklung<br />
günstige Voraussetzungen zu schaffen, die Mobilitätsbedürfnisse<br />
der Menschen zu befriedigen. In der radikalisierten Suche nach den letzten<br />
Grenzen des technisch Machbaren hat sie aber die Emotionalität, die Sinnlichkeit<br />
und die Spiritualität des Menschen nicht mehr ernst genommen.<br />
Nur zusammen geben diese Potenziale des Menschen „dem Ich eine Art von<br />
Grundorientierung im Chaos der Erscheinungen”, so Jung.<br />
Die Emotionalität, die Sinnlichkeit und die Spiritualität des Menschen wurden<br />
in der Moderne privatisiert und diskriminiert. Ihre Reintegration in unser<br />
kollektives Sein und damit auch in die Stadt ist aber mittlerweile zu einem<br />
wichtigen Motiv geworden. Dies zeigt sich bereits mit aller Kraft in anderen<br />
Bereichen unserer Kultur. Wir werden in den Medien – und in der Stadt –<br />
mit einer Flut von sinnlichen und emotionalen, aber zumeist groben Bildern<br />
überschwemmt. Unsere Aufgabe als Gestalter ist es, ihre Energie zu sublimieren.<br />
Die Transformation von Energie auf eine höhere Ebene ist die Essenz<br />
jeder kulturellen Anstrengung. So wie sich sexuelle Lust in Erotik und nicht<br />
in Pornographie darstellen soll, muss aus der banalen und auf Rationalität<br />
reduzierten Stadt wieder eine erotische und komplexe Stadt entstehen.<br />
Sonst wird sie nicht zur Stadt der Menschen unserer Zeit. Diese „Transformation<br />
auf eine höhere Ebene” ist ein Akt der Verfeinerung und Sublimation.<br />
Dazu braucht es im architektonischen Entwurf Sensibilität und Innovation –<br />
Qualitäten, wie sie in Köln zum Beispiel in Bauten von Heinz Bienefeld,<br />
Gottfried Böhm, Arno Brandlhuber, Bernd Kniess oder Peter Zumthor zu finden<br />
sind.<br />
Zeuge Nummer 4: der amerikanische Philosoph Ken Wilber in seinem 1979<br />
erschienenem Buch „Wege zum Selbst”, auf Englisch „No Boundary”<br />
Ken Wilber ist einer der ganz großen Universalgelehrten unserer Zeit. Er versucht<br />
seit vielen <strong>Jahre</strong>n und in vielen Publikationen, die Ansätze von Gebser<br />
und Jung zu vertiefen und sie mit östlichen Weisheitslehren zu verknüpfen.<br />
Er macht immer wieder auf die großen Spaltungen im Bewusstsein des<br />
modernen Menschen aufmerksam: zwischen Körper und Seele, zwischen<br />
Mensch und Erde. Ich bin überzeugt, dass die Reintegration der Spiritualität<br />
des Menschen eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit jenseits der Moderne<br />
geworden ist. Es geht um die wieder deutlicher werdene Ahnung von<br />
der Einheit von Körper, Seele und Geist. Weil die gebaute Stadt letztlich die<br />
Transformation gesellschaftlicher Bedürfnisse, Ziele und Träume ist, müssen<br />
auch Emotionalität, Sinnlichkeit und Spiritualität in die Gestalt der Stadt eingebracht<br />
werden.<br />
118<br />
Dies geschieht gegenwärtig auf eine sehr intensive, spezielle<br />
Art und Weise beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit.<br />
Der Diskurs ist aber in erster Linie von Wissenschaftlichkeit<br />
und Verrechtlichung geprägt. Der zentrale Aspekt, nämlich<br />
die Spaltung von gebauter Stadt und Natur – entsprechend<br />
der Spaltung von Körper und Geist, wird in Raumplanung,<br />
Städtebau und Architektur außerordentlich zögerlich angegangen.<br />
Häufig werden ja die Prinzipien der „Europäischen<br />
Stadt” angeführt, wenn etwa in städtebaulichen Konzepten<br />
berühmter Kollegen scharf gezogene Linien die „graue” von<br />
der „grünen” Stadt trennen, wenn im Wohnungsbau aus<br />
ästhetischen Motiven auf private Außenräume verzichtet<br />
werden soll oder mit Bebauungsdichten gearbeitet wird,<br />
die der Natur keinen Raum mehr lassen. So verstanden, ist<br />
die „Europäische Stadt” eine schwierige Altlast im Prozess<br />
zur Überwindung dieser modernen Spaltung von Stadt und<br />
Natur.<br />
Bei der Suche nach städtebaulichen Konzepten für die Voroder<br />
die Zwischenstadt, also dort, wo bis heute nur addiert<br />
und nicht strukturiert worden ist, taucht dieses Verhältnis<br />
von Stadt und Natur jedoch immer häufiger als bestimmendes<br />
Thema auf. Die Entwurfswerkstatt für die Umwandlung<br />
des Areals der Reitzenstein-Kaserne in Düsseldorf war für<br />
mich ein faszinierendes Beispiel für die Suche nach einer zeitgemäßen<br />
Vorstadt-Vision „jenseits der Moderne”. Der 1. Preis<br />
und die Empfehlung zur Weiterbearbeitung ging an das<br />
Stuttgarter Büro Auer und Weber. In ihrem städtebaulichen<br />
Konzept war der Freiraum das bestimmende strukturelle<br />
Element und die vorgesehene Wohnüberbauung wurde wie<br />
ein neues Stück Stadt behandelt. Dahinter steht jener „Ortswechsel<br />
des Denkens”, mit dem die Dogmen der „Europäischen<br />
Stadt” hinterfragt werden: Wie kann eine Neue Vor-<br />
Stadt aussehen, die sich nicht der alten Entgegensetzung<br />
von gebauter Stadt und unbebautem Freiraum bedient?
Zeuge Nummer 5: Laotse in seinem wahrscheinlich im<br />
sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verfassten<br />
Text „Tao Te King”<br />
In Vers 60 des „Tao Te King” schreibt Laotse: „Eine grosse<br />
Stadt zu regieren ist wie das Braten von kleinen Fischen.”<br />
In der taoistischen Praxis heisst das: Handeln mit hoher<br />
Achtsamkeit. Damit ist für mich in ganz wenigen Worten<br />
gesagt, was die Essenz des Städtebaus ist: Aufmerksamkeit<br />
in Bezug auf die Bedürfnisse der Menschen, aber auch in<br />
Bezug auf die Qualitäten des Ortes. Wir können und müssen<br />
die Stadt nicht neu erfinden. Wir können und müssen uns<br />
aber darum kümmern, dass sie nicht dumpf und banal oder<br />
agressiv und autistisch wird. Dazu brauchen wir Innovation<br />
und Kreativität, verknüpft mit Methoden, Verfahren und<br />
Instrumenten, die für diese Haltung günstige Voraussetzungen<br />
schaffen. Das sind Methoden und Verfahren, die von einem<br />
Dialog zwischen verschiedenen Partnern bestimmt sind. Das<br />
sind Instrumente, die Produkte eines Dialoges sind, die so<br />
weit als möglich offen bleiben und nicht primär verrechtlichen,<br />
sondern Visionen konsolidieren. Ich erwähne als Beispiel<br />
ein Verfahren in Gummersbach für das ehemalige Produktionsgelände<br />
der Kesselbauschmiede Steinmüller, das<br />
im Rahmen der Regionale 2010 zum Wettbewerb „Stadt<br />
macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze” durchgeführt wurde.<br />
Mit der Umstrukturierung des Geländes verfolgt die Stadt<br />
Gummersbach das Ziel, hier einen neuen, unverwechselbaren<br />
Entwicklungsschwerpunkt zu etablieren. Der Wettbewerb<br />
war Bestandteil eines intensiven öffentlichen Prozesses,<br />
in dem die Öffentlichkeit immer wieder beteiligt und<br />
ernst genommen wurde.<br />
Ich habe im Titel unsere Situation als „pubertär” bezeichnet.<br />
Damit will ich darauf hinweisen, das wir mit radikal Neuem<br />
konfrontiert werden; Neues, das komplexer und anspruchsvoller<br />
zu sein scheint, dass aber auch auf tiefgreifende Transformation<br />
hinweist. Um die Angst und Unsicherheit über die<br />
Veränderung in Vertrauen und Mut zu Neuem zu verwandeln,<br />
braucht es in erster Linie einen intensiven Dialog zwischen<br />
den Partnern. Gestaltungsbeiräte, konkurrierende<br />
Verfahren mit klugen Preisgerichten, Auszeichnung guter<br />
Bauten, Zusammenarbeit mit den Medien sind wichtige Träger<br />
eines solchen Dialogs. Der Dialog kann aber nur entstehen,<br />
wenn zwischen den Partnern ein gegenseitiges Vertrauen<br />
existiert. Da haben sich in der Vergangenheit häufig tiefe<br />
Gräben aufgetan, die es gilt wieder zuzuschütten. Wenn<br />
zum Beispiel in einem Jahrbuch des BDA die Rede davon<br />
ist, „dass es unerlässlich sei, das Heft wieder in die Hand zu<br />
nehmen”, weil die Politik unfähig sei, die gegenwärtige<br />
Situation zu bewältigen, dann zeugt das für mich – zurückhaltend<br />
formuliert – von einem sehr überholten Verständnis<br />
der Aufgabe und Rolle des Architekten.<br />
Und schließlich die Zeugen Nummer 6 und 7: Kaiser Fuchi in seinem vor<br />
fünftausend <strong>Jahre</strong>n verfasstem „Buch der Wandlungen”, auch „I Ging”<br />
genannt, und Rem Koolhaas in seinem 1995 erschienenen Buch „S,M,L,XL”<br />
Das Hexagramm 10 Kien/Dui handelt vom Verhalten und gibt folgendes<br />
Urteil: „Auftreten auf des Tigers Schwanz. Er beisst den Menschen.”<br />
In einer neuen Übersetzung des „I Ging“ wird dieses Hexagramm folgendermaßen<br />
kommentiert: „Kosmisch verstanden bedeutet ‚einfaches Auftreten’,<br />
auf Situationen zu antworten anstatt ihr Urheber zu sein.”<br />
Oder in der Sprache von Rem Koolhaas: „Und wenn wir nun ganz einfach<br />
erklärten, die Krise existiere nicht, und unser Verhältnis zur Stadt neu definierten,<br />
um viel mehr ihre Unterstützer und einfache Subjekte als ihre<br />
Schöpfer zu sein?”<br />
Literatur<br />
Jullien, F.: Der Umweg über China. Berlin 2002<br />
Gebser, J.: Ursprung und Gegenwart. München 1988<br />
Jung, C.G.: Psychologische Typologie. Bd. 3 Typologie<br />
der elfbändigen Jung-Kassette. München 2001<br />
Wilber, K.: Wege zum Selbst. München 1986<br />
Laotse: Tao Te King. München 1996<br />
Anthony, C. K., Moog, H.: Buch der Wandlungen. I Ging. 2004<br />
Koolhaas, R.: S,M,L,XL. Rotterdam 1995<br />
119
Frauke Burgdorff<br />
In zahlreichen Veranstaltungen der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> haben wir<br />
erfahren, dass die Suche nach urbaner Identität und nach den eingeschriebenen<br />
baulichen Traditionen Konjunktur hat. Sie wird flankiert von einer<br />
Diskussion, in der der so genannte traditionalistische Städtebau dem zeitgenössischen<br />
gegenübergestellt wird. Diese Auseinandersetzung ist wenig<br />
produktiv, wenn wir uns bewusst machen, dass in den kommenden <strong>Jahre</strong>n<br />
vor allem der Umbau und die Pflege unserer Städte anstehen.<br />
Diese Auseinandersetzung ist aber ebenfalls wenig hilfreich, wenn wir die<br />
zahlreichen gestalterischen und städtebaulichen Traditionen betrachten,<br />
die Bestandteil der baukulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen sind.<br />
Es gibt keine eine, eindeutige Tradition auf die wir uns berufen können; es<br />
existiert keine Epoche, die als allein gültiger Maßstab gelungenen Städtebaus<br />
für die Gegenwart gelten kann.<br />
Dies wurde in Nordrhein-Westfalen früher als in anderen Regionen Deutschlands<br />
erkannt. Die historischen Parks des Niederrheins und des Rheinlandes<br />
stehen mittlerweile genauso für baukulturelle Tradition wie das Ständehaus<br />
in Düsseldorf, das Musiktheater in Gelsenkirchen, die Essener Margarethenhöhe<br />
oder die Altstadt Lemgos. Die reiche denkmalpflegerische Landschaft<br />
geht einher mit der inhaltlichen Vorreiterschaft im Feld der Industriedenkmalpflege.<br />
Gerade die Internationale Bauausstellung Emscher Park hat<br />
gezeigt, dass die behutsame Weiterentwicklung der baulichen Substanz ein<br />
wesentlicher Bestandteil der Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier<br />
und ihrer Stadt ist, dass diese aber durchaus durch zeitgenössische architektonische<br />
Formen ergänzt werden kann. Denn Städte und Quartiere, die keinen<br />
Anschluss an eine wie auch immer begründete urbane Tradition finden<br />
und die Form und das Bild der Stadt nicht respektvoll weiter entwickeln,<br />
werden ganz objektiv im Standortwettbewerb nicht erfolgreich sein.<br />
120<br />
Traditionen (er)finden<br />
Welche Maßstäbe – bewahrende oder entwickelnde, erhaltende<br />
oder pflegende – man an die Gestaltung unserer baulichen<br />
Vergangenheit anlegt, muss bei jedem Bauvorhaben<br />
im Bestand neu diskutiert werden. Diese Diskussion hat die<br />
Initiative <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> von Anfang an geführt. Dass<br />
Nordrhein-Westfalen eher vor einer diskursiven als vor einer<br />
juristischen denkmalpflegerischen Herausforderung steht,<br />
hat bereits im Jahr 2002 der Abschlussbericht der Denkmalkommission<br />
Nordrhein-Westfalen gezeigt. Die hier festgelegten<br />
Grundsätze regen eine Diskussion an und erweitern<br />
das Denkmalschutzgesetz des Landes.<br />
An dieser Stelle setzt das Kölner Projekt „Liebe deine Stadt“<br />
an. Auf private Initiative wurde gemeinsam mit vielen Partnern<br />
in der Stadt aufgezeigt, welche Bedeutung die Architekturen<br />
und Parks der 1950er <strong>Jahre</strong> in der Rheinmetropole<br />
haben und welche identifikatorische Kraft auch diese „jungen<br />
Denkmäler“ bereits heute für die Bürger der Stadt entwickeln.<br />
Eines der Lehrbeispiele für die andauernde Auseinandersetzung<br />
um Tradition und Zukunft ist das Weltkulturerbe Zollverein.<br />
Dieses Projekt wird von der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> als außergewöhnliches Laboratorium der Baukultur<br />
zwischen industriellen Traditionen und zukunftsweisenden<br />
Architekturen beobachtet und begleitet. Die Strategien und<br />
Wege, die auf Zollverein beschritten werden, um das Neue<br />
aus dem Alten zu entwickeln, werden international diskutiert<br />
und sind ein zentraler Beitrag zur Präsentation der<br />
außergewöhnlichen Baukulturlandschaft Nordrhein-Westfalens<br />
in der Welt.
In die praktische Präsentation des Zusammenwirkens von<br />
Vergangenheit und Gegenwart eingestiegen sind die<br />
„Straßen der Gartenkunst“. Die Dokumentation dieses landesweiten,<br />
dynamischen Prozesses zur Pflege, Entwicklung<br />
und Entdeckung der Gartenlandschaft in der „Blauen Reihe<br />
<strong>StadtBauKultur</strong>“ ist zu einer der am meisten nachgefragten<br />
Broschüren der Initiative geworden. Die Auseinandersetzung<br />
mit dem zunächst traditionell erscheinenden Thema<br />
und die Einbindung zeitgenössischer Gartenlandschaften in<br />
die vorhandenen Denkmäler zeigen exemplarisch, wie produktiv<br />
die Beschäftigung mit der jeweilig spezifischen Vergangenheit<br />
sein kann.<br />
Ebenfalls für die Verbindung von Tradition und Erneuerung<br />
steht die Arbeit der zahlreichen Beiräte für Stadtgestaltung<br />
in Nordrhein-Westfalen. Die lokalen Gremien, die sich im<br />
Rahmen bürgerschaftlichen Engagements immer wieder<br />
kompetent und hartnäckig in die lokalen baukulturellen<br />
Geschicke einmischen, sind eine wichtige Basis für die<br />
Anschlussfähigkeit des Neuen an die Substanz und für die<br />
Vermittlung neuer Entwicklungen in die Bevölkerung. Die<br />
Dokumentation dieser Arbeit in der „Blauen Reihe StadtBau-<br />
Kultur“ dient neuen Initiativen als Leitfaden und Entwicklungsgrundlage<br />
für eigene Aktivitäten.<br />
Und schließlich haben insgesamt zehn Partner der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> gemeinsam eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die diese und weitere<br />
Themen der Denkmalpflege und der Entwicklung von Baukultur im Bestand<br />
aufgegriffen hat. In insgesamt sieben Städten wurde mit sieben europäischen<br />
Partnern darüber diskutiert, welche Bedeutung unterschiedliche<br />
Aspekte baukultureller Traditionen (vom Ingenieurbauwerk bis zum Ensemble)<br />
jeweils haben und welche Unterschiede im strategischen Umgang mit<br />
dieser lebendigen Tradition in den europäischen Nachbarländern zu finden<br />
sind.<br />
121
Eberhard Grunsky<br />
Im März 2000 fand im Bundestag eine Anhörung zum Thema Denkmalschutz<br />
statt. Im Mittelpunkt stand dabei ein Gutachten, das die Fraktion Bündnis 90/<br />
Die Grünen auf Initiative von Antje Vollmer bei Dieter Hoffmann-Axthelm<br />
in Auftrag gegeben hatte. Hoffmann-Axthelm forderte in seinem Gutachten<br />
„Entstaatlichung der Denkmalpflege? Eine Streitschrift“ eine Neuordnung<br />
der Denkmalpflege, die vor allem Folge einer radikalen Revision der Aufgaben<br />
sein müsse. Nicht mehr historische Substanz als Geschichtszeugnis,<br />
sondern „Schönheit als Denkmalkern“ habe im Zentrum zu stehen.<br />
Die alte Hierarchie der Baugattungen mit Kirchen und Schlössern an der<br />
Spitze müsse bei der Denkmälerauswahl wieder zur Geltung kommen, Bauwerke<br />
aus dem späten 19. und dem 20. Jahrhundert, insbesondere Industriebauten,<br />
seien aus einer zivilgesellschaftlich getragenen Denkmalpflege<br />
auszuschließen, weil sie nur bei wenigen Spezialisten Interesse fänden.<br />
Die Nähe zu anderen, an den Gesetzen des Marktes orientierten Forderungen<br />
nach einer Modernisierung der Denkmalpflege ist offensichtlich. Der Wunsch,<br />
die Denkmalpflege den Mechanismen von Angebot und Nachfrage anzupassen,<br />
hat das Konzept einer bildorientierten Denkmalpflege entstehen<br />
lassen; sie soll – im Unterschied zur international gültigen, substanzorientierten<br />
– möglich machen, auf aktuelle Bedürfnisse der Gesellschaft mit<br />
ganz neuer Flexibilität zu reagieren, gerade auch auf das Bedürfnis nach<br />
einem perfekt „historischen“ Erscheinungsbild, das jederzeit hergestellt und<br />
immer wieder verbessert werden könne.<br />
Während in anderen Bundesländern die Streitschrift kaum offizielle Reaktionen<br />
auslöste, nahm in Nordrhein-Westfalen Michael Vesper als einziger<br />
„grüner Denkmalminister“ die Initiative auf. Er lud zu einem „Denkmal-<br />
Forum“ nach Düsseldorf, um mit Antje Vollmer, Dieter Hoffmann-Axthelm<br />
und renommierten Fachleuten nach Perspektiven für den Denkmalschutz im<br />
21. Jahrhundert zu fragen. In seiner damaligen Rede betonte er: „Wir müssen<br />
die Fenster und Türen aufmachen, um uns dem Wind, manchmal nur<br />
der heißen Luft, aber eben auch dem eisigen Sturm von Modernisierung,<br />
Beschleunigung, Globalisierung, Kommerzialisierung und Internationalisierung<br />
stellen zu können.“<br />
Als Ergebnis dieser Veranstaltung wurde eine aus 20 Mitgliedern bestehende,<br />
international besetzte Kommission aus Denkmalpflegern, Stadtplanern<br />
und Architekten, Museumsexperten, Juristen, Ökologen, Kommunalpolitikern<br />
und Vertretern der Wirtschaft berufen, um Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
in Nordrhein-Westfalen unter die Lupe zu nehmen und ein Konzept<br />
für die Zukunft des Aufgabenfeldes zu entwickeln. Die Kommission hat<br />
122<br />
Denkmalkommission
jeweils unter der Leitung des Ministers, erstmals im Mai<br />
2001, getagt. Ihren Abschlussbericht hat sie 2002 verabschiedet;<br />
das Europäische Haus der Stadtkultur hat ihn anschließend<br />
in seiner „Blauen Reihe“ veröffentlicht.<br />
Die Kommission hat nach eingehender Erörterung beschlossen,<br />
keine Änderung des Denkmalschutzgesetzes aus dem<br />
<strong>Jahre</strong> 1980 anzuregen. Im Hinblick auf die laufende Debatte,<br />
den bestehenden Begriff des Denkmals als geschichtlich<br />
zeugnishaftes Objekt zugunsten der „Schönheit als Denkmalkern“<br />
aufzugeben, hat die Kommission ohne Wenn und<br />
Aber für den bestehenden Denkmalbegriff votiert, der sich<br />
in den letzten 150 <strong>Jahre</strong>n als Antwort auf den sprunghaften<br />
Wandel unseres kulturellen Umfeldes herausgebildet und<br />
gefestigt hat. Auch eine Unterscheidung in Denkmäler<br />
erster, zweiter oder dritter Klasse hat die Kommission deshalb<br />
eindeutig abgelehnt. Der bestehende Denkmalbegriff<br />
hat den Vorzug, dass sich Denkmäler im nachdenklichen<br />
Umgang mit ihnen als „soziales Gedächtnis“ erschließen,<br />
als unerschöpfliches Reservoir an Einsichten und Erfahrungen<br />
aus der Vergangenheit. Wenn Denkmäler in diesem Sinne<br />
als Belege dafür gesehen werden, was Menschen möglich<br />
war, sind sie auch immer neu befragbare Bezugspunkte<br />
für die Zukunft, also wesentliche Faktoren von Baukultur.<br />
Mit Blick auf die konkrete denkmalpflegerische Praxis ist von der Kommission<br />
und den dort zusammengeführten Fachdisziplinen unterstrichen worden,<br />
dass sich Probleme im Alltag der Denkmalpflege oftmals durch eine Isolierung<br />
denkmalpflegerischer Aufgaben von ihrem jeweiligen gesellschaftlichen<br />
und planerischen Kontext ergeben. Deshalb sollten bestehende, mehr<br />
oder weniger enge Verbindungen der Denkmalpflege zur Stadtplanung, zur<br />
neuen Architektur, zum Umweltschutz, zur Wirtschaftsförderung usw. gefestigt,<br />
ausgebaut und besser nutzbar gemacht werden. Daraus könnte<br />
sich, so heißt es im Bericht, eine Debatte über Baukultur im Allgemeinen,<br />
eine neue kollektive Verantwortung für Planen und Bauen im Besonderen<br />
entwickeln, bei der die Denkmäler aus ihrer passiven Sonderrolle herausfinden.<br />
Als verbindende Klammer für die unterschiedlichen Aufgaben und<br />
Interessen hat die Kommission das Leitziel der Nachhaltigkeit herausgestellt.<br />
Dies könnte eine Perspektive eröffnen, die weit über die aktuelle Praxis hinausreicht.<br />
Das Gleiche gilt für die im Bericht enthaltenen Empfehlungen zum „Denkmalmanagement“.<br />
Weil die knappe Personaldecke von Fachämtern und<br />
Denkmalbehörden kontinuierliche Baustellenüberwachungen als Instrument<br />
der Qualitätssicherung weitgehend ausschließt, empfiehlt die Kommission,<br />
Architekten, Ingenieuren, Handwerkern, Restauratoren usw. die Möglichkeit<br />
zu geben, durch spezielle Qualifikationen künftig eigenverantwortlicher<br />
arbeiten zu können und zu dürfen. Damit soll die herkömmliche, in der täglichen<br />
Praxis immer noch virulente Vorstellung überwunden werden, dass<br />
staatliche Denkmalpfleger vorgeben, was am Denkmal wie zu machen ist,<br />
und dass die „Baustellenakteure“ anschließend für die penible Umsetzung<br />
dieser Vorgaben zu sorgen haben. Für die Modernisierung der Denkmalpflege<br />
wäre es ein epochaler Fortschritt, wenn es gelänge, in der Praxis zwischen<br />
den gutachterlichen und beratenden Aufgaben der Fachämter, der<br />
Funktion der Denkmalbehörden als Genehmigungsinstanz und den speziellen<br />
Fachkompetenzen von Architekten, Ingenieuren, Handwerkern und<br />
Restauratoren präzise Trennlinien zu ziehen – damit könnte die konkrete<br />
Utopie einer gleichberechtigten und eigenverantwortlichen Arbeit aller<br />
Beteiligten bei jedem Denkmalvorhaben ein großes Stück näher rücken.<br />
Die Denkmalkommission hat in ihrem Bericht bewusst darauf verzichtet,<br />
einen Paradigmenwechsel in der Denkmalpflege zu verkünden oder zu fordern.<br />
Sie hat stattdessen, aufbauend auf den international anerkannten<br />
Grundlagen des Denkmalschutzes, weitreichende Entwicklungspotenziale für<br />
die Modernisierung der denkmalpflegerischen Praxis skizziert. Es liegt nun an<br />
den Beteiligten, diese Potenziale im Interesse einer lebendigen Baukultur<br />
auszuschöpfen.<br />
123
Udo Mainzer<br />
Im Rahmen der <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> spielt neben innovativer<br />
und kreativer Architektur sowie der Qualitätssteigerung des öffentlichen<br />
Raums namentlich die Weiterentwicklung des baukulturellen Erbes eine<br />
entscheidende Rolle. Dabei geht es vor allem um den Umgang mit dem vorhandenen<br />
Bestand im Allgemeinen und der sinnvollen Nutzung und Umnutzung<br />
von Baudenkmälern im Besonderen. Die Gründe für eine solche<br />
Schwerpunktbildung innerhalb der <strong>Landesinitiative</strong> liegen auf der Hand. Da<br />
Denkmäler fester Bestandteil jeglicher gebauter Kultur sind, kann nur deren<br />
angemessene Berücksichtigung innerhalb von Stadtentwicklungsprozessen<br />
Gewähr bieten für eine neue Kultur im architektonischen wie städtebaulichen<br />
Schaffen. Überdies sind Denkmäler offensichtlich im allgemeinen Bewusstsein<br />
am stärksten als Leistungen der Baukultur verankert.<br />
Um diesem besonderen Anliegen, der Verankerung des historischen Bestandes<br />
in zukunftsfähigen Aktivitäten von Baukultur, den erhofften Erfolg<br />
zu sichern, erschien es sinnvoll, die vor Ort verantwortlichen Entscheider in<br />
Politik und Administration für das Thema zu sensibilisieren. Diesem Ziel<br />
diente die in sieben Städten in allen Regionen des Landes durchgeführte<br />
Veranstaltungsreihe „DenkMalStadt!“, ein gemeinsames Projekt des Ministeriums<br />
für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport <strong>NRW</strong> (jetzt Ministerium<br />
für Bauen und Verkehr), des Europäischen Hauses der Stadtkultur, der Landschaftsverbände<br />
Rheinland und Westfalen-Lippe, der Architektenkammer<br />
NW, der Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong>, des Städtetages <strong>NRW</strong> und des Städte-<br />
und Gemeindebundes <strong>NRW</strong>. Projektträger war der Landschaftsverband<br />
Rheinland, der den Anstoß zu diesem Vorhaben gab.<br />
Die Adressaten der Veranstaltung waren vorrangig Ratsmitglieder anderer<br />
kommunaler Gebietskörperschaften, Bau- und Planungsdezernenten, aber<br />
auch bürgerschaftliche Initiativen und Verbände, Architekten, Ingenieure,<br />
Stadt- und Landschaftsplaner. Die Einladungen an diese Zielgruppen wurden<br />
ergänzt durch eine überregionale Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Themen<br />
und Anliegen der einzelnen Veranstaltungen auch einem breiteren<br />
Publikum nahegelegt wurden. Es sollte ein intensiver gesellschaftlicher Dialog<br />
über das Verhältnis von Denkmalpflege und Stadtentwicklung iniitiert<br />
werden, ein Dialog, der durch die Einbeziehung von Erfahrungen aus Nachbarländern<br />
auch zu einem europäischen Dialog wurde.<br />
124<br />
DenkMalStadt!<br />
Ein europäischer Dialog über Denkmalpflege<br />
und Stadtentwicklung<br />
Seit März 2005 fanden sieben Veranstaltungen in sieben<br />
verschiedenen Städten <strong>NRW</strong>s statt, die sich im Rahmen des<br />
Gesamtprogramms jeweils einem für den Veranstaltungsort<br />
charakteristischen Aspekt von Denkmalpflege und Stadtentwicklung<br />
widmeten. Verbunden mit dem Anspruch,<br />
einen europäischen Dialog führen zu wollen, war jeder der<br />
nordrhein-westfälischen Städte eine weitere deutsche oder<br />
europäische Komplementärstadt zugeordnet, um so einen<br />
breiten Erfahrungs- und Erkenntnisaustausch zu ermöglichen<br />
und Strategien, Erfolge und Misserfolge bei der Bewahrung<br />
und Weiterentwicklung des historischen Bauerbes, wie sie<br />
in anderen Regionen und Ländern gemacht werden, zu<br />
diskutieren und in <strong>NRW</strong> nutzbar zu machen. Die sieben<br />
Tandems waren Krefeld/Graz, Lemgo/Stendhal, Wuppertal/<br />
Hamburg, Münster/Krakau, Siegen/Leeds, Gelsenkirchen/<br />
Cottbus sowie Aachen/Maastricht.<br />
In den Veranstaltungen wurden sehr unterschiedliche, aber<br />
allesamt wichtige Aspekte der Wechselbeziehung von städtebaulicher<br />
Denkmalpflege und künftiger Stadtentwicklung<br />
diskutiert. In Krefeld wurde die Bedeutung von historischen<br />
Gärten und Parks für die Entwicklung der Städte thematisiert,<br />
die Veranstaltungen in Lemgo und Münster befassten<br />
sich mit der Integration neuer Architektur und neuer räumlicher<br />
Maßstäbe in das Stadtbild und den Stadtgrundriss<br />
historischer Städte, in Wuppertal wurde die Rolle von historischen<br />
Ingenieur- und Verkehrsbauwerken diskutiert. Wie<br />
Umnutzung vorhandener Substanz zum Impuls für die weitere<br />
Stadtentwicklung werden kann und wie sich generell<br />
das Verhältnis von Stadtumbau und Denkmalpflege darstellt,<br />
das waren die bestimmenden Themen der beiden Veranstaltungen<br />
in Siegen und Gelsenkirchen. Der letzte der<br />
sieben Vortrags- und Diskussionsabende fand schließlich in<br />
Aachen statt: In Aachen schließlich stand das für die Zukunft<br />
der Stadt so wichtige Wohnen in historischen Städten im<br />
Vordergrund.
DenkMalStadt!<br />
Ein europäischer Dialog über Denkmalpflege und Stadtentwicklung<br />
Die Veranstaltungsreihe hat deutlich gemacht, wie sehr trotz<br />
der zunehmenden ökonomischen und kulturellen Globalisierung<br />
das architektonische und städtebauliche Erscheinungsbild<br />
unseren Städten und Regionen nach wie vor Identität<br />
und Unverwechselbarkeit zu sichern vermag. Denkmäler<br />
sind dabei ein wichtiges Ferment für die Stadtentwicklung<br />
und zugleich ein essenzieller Wirtschafts- und Standortfaktor;<br />
Denkmalpflege ist deshalb auch Zukunftssicherung und<br />
Daseinsvorsorge. Namentlich vor dem Hintergrund der Globalisierung<br />
gewinnen die historisch gewachsenen Regionen<br />
zunehmend an Bedeutung. Deren Besonderheiten wurzeln<br />
in ihrer Kultur und Tradition. Diese beiden Elemente, die<br />
den Menschen eine lebenswichtige Orientierung geben<br />
können, erfordern, dass neben der Bewahrung geschichtlicher<br />
Baukultur auch das zeitgenössische Bauen gebotene<br />
Rücksicht nehmen muss auf das, was die kulturelle Tradition<br />
regionaler Architektur ausmacht. Ein Aufbegehren gegen<br />
eine internationale Egalisierung in der Architektur redet<br />
dabei keinesfalls einer heimattümelnden architektonischen<br />
Kleinkariertheit das Wort, sondern fordert baukünstlerische<br />
Innovationen ein, die sich einem überzeugenden gestalterischen<br />
Miteinander verpflichtet fühlen. Denn nur so kann der<br />
wachsenden Anonymität unseres Lebensumfeldes nachhaltig<br />
begegnet werden.<br />
Das baukulturelle Erbe gehört deshalb nicht der Vergangenheit<br />
an, sondern ist ein lebendiger und rücksichtsvoll fortzuschreibender<br />
integraler Bestandteil unserer Städte. Erst der<br />
Respekt vor der baulich manifesten Geschichte ermöglicht<br />
die Wahrung von Urbanität im Hinblick auf Maßstab, Identität<br />
und emotionale Bindung. Die Pflege und Weiterentwicklung<br />
des historischen Bestandes wird angesichts der<br />
sozioökonomischen und demographischen Entwicklung<br />
unserer Gesellschaft künftig eine noch bedeutsamere Rolle<br />
in der Stadtpolitik spielen müssen.<br />
125
Michael Arns<br />
Als öffentlichste aller Künste unterliegt die Baukunst naturgemäß einer breiten<br />
Beachtung und Diskussion in der Bevölkerung. Denn im Gegensatz zu<br />
den bildenden Künsten unterscheidet sich die Baukunst durch ihre Anwendungs-<br />
bzw. Funktionsbedingtheit; auch dadurch, dass jedes individuelle<br />
architektonische Gestalten öffentliche Auswirkungen hat – und zwar direkte<br />
Auswirkungen auf den Einzelnen, die Nachbarschaft, die Allgemeinheit der<br />
Bürger, auf die Stadt insgesamt.<br />
Die Stadt als soziales und kulturelles Projekt setzt ein hohes Maß an Engagement<br />
voraus. Die Qualität der Stadtgestalt wird von den Bürgerinnen und<br />
Bürgern zunehmend als Mehrwert, als Standort- und Wettbewerbsvorteil<br />
erkannt.<br />
Architektur und Stadtplanung bedürfen einer qualifizierten Beurteilung,<br />
geschichtlicher Kontinuität und bestimmter Formen der Institutionalisierung.<br />
Der Begriff „Baukultur“ beschreibt deshalb nicht nur das realisierte Objekt,<br />
sondern gleichrangig auch den gesamten Planungsprozess. In derart komplexen<br />
Verfahren gilt es, alle Beteiligten und nach Möglichkeit auch eine<br />
breite Öffentlichkeit einzubinden. Hierbei ist die Beratung und Begleitung<br />
durch qualifiziertes Fachwissen unerlässlich.<br />
Ein zentrales diskursives Instrument dazu können die so genannten „Beiräte<br />
für Stadtgestaltung“ (besser und umfassender: „Beiräte für Stadtplanung“)<br />
sein. Inzwischen haben sich diese ehrenamtlich tätigen Gremien in vielen<br />
Städten Nordrhein-Westfalens zu einem effektiven und bewährten Instrument<br />
entwickelt. Der Grundgedanke seit Einführung der ersten Gestaltungsbeiräte<br />
in <strong>NRW</strong> in den 1970er <strong>Jahre</strong>n ist nach wie vor, externes Expertenwissen<br />
und die Erfahrung von Fachleuten in kommunale Planungsprozesse<br />
einzubringen. Der Beirat kann das kommunale Planungsgeschehen auf<br />
mehrfache Weise beleben:<br />
Der Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Verwaltung erhalten kompetente,<br />
unabhängige Beratung. Die kontinuierliche Außensicht auf interne<br />
Planungsprozesse eröffnet großzügigere Chancen, Perspektiven und Entscheidungskriterien<br />
und unterstützt deren Transparenz.<br />
Allgemein bestehen die Aufgaben von Gestaltungsbeiräten in der Diskussion<br />
und Urteilsfindung über vorgelegte Projekte mit dem Ziel, Empfehlungen für<br />
die Fachausschüsse, den Rat und die Verwaltung zu erarbeiten. Ihre Kompetenz<br />
beschränkt sich also ausschließlich auf Beratungsleistungen. Eine wünschenswerte<br />
Beratung der Architekten und Bauherren kann bei früher Vorlage<br />
eines Projektes Bestandteil des Verfahrens sein, ist aber nicht die Regel.<br />
Gerade in diesem Punkt setzen seitens der Mitglieder vieler Beiräte aktuell<br />
die häufigsten Kritikpunkte an.<br />
126<br />
Planungs- und Gestaltungsbeiräte in <strong>NRW</strong><br />
Die Beratung erfolgt sowohl zu Einzelvorhaben als auch zu<br />
städtebaulichen Projekten: Flächennutzungs- und Bebauungspläne,<br />
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen; Hochbauprojekte,<br />
aber auch Grün- und Freianlagen, Verkehrsbauten<br />
bis hin zu Public-Design-Maßnahmen wie Stadtmöblierung,<br />
Beleuchtungs- und Leitsysteme, in Einzelfällen<br />
sogar Werbeanlagen. Entscheidend ist in aller Regel die<br />
besondere Bedeutung des Vorhabens für das Stadtbild.<br />
Empfehlungen sind weiter üblich zur Art der Planungsverfahren,<br />
zu Architektenwettbewerben. Allgemeiner Konsens<br />
ist, dass Projekte, die die Umsetzung von Wettbewerben<br />
darstellen, im Beirat nicht weiter behandelt werden.<br />
Ob die Arbeit der Gestaltungsbeiräte bzw. Beiräte für Stadtplanung<br />
erfolgreich ist, hängt von verschiedenen Rahmenbedingungen<br />
und Faktoren ab, die in der Regel in einer<br />
Geschäftsordnung festgelegt sind: Auswahlverfahren, Qualifikation<br />
und Herkunft der Mitglieder des Beirates, der ihnen<br />
zugestandene Aufgabenbereich und ihre Kompetenzen, der<br />
(möglichst frühe) Zeitpunkt ihrer Beteiligung. Jede Kommune,<br />
jeder Beirat wird diese Fragen neu stellen müssen; auch<br />
wird es individuelle, lokal unterschiedliche Antworten geben<br />
können, gar müssen. Wichtigste Voraussetzung ist und<br />
bleibt aber ein positives Klima unter allen Beteiligten und<br />
das gemeinschaftlich getragene Ziel, die Baukultur in der<br />
Kommune auf ein höheres Niveau zu heben.<br />
Gestaltungsbeiräte und Beiräte für Stadtplanung sind seit<br />
der Erstgründung in Bielefeld 1975 inzwischen in 18 Großund<br />
Mittelstädten des Landes <strong>NRW</strong> etabliert – mit steigender<br />
Tendenz, zuletzt hinzu gekommen sind Beiräte in<br />
Castrop-Rauxel, Mülheim an der Ruhr und im Kreis Soest.<br />
Die Architektenkammer <strong>NRW</strong> lädt ihre Repräsentanten<br />
regelmäßig zu einem Erfahrungsaustausch ein.
Zweifellos kann es kein Patentrezept für die richtige formale<br />
Form eines solchen Gremiums geben: In die Beiräte Dortmund,<br />
Wesel und Wuppertal sind zum Beispiel ausschließlich<br />
externe Architekten berufen worden. Dies mag in Einzelfällen<br />
Voraussetzung für eine höhere Qualifikation bedeuten,<br />
stärkt auf jeden Fall aber die Unabhängigkeit des Beirates<br />
von lokalen politischen und wirtschaftlichen Zwängen und<br />
somit auch die Akzeptanz für die Kollegenschaft. Die übrigen<br />
<strong>NRW</strong>-Beiräte setzen sich in aller Regel aus Fachkollegen<br />
der jeweiligen Stadt zusammen (mit einigen Ausnahmen),<br />
entsprechend ihrem traditionellen Verständnis für ein<br />
bürgerschaftliches Engagement für „ihre“ Stadt. Als Argumente<br />
für dieses Besetzungsverfahren werden oft eine bessere<br />
Ortskenntnis und größere Bürgernähe genannt; auch<br />
Kostengründe sprechen dafür, da eine nicht entschädigte,<br />
ehrenamtliche Beratungsleistung von Externen schwerlich<br />
zu erwarten ist. Günstig für die Zusammenarbeit wirkt sich<br />
das Einbeziehen von Fachleuten aus den Bereichen Landschaftsarchitektur,<br />
Denkmalpflege oder Kunst aus – wenn<br />
das Gremium nicht zu groß wird und arbeitsfähig bleibt.<br />
Die Erfahrung zeigt: Aktive Gestaltungsbeiräte können eine verstärkte Aufmerksamkeit<br />
lokaler Medien für städtebauliche Fragen bewirken, die öffentliche<br />
und politische Diskussion fördern und die lokalen Politiker langfristig<br />
sensibilisieren. Sie sind insofern auch ein Beitrag zur Kommunikationskultur<br />
einer Stadt. Zwar können Spitzenleistungen<br />
nicht erzwungen, „Wildwüchse“ aber (wenn<br />
nicht verhindert) zumindest gemildert werden.<br />
Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen empfiehlt allen Kommunen<br />
und Landkreisen, das Instrument „Planungsbeirat“ für sich zu entdecken<br />
und zu nutzen. Hier bietet die Architektenschaft an, ihr Fachwissen im Interesse<br />
der Region kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Beirat gibt einen<br />
Rat – kein demokratisch legitimiertes Gremium muss diesen annehmen,<br />
aber: Es kann sich davon anregen lassen. Davon kann die regionale Baukultur<br />
nur profitieren!<br />
127
Merlin Bauer<br />
128<br />
Die Kampagne „Liebe deine Stadt“
Die Diskussion um den Fortbestand von Bauten der Nachkriegsmoderne<br />
wird in diesem Land vielerorts geführt. Häufig argumentieren Lokalpolitiker,<br />
neue Bauvorhaben hätten die Aufwertung der Innenstädte zur Folge. Mit<br />
diesem Argument wurde in Köln im Jahr 2002 die Josef-Haubrich-Kunsthalle<br />
mit dem angegliederten Gebäude des Kölnischen Kunstvereins gegen große<br />
Widerstände vieler Bürger abgerissen. Ein Neubau wird an dieser Stelle folgen.<br />
Knapp zwei <strong>Jahre</strong> später stand das nächste öffentliche Gebäude zur Disposition.<br />
Die Lokalpresse forcierte die Diskussion um den Abriss des Opern-Ensembles<br />
von Wilhelm Riphahn, das an anderer Stelle durch einen modernen<br />
Neubau ersetzt werden sollte, um damit das Ansehen der Stadt zu mehren.<br />
Diese Debatte sollte zum Ausgangspunkt eines Projekts in Köln werden, das<br />
im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung daran erinnert, dass Gebäude<br />
Bedeutungsträger sind.<br />
Was genau lieben die Kölner eigentlich an ihrer Stadt? Den Karneval, das<br />
Kölsch, ihr Veedel, die Brauhäuser, die Sprache und natürlich die Kölner<br />
selbst – also vor allem die Atmosphäre. Atmosphäre ist flüchtig, in Köln<br />
aber ist sie beständig. Das vermeintlich Dauerhafte einer Stadt, nämlich das<br />
Gebaute, aber ist flüchtig und befindet sich in einem ständigen Prozess.<br />
Wenn man das Verhältnis der Kölner zu ihrer gebauten Stadt betrachtet,<br />
scheint es sich auf den Dom zu beschränken. Der Dom wird geliebt, vielleicht<br />
noch die romanischen Kirchen und das Römisch-Germanische Museum.<br />
Doch hier endet oft die Identifikation.<br />
„Liebe deine Stadt“ will den Blick für die jüngere Geschichte des Prozesses<br />
schärfen und widmet sich der Architektur der 1950er und 1960er <strong>Jahre</strong>. Das<br />
Projekt versucht, das Selbstbewusstsein, das Köln in Bezug auf seine Atmosphäre<br />
und die in ihr lebenden Menschen besitzt, auf Köln als gebaute Stadt<br />
zu übertragen. Köln ist stolz auf seinen Liberalität, seine Warmherzigkeit<br />
und seinen Optimismus. Und genau diese menschlichen Werte sind auch in<br />
den Gebäuden wiederzufinden.<br />
„Man muss die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt.“<br />
Karl Marx, zitiert nach Bazon Brock: Der Hang zum Gesamtkunstwerk, (Katalog) Aarau und Frankfurt a.M.,1983<br />
„Liebe deine Stadt“ wird über einen Zeitraum von zwei <strong>Jahre</strong>n herausragende<br />
Gebäude der 50er, 60er und 70er <strong>Jahre</strong> mit einer überdimensionalen<br />
Preisschleife auszeichnen. In regelmäßigen Abständen findet eine Preisverleihung<br />
statt, zu der ein Laudator sich der Frage nach der Kölnischen Identität<br />
stellt. Bisher sind u.a. der Architekt Hans Schilling, Kasper König, Bazon Brock<br />
sowie der Kölner Diözesanbaumeister Martin Struck als Laudatoren aufgetreten.<br />
Ausgezeichnet wurden zum Beispiel das Ensemble Hotel- und Parkgarage<br />
an der Cäcilienstraße, das Afri-Cola-Haus an der Turinerstraße und<br />
das Haus Wefers an der Burgmauer. Am Ende des Projektes soll ein Parcours<br />
entstehen, der die Kraft und Vielschichtigkeit dieser Gebäude verdeutlicht.<br />
„Liebe deine Stadt“ wird von zahlreichen Galerien und Institutionen unterstützt,<br />
wie der Galerie Monika Sprüth, der Galerie Daniel Buchholz, der Galerie<br />
Christian Nagel, der Galerie Frehrking Wiesehöfer, der Galerie Gabriele<br />
Rivet, dem Museum Ludwig, der Imhoff-Stiftung, dem Kölnischen Kunstverein<br />
und dem Kulturamt der Stadt Köln. Als Projektträger fungiert ein gleichnamiger<br />
Verein, gegründet von Künstlern, Kulturproduzenten und Architekten.<br />
„Liebe deine Stadt“ ist ein Projekt von Merlin Bauer in Zusammenarbeit<br />
mit Anne-Julchen Bernhardt, Manu Burghart, Robert Elfgen, Albrecht Fuchs,<br />
Veit Landwehr, Jörg Leeser und Tom May.<br />
129
Hans-Dieter Collinet<br />
Eine zivile Gesellschaft zeichnet sich durch die kritische Reflexion im Umgang<br />
mit ihrem kulturellen Erbe aus. Diese Fähigkeit – auch in der kulturellen Auseinandersetzung<br />
mit aktuellen sozioökonomischen Prozessen wie dem vielgestaltigen<br />
Strukturwandel – formt ihr kulturelles Profil, ihre Identität, vor<br />
allem in Konfliktsituationen. Mit dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes <strong>NRW</strong> 1980 erlangte zwar die Bau- und Bodendenkmalpflege<br />
schon sehr früh ein hohes Ansehen und eine breite öffentliche Akzeptanz, die Gartendenkmalpflege<br />
aber musste um ihre Rolle erst noch kämpfen. Der Wert des Gartens als Kunstwerk und Objekt der<br />
Geschichte wurde immer wieder durch gesellschaftliche Interessen für opportune Nutzungen oder durch<br />
einseitige ökologische Maximen zurückgedrängt. Das gartenkulturelle Erbe in unserem Land schien fast<br />
in Vergessenheit zu geraten, denn die gestalterische Idee der Raumkunst mit der Natur kann man nur so<br />
lange erkennen, wie man sie pflegend und hegend erhält. Und genau das war in den „wachsenden<br />
Monumenten“, wie der Landeskonservator Prof. Mainzer sie bezeichnet hat, in den letzten beiden Jahrzehnten<br />
der Biotopisierung unserer Um- wie Gedankenwelt fast verpönt. Vernachlässigung, Verwahrlosung<br />
und schließlich Entwertung waren dann die logische Folge. Dabei hat doch beides, das Ökologische<br />
wie das Ästhetische, seine Rechtfertigung, ja seinen Sinn. Wir leben mehr in einer von Menschenhand<br />
geschaffenen Kulturlandschaft als in einer natürlichen Landschaft. Und für die Kulturlandschaft sind wir<br />
selbst verantwortlich: für ihren ökologischen Wert, aber auch für ihr Bild. Das unverwechselbare typische<br />
Stadt- und Landschaftsbild erst ermöglicht Wertung und Auseinandersetzung, schafft Identität oder<br />
Heimat. Vor allem dort, wo neue Räume etwa im Zuge des Strukturwandels entstehen, sind wir aufgefordert,<br />
den Gestaltungsauftrag anzunehmen.<br />
Dies war das Leitmotiv der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im<br />
nördlichen Ruhrgebiet. Sie führte in den 1990er <strong>Jahre</strong>n ingeniös Natur mit<br />
Kunst und Industriebaukultur synergetisch zusammen. Sie knüpfte aus einem<br />
tiefen ökologischen Anliegen an die Tradition des Gestaltungswillens<br />
europäischer Gartenkunst und Landschaftskultur mit einer eigenen, der Zeit<br />
und dem Raum gemäßen Übersetzung an. Kommuniziert wird der 320 qkm<br />
große Emscher Landschaftspark, das größte Landschaftsbauwerk unserer<br />
Zeit, über herausgehobene, gestaltete Orte. Kunst ist an diesen Orten nicht<br />
additives Beiwerk, sondern – als Landmarken überhöht – Wächterin dieser<br />
neuartigen Industriekulturlandschaft. Der Emscher Landschaftspark ist ein<br />
weltweit beachtetes Beispiel einer gelenkten Rückeroberung der Stadt durch<br />
die Natur in einer schrumpfenden Industrieregion – selbst dort, wo „Urwald“<br />
geplant ist. Er wird zum stadträumlichen Rückgrat des Strukturwandels im<br />
Ruhrgebiet. Mit den Routen der Industrienatur und Industriekultur wird diese<br />
künstlerische Transformation einer Industrielandschaft zum Alleinstellungsmerkmal,<br />
zur Basis eines umfassenden touristischen Konzeptes für das<br />
nördliche Ruhrgebiet; einer Region im Übrigen, in der Tourismus bis vor<br />
wenigen <strong>Jahre</strong>n noch ein Fremdwort war.<br />
130<br />
Gartenkunst in <strong>NRW</strong><br />
Zur Kultur des gestalteten Freiraums
Der Dreiklang aus der kulturellen, städtebaulichen und touristischen Dimension<br />
von Garten- und Landschaftskunst zieht sich denn auch wie ein roter<br />
Faden durch die REGIONALEN „Kultur- und Naturräume in <strong>NRW</strong>“, die, aus<br />
der IBA abgeleitet, seit dem Jahr 2000 alle zwei <strong>Jahre</strong> in verschiedenen Teilregionen<br />
des Landes durchgeführt werden. In allen REGIONALEN wurden<br />
und werden die kulturlandschaftlichen und gartenkünstlerischen Schätze in<br />
die regionale Thematik eingebunden und im Geist der Initiative <strong>StadtBauKultur</strong><br />
<strong>NRW</strong> für stadträumliche Qualifizierungs- und touristische Profilierungsstrategien<br />
– auch über das jeweilige Präsentationsjahr hinaus – genutzt. Das gartenkulturelle<br />
Erbe, in <strong>NRW</strong> gibt es allein 3000 bis 5000 potenzielle Gartendenkmäler,<br />
und das Grün als Teil des öffentlichen Raumes in der Stadt sind<br />
seither wieder stark in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Was man schätzt,<br />
das schützt man auch.<br />
Als ein zentrales Strategieelement ist gemeinsam mit dem Tourismusverband <strong>NRW</strong>, den beiden<br />
Landschaftsverbänden und den regionalen Akteuren das Konzept der vier regionalen<br />
„Straßen der Gartenkunst in <strong>NRW</strong>“ entwickelt worden. Diese Bemühungen sind eingebunden<br />
in das Interreg-Projekt „European Garden Heritage Network“ um das Zentrum für Gartenkunst<br />
und Landschaftskultur Rheinland der Stiftung Schloss und Park Dyck als Leadpartner<br />
und weiteren Partnerregionen in Mittelengland und Westfrankreich. Unter den vier europäischen<br />
Themen „Geschichte der Gartenkunst“, „Gärten berühmter Persönlichkeiten“, „Fruchtbare<br />
Gärten“ und „Zeitgenössische Gärten“ werden die regionalen Routen in Frankreich im<br />
westlichen Loire-Tal, in Großbritannien in den Provinzen Surrey, Sommerset und Cheshire<br />
sowie die Routen in <strong>NRW</strong> zusammengestellt.<br />
Als erste Route in <strong>NRW</strong> ist die „Gartenroute der kulturellen<br />
Ereignisse“ in Ostwestfalen-Lippe (OWL) im Juni 2005 eröffnet<br />
worden, in deren Mittelpunkt das Gartenreich OWL mit der<br />
jährlich wieder kehrenden Kulturreise „Wege durch das<br />
Land“ steht. Danach folgen die Route der „Gärten in der<br />
Münsterländer Schloss- und Parklandschaft“, deren Idee im<br />
neuen Museum im Tiergarten von Schloss Raesfeld einfühlsam<br />
erklärt wird, die Route der „Parks und Gärten als Elemente<br />
von Städtebau und regionaler Identität“ im Ruhrgebiet<br />
– im Spannungsfeld zwischen der gartenkünstlerischen<br />
Transformation einer Industriebrache in Duisburg-Meiderich<br />
und dem Eroberungsprozess der Natur auf der Kokerei Hansa<br />
in Dortmund – und schließlich die grenzüberschreitende<br />
Route zwischen Maas und Rhein „Ein- und Ausblicke in Garten,<br />
Architektur und Landschaft“ im Rheinland um die Stiftungen<br />
Schloss und Park Dyck und Schloss und Park Benrath<br />
in Düsseldorf mit dem eindrucksvollen Museum der Europäischen<br />
Gartenkunst. Beide Stiftungen haben jüngst in Partnerschaft<br />
mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen<br />
Hochschule Aachen und der Heinrich-Heine-Universität in<br />
Düsseldorf das Internationale Institut der Gartenkunst und<br />
Landschaftskultur zur gradualen wie postgradualen Ausbildung<br />
von Landschaftsplanern und Gartendenkmalpflegern<br />
gegründet. Die Wiederentdeckung der Gartenkunst in <strong>NRW</strong> ist also kein „nur“ denkmalpflegerisches<br />
Thema: Der Blick in die gartenkünstlerische Vergangenheit des Landes, aber auch die Auseinandersetzung<br />
mit zeitgenössischen Gärten sind verbunden mit der Aufforderung, die<br />
künftigen Chancen in den freiwerdenden Räumen einer sich wandelnden Stadtlandschaft zu<br />
erkennen und sie mit einem hohen Gestaltungsanspruch für mehr Qualität und Qualitätsbewusstsein<br />
in Stadt und Landschaft zu nutzen. Diese neu entstehenden und neu gestalteten<br />
Freiräume formen gemeinsam mit dem schon vorhandenen gartenkulturellen Erbe die künftige<br />
kulturelle Identität des „Gartenlandes <strong>NRW</strong>“.<br />
131
Roland Weiss<br />
Die industrielle Kulturlandschaft Zollverein trägt seit dem 14. Dezember 2001<br />
als erster und einziger Ort im Ruhrgebiet den Ehrentitel eines UNESCO-Weltkulturerbes.<br />
Schon in der Einleitung des Aufnahmeantrags formulieren die<br />
Autoren bezüglich der Schachtanlage XII: „Auf diese Weise entstand die<br />
damals größte Zechenanlage als technische, baukulturelle und organisatorische<br />
Spitzenleistung des deutschen Steinkohlebergbaus.“<br />
Die Rolle Zollvereins für den gesamten Essener Norden, der sich seit 1847<br />
um die Zechen und Kokereien herum entwickelte, lässt sich damit jedoch<br />
nur skizzenhaft erfassen.<br />
Die stadtlandschaftlich prägenden Zechentürme waren nur die sichtbaren<br />
Zeichen des unterirdischen „Grubengebäudes“, das in seiner Ausdehnung<br />
um ein vielfaches größer ist als die noch vorhandenen Übertage-Anlagen.<br />
Die unterirdische Ausdehnung über die Stadtgrenzen hinaus zeigt die Handlungslogik<br />
des Bergbaus, die heute aktueller nicht sein kann. Wirtschaftliche,<br />
soziale und technische Logik orientierten sich nicht an kommunalpolitischen<br />
Grenzen, sondern an der Geologie der Kohle, den Transportwegen<br />
und der Verfügbarkeit von Grund und Boden. Der Zusammenhang von Kohlevorkommen<br />
und Industrieansiedlung, der den Ursprung des Ruhrgebiets<br />
darstellt, füllt meterweise Bibliotheksregale. Die vorhandenen Anlagen,<br />
Straßen, Siedlungen erzählen bildreich die Geschichte der Region. Aber sie<br />
sind auch gleichzeitig der Raum, in dem sich die Zukunft entwickelt.<br />
Die zukünftigen Entwicklungen haben, wie vor mehr als 150 <strong>Jahre</strong>n, ihren<br />
Ursprung auf dem Zollverein-Areal. Ihre Reichweite hingegen ist nicht mehr<br />
nur lokal oder regional, sondern europäisch. Das gemeinsame Engagement<br />
der Europäischen Union, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt<br />
Essen zeigen diese politische Dimension. Die baukulturelle Aufgabe besteht<br />
darin, nicht nur das Gelände infrastrukturell für eine zukünftige Nutzung zu<br />
erschließen, sondern auch eine programmatische Orientierung der Entwick-<br />
132<br />
Zollverein<br />
Symbol im Wandel und Erbe für die Zukunft<br />
lung anzubieten, die den komplexen Bedürfnissen verschiedener<br />
Nutzergruppen einen attraktiven Rahmen bietet. Vier<br />
Strukturelemente des Zukunftsstandortes Zollverein werden<br />
bis 2007 die weitere Entwicklung zu einem Wirtschaftsstandort<br />
mit Fokus auf Architektur, Design und Kultur unterstützen:<br />
- Die „Zollverein School of Management and Design“, mit<br />
ihrem von dem japanischen Büro Sanaa entworfenen<br />
34 m x 34 m Kubus greift das architektonische Thema<br />
Zollvereins auf und bietet eine zukunftsorientierte Qualifizierungsplattform<br />
für zeitgemäßes Management designorientierter<br />
Unternehmen und Organisationen.<br />
- Die Kohlenwäsche als größtes Gebäude der Anlage wird<br />
nach den Plänen von Rem Koolhaas (OMA) und Heinrich<br />
Böll und Hans Krabel zu einer Ausstellungsfläche für die<br />
ENTRY 2006, einem internationalen Forum für Design<br />
und Architektur, umgestaltet. In fünf Bereichen werden<br />
die Zukunft des Wohnens, Benutzens, Berührens, Erholens<br />
und Erlebens in der postindustriellen Gesellschaft<br />
thematisiert.<br />
- Nach der ENTRY wird 2007 das Ruhrmuseum als naturund<br />
kulturhistorisches Gedächtnis der Region das Gebäude<br />
der Kohlenwäsche nutzen. Erweitert wird dieses Angebot<br />
durch ein touristisches Besucherzentrum, ein Portal für<br />
die Besucher der gesamten Region.<br />
- Das vierte Element, die „designstadt zollverein“, steht als<br />
Entwicklungsfläche für Unternehmensansiedlungen zur<br />
Verfügung und ist eine ideale Ergänzung zur Umnutzung<br />
der Bestandsgebäude.
Das von Lord Norman Foster umgestaltete Kesselhaus beherbergt<br />
mit dem Design Zentrum Nordrhein Westfalen<br />
eine international bekannte Institution, die schon seit 1997<br />
Zollvereins außerordentliche architektonische Atmosphäre<br />
nutzt, um mit dem „Red dot“-ausgezeichnete Produkte zu<br />
präsentieren. Im PACT (Performing Arts Choreographisches<br />
Zentrum <strong>NRW</strong> – Tanzlandschaft Ruhr), das in einer Waschkaue<br />
sein Heim gefunden hat, wird zeitgenössische Bühnenund<br />
Tanzkunst entwickelt und inszeniert.<br />
Die vier Zukunftsbausteine – ENTRY, Ruhrmuseum, Designstadt<br />
Zollverein und Zollverein School – werden quintessenziell<br />
durch viele museale und kreative Angebote ergänzt.<br />
Tradition und Innovation verbinden sich zu einer einmaligen Atmosphäre<br />
von Kreativität. Die baulichen und institutionellen Elemente des Wandels<br />
auf Zollverein werden wiederum ergänzt durch vielfältige Veranstaltungen<br />
wie Konzerte, Kongresse, Kulturveranstaltungen und Events.<br />
Fritz Schupp, einer der beiden Architekten der Anlage, formulierte schon<br />
1930 etwas, das heute, 75 <strong>Jahre</strong> später, wie ein Schlüssel zum Verständnis<br />
der neuen Rolle Zollvereins verstanden werden kann: „Wir müssen erkennen,<br />
dass die Industrie mit ihren gewaltigen Bauten nicht mehr ein störendes<br />
Glied in unserem Stadtbild und in der Landschaft ist, sondern ein Symbol<br />
der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit wenigstens ebenso<br />
großem Stolz dem Fremden zeigen soll wie seine öffentlichen Gebäude.”<br />
133
134
Baukultur persönlich<br />
135
der garten der erinnerungen – ein ort der freiheit,<br />
ein ort zum tief durchatmen,<br />
ein ort, an dem sich der schritt, die haltung, die bewegung ändern,<br />
ein ort, an dem die energie fließt, die gedanken andere richtungen nehmen,<br />
ein ort der erhabenheit und des zerbrechlichen,<br />
ein fundamental säkularer raum der verinnerlichung,<br />
ein ort der ehrfurcht vor geschichte und ihrer bescheidenheit zugleich,<br />
ein ort der relativität, der uns die möglichkeit gibt, uns in ständiger bewegung zu verorten<br />
Söke Dinkla<br />
Garten der Erinnerungen,<br />
Duisburg<br />
136
Dieser Ort steht wohl exemplarisch für unzählige seinesgleichen im Land. Einst Edeka-Supermarkt, dann türkischer Gemüseladen, verfiel das Ladenlokal mit<br />
dem wunderbaren Blick auf den Schlossgarten in einen Dornröschenschlaf. „Unvermietbar“, so hieß es. Wir küssten es wach! H20 – nun ist es ein urbaner<br />
Salon, ein Showroom, ein Büro, eine Galerie, manchmal ein Club oder auch ein Café. Ein Raum, der uns geradezu auffordert, ihn immer wieder neu zu beschreiben.<br />
Ein Optionsraum für den unerwarteten Zwischenfall, das Splittern und Klirren des Augenblicks oder auch nur die Merkwürdigkeiten des Alltags.<br />
Marc Günnewig, Fabian Holst, Jan Kampshoff<br />
H20, Münster<br />
137
138<br />
Mein Ort ist das Rheinufer,<br />
den großen Fluss im Blick<br />
und die altehrwürdige<br />
Tonhalle, die mir als Musikmacher<br />
natürlich sehr viel<br />
bedeutet, im Rücken.<br />
Der Rhein gibt mir das<br />
Gefühl, nicht in der Stadt<br />
gefangen zu sein und<br />
immer wieder neue Orte<br />
erreichen zu können.<br />
Eigentlich ist es schade,<br />
dass die Düsseldorfer den<br />
Rhein nur aufsuchen, um<br />
sich zu entspannen – und<br />
nicht, um über den Rhein<br />
in andere großartige Städte<br />
zu reisen.<br />
Das Rheinufer ist ein Ort,<br />
um den uns viele auswärtige<br />
Besucher beneiden;<br />
er könnte für mich aber<br />
noch sehr viel mehr bieten,<br />
nämlich eine tolle, öffentliche<br />
Plattform für Jugendkultur<br />
in Düsseldorf.<br />
Zwischen all den Inlineskatern<br />
und Rasensportlern<br />
ist da Platz genug für mehr<br />
Kultur am Rhein!<br />
Henry Storch<br />
Rheinufer, Düsseldorf
Ein architektonisches Highlight der Bauhaus-Epoche setzt in Oberhausen entlang der Essener Straße Akzente:<br />
Der klassische Verwaltungsbau – ein architektonisches Denkmal aus dem <strong>Jahre</strong> 1913 – zeugt von der Großindustrie<br />
vergangener Zeit. Heute bildet das Ensemble um das von Carl Weigle erbaute ehemalige Thyssen-<br />
Werksgasthaus ein Entree zur Allee der Industriekultur. Historischer Charme ergänzt sich durch zeitgemäße<br />
Architektur der Pariser Architekten Reichen et Robert. In der Blütezeit der Montanindustrie war der Traditionsbau<br />
eine Begegnungsstätte, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park sensibel<br />
umgebaut und sinnvoll erweitert wurde, schließlich zu einem modernen Dienstleistungsstandort<br />
erwuchs. Das gestalterisch wie funktional gelungene Projekt um den historischen Kern stellt heute eine prägende<br />
Landmarke dar und gleichzeitig bildet die gebogene Form des Neubaus den Ausgangspunkt für die<br />
städtebauliche Spiralstruktur des Gesamtprojektes Neue Mitte Oberhausen.<br />
Burkhard Ulrich Drescher<br />
Technologiezentrum Umweltschutz TZU, Oberhausen<br />
139
Der Ort, an dem ich bin, ist mein Schreibtisch. Hier bin ich in der Gegenwart; umgeben von Räumen, Gebäuden, Landschaft. Getragen von der Geschichte, die<br />
ich erleben und mitgestalten durfte. Meine Augen sehen die Architekturen von Bruno Reichlin, Santiago Calatrava, Johannes Schilling und David Chipperfield, eingebunden<br />
in die Landschaft von Peter Wirtz: der Campus von Ernsting’s family in Coesfeld-Lette.<br />
Meine Gedanken gehen in die Zukunft: Die nächsten drei <strong>Jahre</strong> sind exakt geplant, weitere sieben <strong>Jahre</strong> sind gut vorstellbar. Danach beginnen Ideen, die sich zu<br />
Visionen entwickeln. Grundgedanke aller Zukunftspläne ist Optimismus, ist Vertrauen in die eigene Gestaltfähigkeit und Freiheit.<br />
Der Ort, an dem ich bin, ist unser Campus, ist Ernsting’s family, ist unsere Familie. Hier leben und erleben wir Gegenwart und gestalten die Zukunft. Wir, das sind<br />
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens, meine Frau und ich, unsere Kinder und Enkelkinder, alle Menschen, die mit uns Kontakt haben, die<br />
uns vertrauen und mit uns leben. Und dieser Campus gibt uns den Raum zu diesem Leben, das uns glücklich macht, das uns Freude bringt. Dafür sind wir dankbar<br />
– auch und besonders den Architekten.<br />
Kurt Ernsting<br />
Campus Ernsting’s family, Coesfeld-Lette<br />
140
Ein gelungenes Werk ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann!<br />
Die Insel Hombroich – ebenso wie die Raketenstation Hombroich – leisten einen einzigartigen Beitrag zur Baukultur.<br />
Architektur, Kunst und Landschaft treten in einem angenehmen Gleichgewicht auf.<br />
Die Landschaft ist in ihrer natürlichen Erscheinung erhalten. Nur an ausgewählten Orten wird durch Hinzufügung<br />
von künstlichen Landschaftselementen die Erlebnisfähigkeit der Natur unterstrichen.<br />
Die Architektur ergänzt – ganz selbstverständlich – die Landschaft mit einfachen Kuben und reduzierter Materialität.<br />
Überzeugende Proportionen und Lichtführungen verschaffen den Innenräumen eine<br />
überraschende Erlebniskraft.<br />
Die Kunst, insbesondere auch die Mischung aus benutzbarer und wahrnehmbarer<br />
Kunst, kann in diesen klaren Räumen genauso wie in der Landschaft ihre volle Wirkung<br />
entfalten. Dabei ist die Kunst sogar zum Anfassen.<br />
Die gleichberechtigte Parallelität und das selbstverständliche Zusammenwirken dieser<br />
drei „Kulturen“ – ohne überzogene Ambitionen und zwanghafte Inszenierungen –<br />
machen diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Wenn die Gesetzmäßigkeiten eines<br />
überzeugenden Raumerlebnisses so einfach sind, warum schaffen wir es eigentlich<br />
nicht, diese Regeln verstärkt in der Gestaltung unserer Umwelt anzuwenden?<br />
Christa Reicher<br />
Insel Hombroich, Neuss<br />
141
Baukultur in <strong>NRW</strong> – das sind für mich vor allem die monumentalen Industrieanlagen, denen die Künste einen neuen Sinn gegeben haben. Am meisten fasziniert mich<br />
die ehemalige Waschkaue auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zollverein. Mit der Stilllegung der Zeche 1986 entwidmet, beherbergt das fast hundertjährige zweigeschossige<br />
Backsteinhaus seit 2000 PACT Zollverein, das Choreographische Zentrum <strong>NRW</strong>. Hier hat die Tanz-Avantgarde ein inspirierendes Ambiente gefunden. Das<br />
Gebäude, das von Prof. Christoph Mäckler mit großem Einfühlungsvermögen revitalisiert wurde, bringt eine besondere Begabung für die Neunutzung mit. Seine langen<br />
Gänge ermöglichen – heute wie damals – den schrittweisen Übergang von der Arbeit zur Muße und umgekehrt. Sie erzeugen eine meditative Ruhe, die mir der Ort trotz<br />
seiner Lebendigkeit mitteilt. Die Bühnenscheinwerfer nehmen den Platz der Metallkörbe ein, in denen die Bergleute ihre Freizeitkleidung aufbewahrten, um sie nach der<br />
Schicht gegen die Kluft einzutauschen: Kontinuität im Wandel, das gefällt mir.<br />
Oliver Scheytt<br />
PACT Zollverein, Essen<br />
142
Mit der Hauptverwaltung auf Nordstern hat die<br />
THS ein markantes Zeichen für eine <strong>StadtBauKultur</strong><br />
des Ruhrgebiets gesetzt. Ausschlaggebend<br />
für meine Wahl ist die auf Nordstern spürbare<br />
Bauherrenrolle, die bei Auszeichnungen zu oft<br />
hinter großen Architektennamen versteckt<br />
wird. Die THS hat hier ihre Unternehmensphilosophie:„Erhalten.Ergänzen.Neudefinieren.Erfinden“<br />
konsequent mit der Sprache<br />
des Bauens zum Ausdruck gebracht.<br />
Sichtbar für die Menschen, die dort<br />
arbeiten; sichtbar für die Menschen der<br />
Region. Die Wahl von Nordstern als Ort<br />
bietet neben Platz zugleich Geschichte<br />
und Identität: ein modernes Bekenntnis<br />
zur Region. Der gestaltete Raum<br />
schafft Wohlgefühl.<br />
Dahinter verbirgt sich ein Bauherrenwillen, ein sich Einmischen im Kreis der<br />
beauftragten Architekten, Ingenieure, Farbgestalter mit Durchsetzungskraft.<br />
Nordstern ist ein Zeichen von Verantwortung für den Verband der Wohnungswirtschaft<br />
Rheinland Westfalen mit seinen rund 480 Wohnungsgesellschaften<br />
und Genossenschaften. Mit kleinen wie mit großen Investitionen<br />
nehmen sie fast täglich auch die Rolle von Bauherren wahr.<br />
Burghardt Schneider<br />
THS-Hauptverwaltung auf Nordstern, Gelsenkirchen<br />
143
144<br />
Stadt bedeutet immer auch Wohnen.<br />
Also heißt Stadtbaukultur auch: die Stadt<br />
fürs Wohnen, zum Wohlfühlen und damit<br />
zum Leben wieder zu entdecken.<br />
In Duisburg-Hamborn, einem eher vergessenen<br />
Stadtteil, wurde eine ebenso vergessene zentrale<br />
Wohnbebauung mit 161 Wohnungen des Kölner<br />
Architekten Emil Rudolf Mewes aus den <strong>Jahre</strong>n 1929/30<br />
vom Bauherrn und Eigentümer THS Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten<br />
Essen als Beitrag zur Stadtentwicklung und<br />
Standortsicherung des Stadtteils Hamborn für eine neue Zukunft<br />
durch Erhalt und wieder gestaltende Rückbesinnung nach intensiver<br />
Spurensuche wie Material, Details, Ausstattung und Farbgebung nachhaltig<br />
modernisiert.<br />
Dieser Wohnkomplex gilt aus architekturgeschichtlichen, städtebaulichen<br />
und sozialgeschichtlichen Gründen als signifikantes Beispiel der industrieorientierten<br />
Urbanisierung des nördlichen Ruhrgebiets im Stil des zeitgenössischen<br />
„Neuen Bauens und Wohnens“.<br />
Große Wohnungen durch Zusammenlegung von kleinen Wohnungen<br />
mit großen Fenstern in der üblichen Sprossenteilung zur Gartenseite und<br />
angebauten Balkonen bieten zukunftsorientierten Wohnkomfort.<br />
Die zum öffentlichen Raum gewandten Fassaden blieben oder wurden<br />
wieder im ursprünglichen Stil hergestellt, ebenso die vier vorgelagerten<br />
Plätze im Kreuzungsbereich der Straßen. Im <strong>Jahre</strong> 1991<br />
auf Initiative der THS unter Denkmalschutz gestellt,<br />
wurde hier in produktiver Kooperation mit den Vertretern<br />
der Denkmalschutzbehörden ein modernes Verständnis<br />
von Denkmalschutz praktiziert.<br />
Stadtbaukultur durch intensive Spurensuche zur Erhaltung<br />
der Vergangenheit, als dem Gedächtnis von Orten,<br />
ausgerichtet auf eine neue Zukunft des Wohnens in<br />
der Stadt. Hier profitieren alle: der Eigentümer, die<br />
Bewohner und die Stadt. Stadtmarketing für und durch<br />
einen wieder entdeckten Stadt-Ort mit neuem Namen<br />
als Markenzeichen: „BauhausKarree“<br />
Karl-Heinz Cox<br />
BauhausKarree, Duisburg
Wenn ich es ehrlich zugebe, habe ich den Satz „form follows function“ nie wirklich<br />
verstanden. Folgt aus einer Funktion genau eine Form? Was ist denn überhaupt<br />
die Funktion, aus der eine Form folgt? Was macht die Form, wenn die Funktion<br />
sich ändert? Ändert sich die Funktion nicht mit der Perspektive? Wenn ich die<br />
Architektur der Moderne, wie sie mir landauf, landab begegnet, wahrnehme,<br />
komme ich zu dem Schluss, dass der Satz den modernen Architekten auch<br />
nicht sehr geholfen hat und Baukultur wohl doch mehr sein muss, als<br />
dieser viel zitierte Grundsatz der Moderne.<br />
Baukultur hat für mich mit mehr als der eindimensionalen Logik von<br />
„wenn-dann-Beziehungen“ zu tun. Ich freue mich über das, was<br />
unter der Oberfläche steckt und über den Dingen steht, über<br />
Schönheit und Haltung. Der Kanzlerbungalow, den Sep Ruf als<br />
Wohnhaus für Ludwig Erhard 1963/64 realisierte, hat mich<br />
begeistert. Das feine Gefühl für Proportionen, das intelligente<br />
Zusammenspiel von Außen- und Innenraum, die<br />
sensible Verwendung und Verarbeitung der Materialien<br />
und die stille Großzügigkeit des Grundrisses zeigen,<br />
wie viel Reichtum sich in der Architektur verbergen<br />
kann.<br />
Es mag sein, dass „form follows function“ ein<br />
Leitsatz der Modernen Architektur ist. Bei<br />
den Bauten von Mies van der Rohe, Sep Ruf<br />
und Richard Neutra habe ich das Gefühl,<br />
das sie deshalb zur Baukultur gehören,<br />
weil sie darüber hinaus gehen.<br />
Johannes Busmann<br />
Bundeskanzlerbungalow,<br />
Bonn<br />
145
In der Dunkelheit strahlt sie wie ein farbiger Edelstein und am Tage ist sie das kulturelle Zentrum der nördlichen City: Die Philharmonie für Westfalen, unser Dortmunder<br />
Konzerthaus, ist mein baukultureller Favorit. Unter schwierigen Bedingungen hat sich das Gebäude als gewaltiger Solitär in ein dicht bebautes City-Quartier eingefügt<br />
und seine Umgebung zu neuem Leben erweckt. Optisch spiegelt das Konzerthaus mit seiner beleuchteten Fassade die Stimmungen der Musik aus seinem Inneren<br />
wider, programmatisch hat es der gesamten Region ein neues Glanzlicht aufsetzen können.<br />
Monika Block<br />
Konzerthaus Dortmund – Philharmonie für Westfalen,<br />
Dortmund<br />
146
Als im damaligen Lenkungsausschuss der IBA das Projektmodell<br />
von Mont Cenis vorgestellt wurde, gab es einen ersten Zwischenruf<br />
„Gigantomanie!“<br />
In der Tat sind die Dimensionen der Glashülle gigantisch –<br />
176 Meter lang, 72 Meter breit, 15 Meter hoch. Von<br />
„Manie“ kann jedoch keine Rede sein. Vielmehr handelt es<br />
sich um die Umsetzung eines visionären Architekturkonzeptes,<br />
das standortbezogene Baukultur mit technologischer<br />
Innovation und Nachhaltigkeit verbindet. Standortbezogen<br />
bedeutet in diesem Zusammenhang, die<br />
Großstruktur der ehemaligen Schachtanlage mit neuem<br />
Inhalt und neuer Form wieder aufzunehmen. Gleichzeitig<br />
drängt sich der Eindruck des Außergewöhnlichen,<br />
Besonderen auch im Verhältnis zum Umfeld<br />
auf. Gerade solche Brechungen sind Teil der „neuen“<br />
Stadtbaukultur im Ruhrgebiet. Sie werden bei<br />
Mont Cenis in der Innenraumgestaltung bis zu<br />
einer mediterranen Atmosphäre vorangetrieben,<br />
die keine sterilen Erlebniswelten vorgaukelt, sondern<br />
real aus dem Zusammenhang von Wasser,<br />
der Tragwerkskonstruktion und den verschachtelten<br />
Wohneinheiten entsteht.<br />
Tillmann Neinhaus<br />
Fortbildungsakademie Mont Cenis,<br />
Herne<br />
147
Was ist eigentlich eine Bramme?<br />
Das Wörterbuch machts knapp:<br />
Bramme: Eisenstück.<br />
Und tatsächlich, hat man sich über lange schmale Fußwege bis zum Hochplateau der Halde (65 m) hochgekämpft, dann<br />
steckt es da, das Eisenstück.<br />
Schlicht und schlank, ebenso nüchtern wie geheimnisvoll. Nach dem Aufstieg durch das verwilderte Grün wirkt die steinige,<br />
schwarze Öde oben besonders karg. Eine riesige Fläche, eine ins Negativ gekehrte Oase, und mittendrin die Bramme in<br />
einem rostigen Rotbraun, gleichzeitig verloren und zentral.<br />
Es ist eine laute Stille da oben, im Blick die Anlagen der Zeche Zollverein, das Tetraeder und die Schalke-Arena.<br />
Viel Industrie, noch mehr Grün. Die Autobahn beängstigend nah.<br />
Kein Busparkplatz, keine Hinweistafeln. Kein Fernglas, keine Getränkebude.<br />
Ein Geheimtipp?<br />
Die Schurenbachhalde, ebenso Industrie wie Kultur, mittendrin und doch darüber, ist von einer kantigen Eleganz, die eben<br />
nur das Ruhrgebiet hat.<br />
Es ist ein Ort mit Spannung, voll von Vergangenheit und Gegenwart, unspektakulär und gleichzeitig einzigartig.<br />
Eine Oase eben.<br />
148<br />
Henrietta Horn<br />
Schurenbachhalde, Essen
Architekturaussagen in unserer Zeit werden immer<br />
ausdrucksloser, angepasster und uneigenständiger.<br />
Nicht so hier in dieser ehemaligen Industriehalle,<br />
die nicht in erster Linie schön sein wollte,<br />
sondern vor allem ihrem Anspruch als Gehäuse für<br />
industrielle Aufgaben entsprechen sollte. So blieb<br />
es bis heute möglich, die Neugierde offen zu<br />
halten. Hier wird der Ort wieder zum Ereignis,<br />
hier kann man Proportion und Harmonie erleben,<br />
ohne auf eine bestimmte Art der Wahrnehmung<br />
festgelegt zu sein.<br />
Deshalb haben wir den Begriff der „Montagehalle<br />
für Kunst“ geprägt. Montage steht vor allem dafür,<br />
aus verschiedenen Teilen wieder ein neues Ganzes entstehen<br />
zu lassen. Das bezieht sich auf die künftigen Inszenierungen<br />
in den Räumen, aber auch auf das Konstruktionsprinzip selbst,<br />
sowohl der aus mehreren Bauteilen zusammengefügten historischen<br />
Halle als auch auf die Ergänzung durch raffinierte,<br />
technologische und reaktivierende Elemente, die einen Erhalt,<br />
eine sinnvolle Nutzung überhaupt erst möglich machen.<br />
So bleiben das Alte innen und das Neue außen klar ablesbar.<br />
Die Jahrhunderthalle behält, auch als Spielstätte der Triennale,<br />
einen Erinnerungswert von großer Qualität.<br />
Karl-Heinz Petzinka<br />
Jahrhunderthalle, Bochum<br />
149
Auf der kleinen Plattform im Vierungsturm des<br />
Kölner Doms steht man etwa 68 Meter über<br />
dem Roncalliplatz. Man hat dort einen wunderbaren<br />
Blick über die Stadt, bei günstigem<br />
Wetter sogar bis zum Siebengebirge und<br />
nach Bensberg. Vor allem sieht man den<br />
Rhein und seine Ufer. Man erkennt, wie<br />
die Kirchen Kölns noch immer ihre „Veedel“<br />
dominieren: Groß St. Martin, St. Severin,<br />
Pantaleon, St. Aposteln, St. Ursula,<br />
St. Kunibert usw... Immer, wenn ich so<br />
über der Stadt stehe, hoffe ich, dass das<br />
so bleibt. Inmitten der oft zufällig<br />
wirkenden, ungeordneten Bebauung<br />
der letzten Jahrzehnte bilden die Kirchen<br />
die einzig klare, noch vorhandene<br />
Struktur. Hier oben, umgeben von<br />
der großartigen Architektur des<br />
Doms, fühlt man sich den Alltagssorgen<br />
enthoben, alles Kleinliche<br />
fällt von einem ab.<br />
Deshalb ist dies mein Lieblingsort<br />
in der Stadt.<br />
150<br />
Barbara Schock-Werner<br />
Dom und<br />
Blick über Köln
Einen Ort, ein Bauwerk, eine Situation,<br />
die für mich die Baukultur in<br />
Nordrhein-Westfalen verkörpern<br />
würden, kann ich leider nicht nennen,<br />
wohl aber drei:<br />
· die handwerkliche Qualität des<br />
Bauens, die mir bei meinem ersten<br />
Besuch im Münsterland im Jahr<br />
1968 ins Auge fiel, von der Akkuratesse,<br />
mit der das Mauerwerk zusammengefügt<br />
war, über die Präzision,<br />
mit der Fenster und Türen eingepasst<br />
waren, bis zu dem satten Ton,<br />
mit dem die Türen dann ins Schloss<br />
fielen;<br />
· die drückende Enge der langen<br />
Gänge in den Institutsbauten der<br />
Universität Bochum, die mich, als<br />
ich, selbst frisch nach Dortmund berufen,<br />
dort einen Kollegen besuchte,<br />
derart beklemmte, dass ich wohl<br />
einen Ruf dorthin nie hätte annehmen<br />
können;<br />
· der Tetraeder bei Bottrop, dessen<br />
filigrane Eleganz seine Verankerung<br />
in einer ganz ordinären Halde zunächst<br />
vergessen, dann aber als<br />
Signal eines neuen Typs von Landschaft<br />
erkennen ließ.<br />
Erika Spiegel<br />
Drei Orte<br />
151
152
Anhang<br />
153
154<br />
Autorenverzeichnis<br />
Friedrich Achleitner, Wien<br />
em. o. Univ. Prof. mag. arch. Dr. tech, Architekturpublizist und Schriftsteller<br />
Michael Arns, Düsseldorf<br />
Dipl.-Ing., Vizepräsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen<br />
Karin Bandow, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. (FH), Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Merlin Bauer, Köln<br />
Künstler und Kulturproduzent, Stipendiat des Kölnischen Kunstvereins<br />
und der Imhoff-Stiftung<br />
Monika Block, Dortmund<br />
Geschäftsführerin Galeria Kaufhof Dortmund<br />
und Vorsitzende City-Ring Dortmund<br />
Peter Brdenk, Essen<br />
Dipl.-Ing., Planwerk<br />
Stefanie Bremer, Essen<br />
Dipl.-Ing., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Stadtplanung<br />
und Städtebau Universität Duisburg-Essen<br />
Christoph Brockhaus, Duisburg<br />
Prof. Dr., Direktor Wilhelm Lehmbruck-Museum<br />
Frauke Burgdorff, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing., Leiterin Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. (bis 2005)<br />
Johannes Busmann, Wuppertal<br />
Prof. Dr., Verlag Müller+Busmann KG<br />
Wolfgang Christ, Weimar/Darmstadt<br />
Prof. Dipl.-Ing. Entwerfen und Städtebau 1,<br />
Institut für Europäische Urbanistik (IfEU) Bauhaus-Universität Weimar<br />
Hans-Dieter Collinet, Düsseldorf<br />
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Karl-Heinz Cox, Gelsenkirchen<br />
Prof. Dr.-Ing., ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung der THS GmbH<br />
Söke Dinkla, Duisburg<br />
Dr., Kuratorin Festivalbüro Duisburg<br />
Burkhard Ulrich Drescher, Essen<br />
Mitglied des Vorstandes der RAG Immobilien AG<br />
Peter Dübbert, Düsseldorf<br />
Dipl.-Ing., Präsident der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen<br />
Kurt Ernsting, Coesfeld<br />
Firmengründer Ernsting’s family<br />
Francesca Ferguson, Berlin<br />
Kuratorin und Journalistin, urban drift productions Ltd.<br />
Carl Fingerhuth, Zürich<br />
Dipl. Arch., Honorarprofessor Technische Universität Darmstadt<br />
Birgit Frey, Unna<br />
Städte-Netzwerk Nordrhein-Westfalen e.V.<br />
Dörte Gatermann, Köln<br />
Prof.’in Dipl.-Ing., Gatermann+Schossig Architekten Generalplaner<br />
Martin Gerth, Düsseldorf<br />
Dr.-Ing., Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Achim Großmann, Berlin<br />
MdB, Parlamentarischer Staatssekretär<br />
beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
Eberhard Grunsky, Münster<br />
Prof. Dr., Landeskonservator i. R., Leiter des Westfälischen Amtes<br />
für Denkmalpflege Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
Marc Günnewig, Münster<br />
M.A. (Arch.), modulorbeat - ambitious urbanists & planners / freihaus ms<br />
Dirk Haas, Essen<br />
Dipl.-Geogr., RE.FLEX architects_urbanists<br />
Ulrich Hatzfeld, Düsseldorf<br />
Dr., Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Jochen Heufelder, Köln<br />
Kurator<br />
Fabian Holst, Münster<br />
M.A. (Arch.), modulorbeat - ambitious urbanists & planners / freihaus ms<br />
Henrietta Horn, Essen<br />
Prof.’in, Moderner Tanz und Folkwang Tanzstudio Folkwang Hochschule<br />
Ernst Hubeli, Zürich<br />
Prof. Dipl.-Arch. ETH, Architekturbüro Herczog Hubeli<br />
Jan Kampshoff, Münster<br />
M.A. (Arch.), modulorbeat - ambitious urbanists & planners / freihaus ms<br />
Volker Katthagen, Bochum<br />
Cand.-Ing. (FH), Freie Mitarbeit Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Kay von Keitz, Köln<br />
Dipl.-Kulturwissenschaftler, Kurator und Publizist<br />
Hans-Dieter Krupinski, Düsseldorf<br />
Dr.-Ing., Ministerium für Bauen und Wohnen<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Petra Lindner, Münster<br />
Freie Kuratorin
155<br />
Udo Mainzer, Pulheim<br />
Prof. Dr., Landeskonservator,<br />
Leiter des Rheinisches Amtes für Denkmalpflege<br />
Hartmut Miksch, Düsseldorf<br />
Dipl.-Ing., Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen<br />
Martin zur Nedden, Bochum<br />
Dipl.-Ing., Stadtbaurat der Stadt Bochum<br />
Tillmann Neinhaus, Bochum<br />
Dipl.-Kfm., Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer<br />
im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum<br />
Franz Pesch, Herdecke<br />
Prof. Dr.-Ing., Pesch und Partner Architekten Stadtplaner<br />
Karl-Heinz Petzinka, Gelsenkirchen<br />
Prof. Dipl.-Ing., Vorsitzender der Geschäftsführung der THS GmbH<br />
Christa Reicher, Dortmund<br />
Prof.’in Dipl.-Ing., Fachgebiet für Städtebau und Bauleitplanung<br />
Universität Dortmund<br />
Frank Roost, Berlin<br />
Dipl.-Ing., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet Planungs- und<br />
Architektursoziologie Technische Universität Berlin<br />
Christof Rose, Düsseldorf<br />
Dipl.-Journalist, Pressesprecher der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen<br />
Jörn Rüsen, Essen<br />
Prof. Dr., Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts<br />
Hans-Ulrich Ruf, Düsseldorf<br />
Dipl.-Ing., Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Henrik Sander, Dortmund<br />
Dipl.-Ing., orangeedge urban research + marketing<br />
Thorsten Schauz, Dortmund<br />
Dipl.-Ing., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet für Städtebau und<br />
Bauleitplanung Universität Dortmund<br />
Oliver Scheytt, Essen<br />
Dr., Beigeordneter für Bildung, Jugend und Kultur der Stadt Essen<br />
J. Alexander Schmidt, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing., Institut für Stadtplanung und Städtebau<br />
Universität Duisburg-Essen<br />
Burghard Schneider, Düsseldorf<br />
Staatssekretär a. D., Vorstandssprecher Verband der Wohnungswirtschaft<br />
(VdW) Rheinland Westfalen e. V.<br />
Barbara Schock-Werner, Köln<br />
Prof.’in Dr. Dipl.-Ing., Dombaumeisterin Dombauverwaltung Köln<br />
Klaus Selle, Aachen<br />
Prof. Dr.-Ing., Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtplanung RWTH Aachen<br />
Erika Spiegel, Heidelberg<br />
em. Prof.’in Dr., Stadtsoziologin<br />
Dietmar Steiner, Wien<br />
Mag. Arch., Direktor des Architekturzentrums Wien<br />
Henry Storch, Düsseldorf<br />
Musikverleger und DJ, Betreiber von Unique Records & Verlag<br />
Yasemin Utku, Dortmund<br />
Dipl.-Ing., Wissenschaftliche Mitarbeiterin,<br />
Institut für Raumplanung Universität Dortmund<br />
Angela Uttke, Dortmund<br />
Dipl.-Ing., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachgebiet für Städtebau<br />
und Bauleitplanung Universität Dortmund<br />
Sabine Voggenreiter, Köln<br />
M.A., Kuratorin und Publizistin<br />
Michael von der Mühlen, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing., Stadtdirektor der Stadt Gelsenkirchen<br />
Kunibert Wachten, Aachen<br />
Prof. Dipl.-Ing., Lehrstuhl für Städtebau und Landesplanung RWTH Aachen<br />
Wilfried Wang, Berlin<br />
Prof. Dipl.-Arch., Hoidn Wang Partner<br />
Udo Weilacher, Hannover<br />
Prof. Dr. sc. ETH, Institut für Landschaftsarchitektur und Entwerfen<br />
Universität Hannover<br />
Roland Weiss, Essen<br />
Dipl.-Ing., Geschäftsführer Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH<br />
Andrea Wilbertz, Düsseldorf<br />
Dipl.-Geogr., Leiterin Referat Marketing und Kommunikation<br />
der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen<br />
Oliver Wittke, Düsseldorf<br />
Minister für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen
156<br />
Bildnachweis<br />
Innentitel<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Seite 11<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Seite 24<br />
Deutschlandschaft<br />
Ausstellung Deutschlandschaft, Gelsenkirchen<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Elke Torges)<br />
Seite 25<br />
Ausstellung Deutschlandschaft, Gelsenkirchen<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Elke Stamm)<br />
Seite 27<br />
1000 Baulücken<br />
links oben: Baulücke, Essen<br />
links unten: 1. Preis „Kindergarten Am Frommen Josef“, Essen<br />
(Entwurf: Walter Gebhardt)<br />
rechts oben: 2. Preis „Bürgerbühne“, Dortmund<br />
(Entwurf: Kirstin Jotzo)<br />
rechts unten: Baulücke, Dortmund<br />
unten (kleines Bild): 1. Preis „Stapelhaus“ Dortmund<br />
(Entwurf: Marko Heinzdorff und Kollegen)<br />
(Quelle: Architektenkammer <strong>NRW</strong>)<br />
Seite 28<br />
Temporäre Architektur<br />
links oben: The Massive Penal Colony, Arata Isozaki + Yoko Ono<br />
(Foto: Ville Kostamoinen)<br />
links mitte: „blow“ (Entwurf: Hans-Peter Nünning, Dennis Petricic)<br />
links unten: Ralf (Foto: Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.)<br />
rechts oben: 1. Preis „mein platz!“<br />
(Entwurf: Verena Gerdesmeier und Patrik Stührenberg)<br />
rechts unten: Installation eines temporären Besitzers (Foto:Till Engels)<br />
Seite 29<br />
„weitblick“ (Entwurf: Anja Carina Hilsmann und Silke Strotkamp)<br />
Seite 30/31<br />
Der Traum vom Turm<br />
von links nach rechts: Petronas Towers (Cesar Pelli und Associates),<br />
Chrysler Building (William van Alen), Kölner Dom (versch. Dombaumeister),<br />
Burj Al Arab (W.S. Atkins und Partner) (alle Modellfotos: Joop Greypink)<br />
Seite 32<br />
Innovationspreis Wohnungsbau<br />
1. Preis WohnreWir Tremonia, Dortmund (Architektur: Post und Welters)<br />
Seite 33<br />
Hintergrund: 1. Preis WohnreWIR Tremonia, Dortmund<br />
(Architektur: Post und Welters)<br />
von links nach rechts:<br />
Wohnanlage Rheinfährstraße, Neuss (Architektur: Böttger)<br />
Wohnquartier „Breul/Tibusstraße“, Münster<br />
(Architektur: Schröder und Partner, Wohn-und Stadtbau GmbH,<br />
Plan.Werkarchitekten)<br />
Wohnen im Hochbunker, Köln (Architektur: Luczak)<br />
Seite 34<br />
Shopping Center Stadt und Vorbildliche Handelsarchitektur in <strong>NRW</strong><br />
mitte: (Foto: Axel Boesten)<br />
links : Projektlogo (Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.)<br />
unten: Shopping Center (Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.)<br />
Seite 36/37<br />
Orte der Arbeit<br />
(Grafiken: Institut für Stadtplanung und Städtebau Universität Duisburg-Essen)<br />
Seite 38/39<br />
Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2010<br />
Arbeitsmodell, Werkstattdiskussionen (Fotos: Stefan Bayer)<br />
Seite 41<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Seite 54<br />
Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong> macht Plätze<br />
Hintergrund: (Foto: Thomas Serres)<br />
links oben: Licht- und Luftbad, Pulheim (Künstlerin: Sigrid Lange)<br />
mitte oben: Streulicht (Künstler: Maik und Dirk Löbbert)<br />
rechts oben: Wettbewerbsjury<br />
mitte links: Rheinbraunplatz, Wesseling (Entwurf: Pesch und Partner)<br />
mitte rechts: Wallstraße, Ahaus (Entwurf: Reicher Haase Architekten)<br />
unten links: Rheinbraunplatz, Wesseling (Entwurf: Pesch und Partner)<br />
Seite 57<br />
Kunst trifft Stadt<br />
links oben: Partitur Stadtgarten, Aachen<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
links mitte: un-built cities, Bonn<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
links unten: Brückenreisetag des Kunstvereins Mülheim,<br />
Station Schloss Moyland<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Julia Pasalk)<br />
rechts oben: Die Baulücke als Möglichkeitsort, stadtraum.org, Düsseldorf<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Julia Pasalk)<br />
rechts mitte: Kunst am Wegesrand, Düsseldorf<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
rechts unten: stadtraum.org, Düsseldorf und Brückenreisetag, Mülheim<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Julia Pasalk)
Seite 58/59<br />
Privatgrün<br />
links oben: (Künstler: Bogomir Ecker)<br />
links mitte: (Künstler: Michael Munding)<br />
links unten: (Künstler: Beat Zoderer)<br />
rechts oben: (Künstler: Chin Yusen)<br />
rechts mitte: Baumhaus (Künstler: Timm Ulrichs / Foto: Friedrich Rosenstiel)<br />
rechts unten: Kunstobjekt Atelier van Lieshout<br />
(Quelle: alle Fuhrwerkswaage Kunstraum e.V.)<br />
Seite 60<br />
Lichtatlas – Lichtkunst und Lichtprojekte im öffentlichen Raum<br />
Xenon for Duisburg, Fließtextprojektion auf die Glashalle der Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg<br />
(Künstlerin: Jenny Holzer / Videoproduktion: Jochen Renz)<br />
Seite 61<br />
oben: Landschaftspark, Duisburg-Nord (Foto: Werner J. Hannappel)<br />
links unten: Glitzerbaum, Temporäre Lichtinstallation und Lichtaktion,<br />
Entwurf für den Skulpturenhof der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum,<br />
Duisburg (Künstlerin: Claudia Wissmann / Computermontage: Stiftung<br />
Wilhelm Lehmbruck Museum)<br />
rechts unten: Fluxus, Beitrag für das Werkstattverfahren „Lichtboulevard<br />
Friedrich-Wilhelm-Straße, Duisburg“ (Künstler und Foto: Stefan Sous)<br />
unten (kleines Bild): Lichtinstallation Kant Park, Duisburg<br />
(Künstler: Francois Morellet / Foto: Werner J. Hannappel)<br />
Seite 63<br />
Herbstakademie und Stadt der Geschwindigkeit<br />
Hintergrund: B1 / A 40<br />
links oben: Billboard Lichtburg, Essen<br />
links unten: Arbeitsmodell B1<br />
rechts oben: McDonalds Drive-In<br />
rechts unten: Mittelstreifen mit Busspur<br />
(Quelle: Bergische Universität Wuppertal und RWTH Aachen)<br />
Seite 65<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Seite 82<br />
Architektur macht Schule<br />
links oben: Unterrichtsmaterial „Alles nur Fassade?“ (Autor: Gert Kähler)<br />
mitte oben: Schulbuch „Wie gewohnt?“ (Autor: Gert Kähler)<br />
rechts oben, links unten, rechts unten: (Quelle: Architektenkammer <strong>NRW</strong>)<br />
Seite 84<br />
Stad(T)räume<br />
links oben: (Quelle: Städte-Netzwerk <strong>NRW</strong>)<br />
rechts oben: (Illustration: Petra Raffelsiefer)<br />
großes Foto: Kongress im stadt.bau.raum (Quelle: Städte-Netzwerk <strong>NRW</strong>)<br />
Seite 85<br />
links: Kongress im stadt.bau.raum (Quelle: Städte-Netzwerk <strong>NRW</strong>)<br />
rechts: Kongress im stadt.bau.raum (Quelle: Städte-Netzwerk <strong>NRW</strong>)<br />
Seite 86/87<br />
Türme für PISA<br />
Ausstellung der Türme (Quelle: Ingenieurkammer-Bau <strong>NRW</strong>)<br />
Seite 88<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur Gelsenkirchen<br />
(Umbau: Böll und Krabel Architekten / Fotos: Rainer Lautwein)<br />
Seite 89<br />
stadt.bau.raum, Maschinenhalle, Gelsenkirchen<br />
(Restaurierung: Pfeiffer, Ellermann und Preckel / Foto: Günter Lintl)<br />
stadt.bau.raum, Anbau, Gelsenkirchen (Architektur: Pfeiffer,<br />
Ellermann und Preckel / Foto: Günter Lintl)<br />
Seite 90<br />
Baupolitische Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Landesvertretung <strong>NRW</strong>, Berlin<br />
(Architektur: Petzinka Pink / Foto: Taufik Kenan)<br />
Seite 91<br />
links oben: FH Gelsenkirchen, Abteilung Bocholt (Architektur: Heinrich,<br />
Wörner u. Vedder / Lichtinstallation: Jan van Munster / Foto: Michael Rasche)<br />
rechts oben: Schloss Augustusburg, Brühl (Quelle: Bildarchiv Monheim)<br />
mitte: Ständehaus / Museum K 21, Düsseldorf<br />
(Umbau: Kiessler u. Partner / Foto: Günter Lintl)<br />
unten: Ständehaus / Museum K 21, Düsseldorf<br />
(Umbau: Kiessler u. Partner / Foto: Günter Lintl)<br />
Seite 92<br />
Mögliche Orte – Bildwelten, Planerwelten?!<br />
Workshopgruppe „Süd“ – „Nutze die Möglichkeiten“<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Frauke Burgdorff)<br />
Seite 93<br />
links: Ausstellung im stadt.bau.raum<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Volker Katthagen)<br />
rechts oben: Workshop im stadt.bau.raum<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Frauke Burgdorff)<br />
rechts unten: Ausstellung im stadt.bau.raum<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Volker Katthagen)<br />
157
158<br />
Seite 94<br />
Tag der Architektur<br />
von links oben nach rechts unten:<br />
Neubau Verwaltungsgebäude Stadtwerke, Bochum<br />
(Architektur und Foto: Gatermann und Schossig)<br />
Bürogebäude auf dem Gelände der ehemaligen Zementfabrik, Bonn<br />
(Architektur: Schommer / Foto: Tomas Riehle)<br />
Neubau eines Einfamilienhauses, Bochum<br />
(Architektur und Foto: Heiderich Hummert Klein)<br />
Schloss Bensberg / Wohnen im Schlosspark, Bergisch Gladbach<br />
(Landschaftsarchitektur und Foto: Jürgen Schubert)<br />
Bürohaus "Spherion", Düsseldorf<br />
(Architektur: Deilmann Koch / Foto: H. G. Esch)<br />
Landtag Nordrhein-Westfalen/Umbau, Düsseldorf<br />
(Architektur und Foto: Eller und Eller)<br />
Eifel-Therme-Zikkurat, Mechernich<br />
(Architektur: RSP-Architekten / Foto: Willebrand)<br />
Zentrum für Kommunikations- und Informationstechnologie, Essen<br />
(Architektur: Schröder und Kamm / Foto: Bertram Schröder)<br />
Neubau eines gemeinschaftsorientierten Mehrfamilienhauses, Dortmund<br />
(Architektur: Norbert Post, Hartmut Welters / Foto: Cornelia Suhan)<br />
Aufstockung und Umbau der Dorma-Hauptverwaltung, Ennepetal<br />
(Architektur: KSP Engel und Zimmermann / Foto: Stefan Schilling)<br />
Seite 95<br />
oben: Neubau eines Einfamilienhauses, Marl<br />
(Architektur: Ansgar Huster / Foto: Martin Schmüdderich)<br />
links: Wohnhaus, Bielefeld<br />
(Architektur und Foto: Poggenhans und Mühl, Bielefeld)<br />
rechts: Neubau eines Bürogebäudes mit Gewerbebetrieb, Gütersloh<br />
(Architekt und Foto: Arnd Zumbansen)<br />
rechts unten: Essener Philharmonie – Konzertsaal im Saalbau<br />
(Architektur: Busmann und Haberer / Foto: Herr Richter)<br />
Seite 96/97<br />
koelnarchitektur.de<br />
Hintergrund: Logomobile<br />
links: Architaxi<br />
rechts: Homepage<br />
rechts unten: Logomobile<br />
(Quelle: alle koelnarchitektur.de)<br />
Seite 98<br />
plan<br />
Wohnmodell, Köln<br />
(Entwurf: Andreas Fritzen und Joerg Rekittke / Foto: plan project, Burat)<br />
Seite 99<br />
links: How to be a Perfect guest (Künstler: Wim Salki)<br />
rechts: Parkdeck Restaurant “Bitumen Palace” (Künstler: Boris Sieverts)<br />
(Fotos: alle plan project, GrawBöckler)<br />
Seite 100<br />
Essen erlebt Architektur<br />
Stattwald (Künstler: Frank Ahlbrecht, Dorothee Bielfeld / Foto: BDA Essen)<br />
Seite 101<br />
oben links und rechts: Ungestörtes Wachstum<br />
(Künstler: Eckhard Schlichten, Matz Schulten / Foto: BDA Essen)<br />
unten links: Capsule<br />
(Künstler: Miriam Giessler und Hubert Sandmann / Foto: BDA Essen)<br />
unten rechts: Stadtwunde<br />
(Künstler: Werner Ruhnau, Astrid Bartels / Foto: BDA Essen)<br />
Seite 102<br />
RheinRuhr City<br />
Netzwerk-Szenario: Duisburger Hafen<br />
(Entwurf: MVRDV / Installationsshots: <strong>NRW</strong> Forum Düsseldorf)<br />
Seite 103<br />
Campus-Szenario: Duisburger Hafen<br />
(Entwurf: MVRDV / Installationsshots: <strong>NRW</strong> Forum Düsseldorf)<br />
Seite 105<br />
<strong>Jahre</strong>skongress 2005: <strong>NRW</strong>urbanism<br />
Einladungsflyer (Gestaltung: serres design)<br />
Kongress-Diskussionen<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Elke Torges)<br />
oben rechts: Abtei, Brauweiler<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Foto: Elke Torges)<br />
Seite 106<br />
<strong>Jahre</strong>skongress 2005: Realität Bauen<br />
Einladungsflyer (Gestaltung: serres design)<br />
Seite 107<br />
Kongress-Diskussionen<br />
(Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. / Fotos: Stefan Bayer)<br />
Seite 109<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Seite 122<br />
Denkmalkommission<br />
von oben nach unten:<br />
Bagno-Park, Konzertgalerie, Steinfurt-Burgsteinfurt<br />
Ehemaliges Heeresverpflegungsamt Münster<br />
Schloss Horst, Gelsenkirchen (Foto: Dr. Birgitta Ringbeck)<br />
Ehemaliger Überwasser-Friedhof in der Umgebung des Schlossgartens,<br />
Münster (Quelle: Westfälisches Amt für Denkmalpflege)<br />
Seite 123<br />
Lagerhaus der Textilfabrik Gebr. Laurenz, Ochtrup<br />
(Quelle: Rheinisches Amt für Denkmalpflege)
Seite 125<br />
DenkMalStadt!<br />
Einladungsflyer (Gestaltung: serres, design.)<br />
Diskussionsabend Gelsenkirchen (Fotos: Pesch und Partner)<br />
Seite 127<br />
Planungs- und Gestaltungsbeiräte <strong>NRW</strong><br />
links: Platzgestaltung, Bielefeld (Quelle: Stadt Bielefeld )<br />
links unten: Umbau Wohn-/Geschäftshaus, Aachen<br />
(Architektur: Prof. Dr.-Ing. Kahlen Planungsgesellschaft)<br />
rechts: Bahnhofsvorplatz mit Radstation, Münster<br />
(Architektur: Brandt und Böttcher / Foto: Jürgen Tölle, Olaf Mahlstedt)<br />
Seite 128<br />
Liebe deine Stadt<br />
Collage (Gestaltung: Merlin Bauer)<br />
Seite 129<br />
Panoramapavillon an der Hohenzollernbrücke<br />
(alle Fotos: Merlin Bauer, Albrecht Fuchs, Veit Landwehr)<br />
Seite 130<br />
Gartenkunst in <strong>NRW</strong><br />
oben: Schloss Lembeck, Dorsten (Foto: Wolfgang Gaida)<br />
mitte: Ausschnitt Botanischer Garten Schloss Clemensruh, Bonn<br />
(Foto: Dorina Herbst)<br />
unten: Schloss Benrath, Düsseldorf<br />
(Quelle: Stiftung Schloss und Park Benrath)<br />
Seite 131<br />
oben: Schloss Dyck, Jüchen (Quelle: Stiftung Schloss Dyck)<br />
links mitte: „Maman“, Schlosspark Wendlinghausen<br />
(Künstlerin: Louise Bourgois / Foto: Nic Tenwiggenhorn)<br />
rechts mitte: Industrienatur Kokerei Hansa, Dortmund<br />
(Foto: Michael Schwarze-Rodrian)<br />
Seite 132<br />
Zeche Zollverein Schacht XII, Essen<br />
(Foto: Thomas Mayer)<br />
Seite 133<br />
oben: Rohbau Zollverein School of Management and Design, Essen<br />
(Architektur: SANAA)<br />
links unten: Modell Zollverein School of Management und Design<br />
rechts unten: Modell Umbau Kohlenwäsche<br />
(Umbau: O.M.A., Böll und Krabel)<br />
(alle Fotos: Thomas Mayer)<br />
Seite 135<br />
Schurenbachhalde, Essen (Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 136<br />
Garten der Erinnerungen, Duisburg<br />
(Gestaltung: Dani Karavan / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 137<br />
Wohn-/Geschäftshaus H20, Münster (Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 138<br />
Rheinufer Düsseldorf (Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 139<br />
TZU Oberhausen (Neubau: Reichen und Robert / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 140<br />
Campus Ernsting’s Family, Coesfeld<br />
(Architektur: Reichlin, Schilling / Landschaftsarchitektur: Wirtz / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 141<br />
Insel Hombroich, Neuss (Gestaltung: Heerich / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 142<br />
PACT Zollverein, Essen (Umbau: Mäckler Architekten / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 143<br />
THS-Hauptverwaltung, Zeche Nordstern, Gelsenkirchen<br />
(Umbau: PASD-Feldmeier und Wrede / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 144<br />
BauhausKarree, Duisburg (Architektur: Mewes / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 145<br />
Bundeskanzlerbungalow, Bonn (Architektur: Sepp Ruf / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 146<br />
Neues Konzerthaus, Dortmund<br />
(Architektur: Schröder, Schulte-Ladbeck und Strothmann / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 147<br />
Fortbildungsakademie Mont Cenis, Herne<br />
(Architektur: Jourda und Perraudin / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 148<br />
Schurenbachhalde, Essen (Künstler: Serra / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 149<br />
Jahrhunderthalle, Bochum (Umbau: Petzinka Pink Architekten / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 150<br />
Kölner Dom (verschiedene Dombaumeister / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 151<br />
Ruhruniversität, Bochum (verschiedene Architekten / Foto: Birgit Hupfeld)<br />
Seite 153<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
159
160<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
im Auftrag für das<br />
Ministerium für Bauen und Verkehr<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Konzeption<br />
Karin Bandow<br />
Frauke Burgdorff<br />
Dirk E. Haas<br />
Dr. Ulrich Hatzfeld<br />
Dr.-Ing. Juliane Pegels<br />
Redaktion<br />
Dirk E. Haas<br />
Dr.-Ing. Juliane Pegels<br />
Lektorat<br />
Karin Bandow<br />
Dirk E. Haas<br />
Dr.-Ing. Juliane Pegels<br />
Marion Kress<br />
Gestaltung<br />
Thomas Serres, serres, design.<br />
Fotografie „Baukultur persönlich“<br />
Birgit Hupfeld<br />
Druck<br />
????????????<br />
Übersetzung<br />
Heike Reintanz-Vanselow<br />
(Text Prof. Dr. Jörn Rüsen)<br />
Kontakt<br />
Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.<br />
Leithestraße 33<br />
D-45886 Gelsenkirchen<br />
www.stadtbaukultur.nrw.de<br />
Dr. Ulrich Hatzfeld<br />
Ministerium für Bauen und Verkehr<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Fürstenwall 25<br />
D-40219 Düsseldorf<br />
www.mbv.nrw.de<br />
© 2006 Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.;<br />
Autoren, Fotografen, Künstler und ihre Rechtsnachfolger<br />
ISBN 3-9809564-8-2<br />
Printed in Germany<br />
<strong>StadtBauKultur</strong> ist eine Initiative der Landesregierung<br />
Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Architektenkammer,<br />
der Ingenieurkammer-Bau, der Arbeitsgemeinschaft<br />
der Kommunalen Spitzenverbände, der Vereinigung<br />
der Industrie- und Handelskammern, den Verbänden der<br />
Bau- und Wohnungswirtschaft und den Künstlerverbänden<br />
in Nordrhein-Westfalen.<br />
Diese Broschüre kann bei den Gemeinnützigen Werkstätten<br />
Neuss GmbH bestellt werden. Bitte senden Sie Ihre<br />
Bestellung unter Angabe der Veröffentlichungsnummer<br />
SB 163 (per Fax, E-Mail oder Postkarte) an die<br />
GWN GmbH - Schriftenversand<br />
Am Henselsgraben 3<br />
D-41470 Neuss<br />
Fax: 0 21 37 / 10 94 29<br />
E-Mail: mbv@gwn-neuss.de<br />
Telefonische Bestellung über<br />
C@ll <strong>NRW</strong>: 0180 / 310 01 10<br />
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung<br />
Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von<br />
Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines<br />
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies<br />
gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist<br />
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben<br />
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls<br />
die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig<br />
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem<br />
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer<br />
bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als<br />
Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen<br />
verstanden werden könnte.


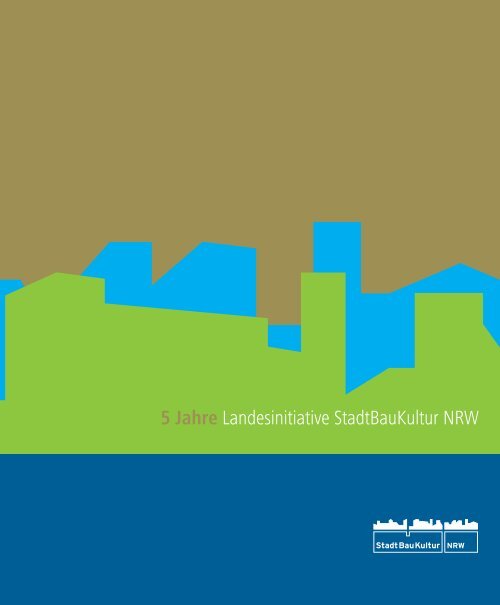













![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)
